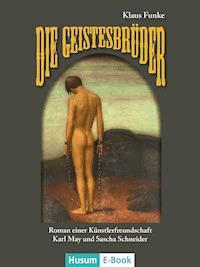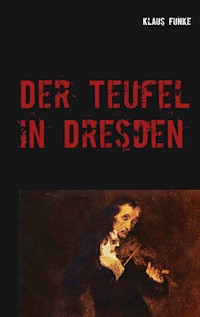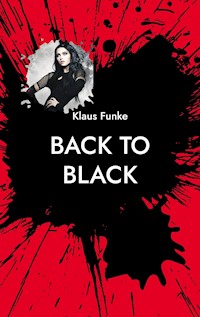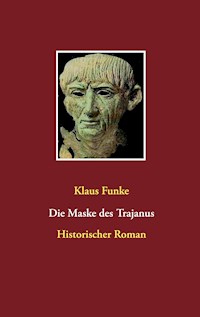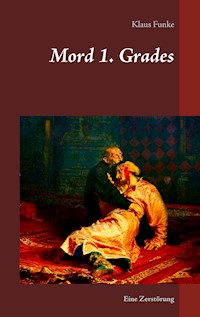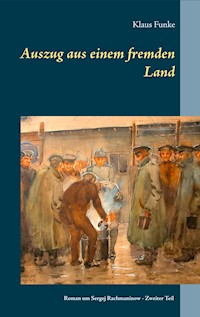Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ein älterer Herr aus der ersten Reihe hat zu mir gestarrt mit seinem Konzertbesucherblick, dieser Mischung aus Neugier und Herablassung, aus Neid und Intoleranz, mit dem sie einen immer anblicken, diese Konzertbesucher, besonders diejenigen aus Dresden, die den ekelhaftesten Konzertbesucherblick überhaupt haben, diesen Kapellenblick, abgeleitet von der Hofkapelle, der sie sich wie Sektenmitglieder verpflichtet fühlen und alle Fremden mit eisiger Abwehr betrachten ..." Voller Sarkasmus und beißender Ironie, doch mit gleichsam dahinschmelzender Einfühlung in alles wahrhaft Musikalische, liefert der Dresdner Autor Klaus Funke mit seiner Novelle "Kammermusik" ein Kabinettstück monologisierender Erzählkunst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor:
Klaus Funke, geboren in Dresen, legte das Buch “Kammermusik” 2004 erstmalig vor. Seither vielfach besprochen und rezensiert. Es ist Funkes erster Bestseller. Danach wandte er sich dem Musik- und Künstlerroman zu. Es entstanden in kurzerr Folge erfolgreiche Werke wie “Zeit für Unsterblichkeit” – “Der Teufel in Dresden” – “Am Ende war alles Musik” – u.a.
Neuerdings veröffentlicht Funke auch Krimis und Thriller.
Ein Wort zuvor
Die Handlung und die darin vorkommenden Personen sind frei erfunden, wie auch manche Handlungsorte verändert und dem Zweck des Buches angepasst sind.
Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen ist zufällig. Sollte man über das Buch streiten, so war das meine Absicht.
KLAUS FUNKE
Dresden, im September 2003
Kein Künstler wünscht etwas zu beweisen.
Oscar Wilde
Während die Besucher des Kammermusikabends noch im Saal stehend sich leise unterhielten, im Foyer rauchten, hin- und hergingen oder in ihren Programmheften lasen, saß ich auf einem der Polsterstühle gleich neben dem linken Seitengang und beobachtete meine Schwester, die sich vor der niedrigen Bühne stehend mit Stefan Bosel unterhielt, jenem Bosel, der gemeinsam mit den Mitglieder des nach ihm genannten Bosel-Trios in wenigen Minuten auf der Bühne die beiden Klavier-Trios von Franz Schubert, nämlich D.896 in B-Dur und D. 929 in Es-Dur zu Gehör bringen würde. Auch ich kannte Bosel, aber wir hatten uns, nachdem wir einige Zeit an der hiesigen Hochschule gemeinsam studiert hatten und Bosel auch in unserem Hause verkehrt war, aus den Augen verloren; besonders als ich die Musik an den Nagel, wie zu sagen ist, hatte hängen müssen, sind wir uns nicht mehr begegnet. Das können beinahe schon zwanzig Jahre her sein, dachte ich auf dem Polsterstuhl im Gobelinsaal vor Beginn des Kammermusikabends, denke ich jetzt liegend auf dieser harten Pritsche mit der weiß-blau gemusterten eingerollten Decke am Fußende. Und meine Schwester sprach mit diesem Bosel, ich sah ihnen zu und mir fiel ein, wie sie vor ein paar Tagen am Telefon gesagt hatte: Stell dir vor! hatte sie aufgeregt in den Hörer gerufen, ich habe Karten für das Bosel-Trio am Donnerstag. Bosel?? hatte ich zurückgefragt. Ja, der Stefan, den wirst du doch noch kennen, sagte sie mit aufgesetzter Fröhlichkeit. Ja, natürlich, hatte ich etwas gedehnt geantwortet. Wenn ich, so dachte ich auf dem Polsterstuhl, nicht zu Hause gewesen wäre, sondern in Wien, wo ich eigentlich hätte sein sollen um diese Zeit, aber nicht hingefahren war, weil der Sinnlhuber, mein Verleger und Auftraggeber, mir abgesagt hatte, kurzfristig, wie immer, dann hätte meine Schwester mir nicht die Bosel Karte anbieten können und mir wäre die ganze Bosel Erinnerung nicht angekommen, so wie sie jetzt, wie ich auf dem Polsterstuhl im Gobelinsaal dachte, auf mich einzudrängen beginnt.
Und ich hatte all die Jahre kaum an ihn gedacht, an ihn auch nicht denken wollen, er war fast vergessen und wie von Ferne hatte ich Rezensionen, Kritiken und Nachrichten von seinem Auftreten in Europa und in Übersee in mich aufgenommen, ja, mir schien es, so dachte ich auf dem Polsterstuhl, dass ich um so erleichterter gewesen war, je weiter weg ich ihn wähnte. Wie er jetzt mit meiner Schwester zusammenstand, dort vorn, vor der niedrigen Bühne, die eher einem Podest glich, sah er gealtert und abgearbeitet aus mit eingefallenen Schläfen und müden Augen, das Haar gelichtet, er, den ich einmal mit Siegfried, dem Germanenhelden verglichen hatte, der blond mit zupackenden blauen Augen, breiten Schultern und seinem verführerischen Lächeln der Mittelpunkt unserer kleinen Studentenschar gewesen war. So sah ich ihn, wie ich mich auf dem Polsterstuhl sitzend erinnere, damals gleich zu Beginn unseres Studiums in der Aula sitzen, unter den anderen Studenten, wartend auf den Rektor, der uns die Begrüßungsansprache halten sollte, und er ist mir wie ein Leuchtpunkt, wie ein Solist unter lauter Chorsängern vorgekommen, ich konnte nicht anders, ich musste mich andauernd nach ihm umblicken und ich tat das solange, bis er es bemerkte und mir sein Lächeln zusandte, jenes Lächeln, für das er später, neben seiner unglaublichen pianistischen Begabung berühmt werden sollte, dieses Lächeln, das Mädchen und Frauen jeden Alters, aber auch Männer dazu trieb, sich vor seiner Künstlergarderobe oder an den Bühnenausgang in langen Reihen anzustellen, nur um ein Autogramm zu bekommen und dabei, das schien ihnen, wie ich auch jetzt noch denke, die Hauptsache zu sein, nämlich von ihm angelächelt zu werden. Oft habe ich überlegt, was das Geheimnis dieses Lächeln gewesen ist, und einige Male stand ich daheim im Badezimmer vor dem Spiegel und habe versucht, ebenso den Mund zu verziehen, die Augen erstrahlen zu lassen, den Kopf ein wenig vorzuneigen, also alles genauso zu tun, wie er es tat, wenn er lächelte. Aber ich gab es schnell wieder auf, denn aus dem Spiegel grinste mich nur mein bekanntes rundes und langweiliges Gesicht an. Ich sah meine glanzlosen Augen, den schlaffen Mund und das damals bereits schon künftige Fülle anzeigende Kinn. Ich würde niemals ein Stefan Bosel, im Lächeln nicht, wie ich auch seine Brillanz und Leichtigkeit, sein geniales Klavierspiel nie erreichen, ja es nicht einmal nachahmen können würde.
Und ich blickte zu Bosel hin, von meinem Polsterstuhl aus, während die Konzertbesucher allmählich ihre Plätze suchend und sich niedersetzend die Stuhlreihen füllten, und ich sah, wie meine Schwester eigentümlich verspannt vor ihm stand, wie sie ihm gebannt auf den Mund schaute, wie ihre Augen diesen abenteuerlichen Glanz bekamen, wie ihr sogenannter Geigerfleck, dieses Wundmahl aller Violinisten, sich dunkelrot verfärbte, und wie sie Zeit und Raum um sich her zu vergessen schien, nicht bemerkend, dass der Inspizient schon zweimal von der Seite her, aus dem einen Spalt geöffneten Vorhang hervor, Zeichen gemacht hatte, man möge das Gespräch nun einstellen, sie solle auf ihren Platz gehen und Herr Bosel möge hinter die Bühne, oder besser hinter den Vorhang kommen. Denn auch dieser, der Bosel, das sah ich von meinem Polsterstuhl, machte keine Anstalten das Gespräch zu beenden, er war angeregt und ein Anflug jenes Lächelns, von dem ich sprach, umspielte seine Lippen. Denn auch meine Schwester gehörte damals zu seinen Verehrerinnen, ja mehr noch, und ich konnte, so sehr ich es auf meinem Polsterstuhl sitzend wünschte, gerade diesen Gedanken, diese Erinnerung nicht unterdrücken, denn sie war, wie mir schmerzhaft bewusst wurde, eine Zeitlang seine Geliebte gewesen.
Sie hatten sich verabschiedet, sich die Hände gegeben, und mir war aufgefallen, dass Bosel die Hand meiner Schwester einen Augenblick zu lange in der seinen gehalten hatte, dann war er hinter den Vorhang und meine Schwester zu ihrem Platz gegangen. Der Vorhang glättete sich, hing wie vordem unbeweglich und schwer herunter, meine Schwester setzte sich neben mich. Einige Augenblicke später betrat das Bosel Trio die Bühne. Bosel kam als letzter, vor ihm schritten der Geiger, ein Moshe Rosensteyn aus Tel Aviv, wie ich im Programmheft gelesen hatte, und der Cellist, Thomas Laxberner, ein Österreicher, sie traten auf das halbrunde Podest, das als Bühne diente. Man ordnete die Noten, eine blasse Rothaarige, kaum Zwanzig, offenbar Studentin, kam bescheiden und, wie mir schien, etwas verlegen hinzu und setzte sich neben Bosel an den Steinway. Dieser gab dem Geiger und dem Cellisten mit dem Kopf ein Zeichen, dann schloss er für einen Moment die Augen...
Wie damals, schoss es mir auf dem Polsterstuhl sitzend durch den Kopf, schon bei seinem ersten öffentlichen Vorspiel als Student im holzgetäfelten Musikzimmer einer alten Gründerzeitvilla an der Elbe hatte er so gesessen, die Hände nur Millimeter über der Tastatur des Instruments in Verharrung haltend, die Augen geschlossen. Damals hatte ich an Konzentration gedacht, daran, dass Bosel das Stück und die Noten im Kopf bereit machte, dass er sich und seine Gedanken versammelte, wie es zu nennen ist, aber ich glaubte nicht an Verstellung an, an Schauspielerei, an theatralisches Gehabe, und doch ist es schon in dieser frühen Zeit seiner Künstlerlaufbahn immer beides gewesen, nämlich das gedankliche Eintauchen in die Musik und gleichzeitig das Theaterspielen, dem Konzertbesucher den vergeistigten, von seiner musischen Mission durchdrungenen Künstler zu geben. Mir war solches verhasst, ich wollte Musik machen, in erster Linie für mich selbst, in mir selbst sollten die Klänge schwingen, die Töne meine Seele zum Klingen bringen, und hatte ich Zuhörer, so sollten auch die das empfinden, was ich empfand, aber nur Kraft meines Spiels und niemals durch äußere Effekte. Einmal, auch das ist ganz am Anfang unseres Studiums gewesen, war ich mit Bosel im kleinen Park, der unser Hochschulgebäude, einen grauen Steinkoloss, wie ein immergrüner Kranz umgab, unter Kiefern und hohen Rhododendronbüschen umhergegangen und wir sprachen über die Musik und die Kunst, führten ein kluges und ernsthaftes, ein würdiges Gespräch. Du musst, sagte Bosel, von mir auf diese feierlichen Gesten vor seinem Spiel angesprochen, du musst, wiederholte er und lächelte sein Heldenlächeln, du musst, sagte er zum dritten Mal, dem Konzertbesucher das Gefühl geben, dass wir, die Künstler, in diesem Moment, wo wir unseren Vortrag beginnen, mit Gott oder unserem Genius, oder mit beiden (er lachte) in Verbindung stehen, dass wir uns konzentrieren, weil wir den Zuhörer achten, ihm ein fehlerloses, reifes Kunsterlebnis bieten wollen. Immer schon, sagte er, dachte ich auf meinem Polsterstuhl, Sekunden vor Beginn des Schubertschen Opus 100, ist jede Kunst, besonders die Musik, auch mit der ihr eigenen Geste verbunden gewesen, was ist ein Swatoslaw Richter ohne sein Schnaufen, was ein Gould ohne die gekrümmte Haltung und sein leises Mitsingen, ein Menuhin ohne die geschlossenen Augen und die geblähten Nasenflügel, was wäre Furtwängler ohne sein wirr fliegendes Haar, Konwitschny ohne die Ströme von Schweiß, Rostropowitsch ohne sein berühmtes Kopfschütteln oder Toscanini ohne die angstvoll aufgerissenen Augen – all diese Gesten zeigen die göttliche Verzückung, ja die Entrücktheit des Künstlers und sein Einssein mit dem Schöpfer. Glaub mir, sagte Bosel damals auf den Kieswegen neben mir hinschreitend, dachte ich, die Konzertbesucher wollen solches sehen, sie sind vernarrt danach. Sie wollen teilhaben an der Berührung mit Gott, die ihnen der Künstler bietet, sie ersehnen das Einmalige, die Hingebung, die nur wir ihnen geben können. Deshalb mein Lieber, sagte Bosel, dachte ich auf meinem Polsterstuhl, nur deshalb halte ich meine Hände vor dem Vortrag auf den Tasten in einer Art verzücktem Schwebezustand und schließe die Augen. Es dient mir und dem Kontakt mit meinem Genius und es konzentriert, wie mich, den Konzertbesucher, es lässt uns eine göttliche Gemeinschaft werden. Solches sprach Bosel zu mir und ich bewunderte ihn, das dachte ich auf meinem Polsterstuhl im Gobelinsaal, wie ich mich jetzt auf der Pritsche liegend erinnere.
Da erklangen die ersten Akkorde des Opus 100 und ich schloss die Augen. Kraftvoll, im Gleichklang der drei Instrumente setzte die Musik ein und schon die ersten Takte rissen mich aus meinen Gedanken fort, trugen mich hinüber in die fein gewebte Welt der Töne. Das männlich zupackende Spiel Bosels, der mit Leidenschaft, wie mir schien, die anderen anspornte, und der zugleich mit perlender Leichtigkeit, die man an ihm rühmte, die Tonläufe wie zarte aneinander gereihte Tröpfchen klingen ließ, der Schmelz der Violine und der warme Celloklang, dies alles zwang mich zu hören und zu fühlen, ja mir war es, als dringe die Musik mir nicht nur über die Ohren, sondern auch über die ganze Haut in die Seele, als atme mein ganzer Körper sie ein. Unwillkürlich, ich konnte es nicht hindern, ließ mich der hämmernde Takt des ersten Satzes und das immerwährende Parallelspiel der drei so verschiedenen Instrumente, alle Fasern und Bahnen meines Körpers im Takt schwingen, es hüpfte, es tanzte in mir, es zuckte und schwang; Kopf und Schultern fingen an sich zu bewegen, und auch meine Schwester, das spürte ich, war ganz gefangen, auch sie zuckte, bewegte sich, und als ich für einen Moment die Augen öffnete, sah ich sie gebannt, nach vorn geneigt sitzen, als wollte sie, wie eine Katze, zum Sprung ansetzen. Zum Sprung, hin zu dem spielenden Bosel, dachte ich.
Wieder öffnete ich die Augen, sah nach vorn, der zweite Satz hatte begonnen, der vom Dialog des Pianos mit dem Cello lebt, während die Violine nur unterstützend mitzuspielen scheint, und der rötliche Schopf des österreichischen Cellisten verwandelte sich mit einem Mal in Marc Rüdrich, einen meiner damaligen Mitstudenten; ich sah seine blasse sommersprossige Haut, die geröteten Wangen, während hinter den aufgestellten Noten der Blondschopf Bosels auftaucht. Und auf ihrem Stuhl nach vorn gebeugt, wie eben jetzt neben mir im Gobelinsaal, sah ich meine Schwester, auf ihrer Stirn die steile Falte, die sich immer zeigt, wenn sie angestrengt arbeitet. Ja, die Drei hatten im Probensaal der Hochschule jenes Opus 100 von Schubert, das strahlende Es-Dur Klaviertrio gespielt, dachte ich auf meinem Polsterstuhl sitzend; ich war zufällig hinzugekommen, als ich eine Pause nutzend durch die Gänge der Schule gewandelt war. Jetzt erst, mit dem zweiten Satz, dachte ich auf meinem Stuhl, war es mir wieder eingefallen, was Jahre, was Jahrzehnte verschüttet gewesen war, herbeigerufen auch durch die eigentümliche Sitzhaltung meiner Schwester neben mir, an die ich mich wieder erinnerte, dachte ich, und die mich an jenes Spiel im Probensaal in der Hochschule hat denken lassen. Das also ist gewesen, dachte ich sofort auf meinem Polsterstuhl, das hat sie getrieben, die Schwester, die Karten für das Konzert zu kaufen, denn natürlich muss sie gewusst haben, was auf dem Programm stand. Sie wird es, sie muss es gewusst haben, dachte ich, und sie hat diesen Schubert wieder hören wollen, dieses Opus 100, mit dem alles begonnen hatte, dachte ich. Wie ein altes Bild muss diese Musik auf sie einwirken, nur stärker, nur suggestiver, nur kräftiger, mit Schubertscher Leidenschaftlichkeit, die er über die Jahrhunderte hinüber gerettet hat mit seiner Musik, dieser verfluchte Franz Schubert, dachte ich. Ja, hinüber gerettet hat er seine verdammte romantische Leidenschaftlichkeit, die in den Noten abgedruckt die Jahrzehnte überdauert, wie ein eingetrockneter Bazillus, und die wieder lebendig wird, wenn sie einer spielt, der genauso jung, genauso spontan und ewig verliebt ist, wie dieser Franz Schubert es damals war; wenn sie jemand intoniert, dessen Seele so leicht zu entzünden ist, wie es die seine immer gewesen war. Und meine Schwester ist so leicht entzündbar gewesen damals, dachte ich auf meinem Stuhl, und dieses Opus 100 im heldisch strahlenden Es-Dur, der Leibtonart des famosen Bosel, hat den ersten Brand in ihrer Seele gelegt. Damit hat es angefangen. Doch, ich habe es nicht gleich bemerkt. Ich stand und lauschte dem Spiel der Drei im Probensaal und war ergriffen, von den ersten Takten schon, von diesem verdammten Gleichklang, diesem untergehakten Spiel der drei Instrumente, der zwischen den Spielern ungewollt Solidarität und ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt, wie ein gemeinsam gesungenes Marschlied. Man muss sich verschworen fühlen, dachte ich, wenn man diesen Schubert spielt, ganz und gar verschworen, als hätte man eine gemeinsame Tat, eine heldische Es-Dur Tat vollbracht, dachte ich. Und damals im Probensaal stand ich betäubt von der Musik, vielleicht sogar mit offenem Mund, und dachte wie ein Handwerker nur an eine grandiose handwerkliche Arbeit; ich hörte Fehler, Ungenauigkeiten, Flüchtigkeiten, manch unsauberen Ton, jagende, zu schnelle Tempi, und wollte ihnen das sagen, als neutraler Zuhörer, als Kollege, aber ich übersah, dachte ich auf dem Polsterstuhl neben meiner Schwester im Gobelinsaal sitzend, dass der Schubertsche Bazillus damals schon in ihren Körper gefahren war, ich achtete nicht auf die langen Blicke, die sie mit dem Bosel tauschte, während sie den Cellisten Rüdrich wie einen Bruder, beinahe wie mich ansah; ich nahm Bosels berühmtes Lächeln für das, was es immer war, und entdeckte nicht, wie er sein Germanenfeuer in die Augen meiner Schwester senkte; auch, als sie nach dem Ende des vierten Satzes, und auch zwischendurch schon, Intonation, Tempi und vieles andere abstimmten, hielt ich das, was und wie sie miteinander sprachen, die Blicke, die Berührungen an Schulter, an Armen, am Kopf für Normales zwischen Musikern, die gemeinsam proben. Für gute Kameraden eben. Ich argwöhnte nichts, alles war normal, dachte ich.
Wieder schloss ich die Augen, auf dem Polsterstuhl im Gobelinsaal sitzend, denke ich auf meinem ungepolsterten Pritsche, und hörte die Musik, hörte, wie sich die Violine mit schmelzend schmeichlerischem Tönen um die klaren Akkorde des Pianos wand, sie umrankte, während das Cello nur kurz brav, fast verständnisvoll dazu brummte.
Mit meiner Schwester war nach diesem Schubert Spiel im Probensaal der Hochschule, dachte ich, während die Musik mir in Ohren und Haut drang, eine Veränderung vor sich