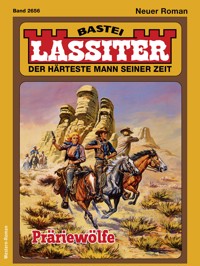1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lassiter
- Sprache: Deutsch
Die Züge von Bundesmarshal Tyler Woodlark wirkten schroff wie der Fels des Canyons, auf den er zuritt. Die enge Schlucht bot die Bühne für einen perfekten Hinterhalt, doch nichts hätte den Sternträger davon abgehalten, sie zu durchqueren.
Kid Cavendish und seine Bande mussten endgültig zur Strecke gebracht werden - und niemals zuvor war Woodlark den Banditen derart nahe gekommen. Diese Chance durfte er nicht verstreichen lassen.
Dabei war Cavendish nur die erste Station auf Tyler Woodlarks Pfad der Gerechtigkeit. Sollte er bei seinem Einsatz draufgehen, würden weitaus schlimmere Elemente das Land in den Abgrund treiben!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Der McKenzie-Clan
Vorschau
Impressum
Der McKenzie-Clan
von Des Romero
Die Züge von Bundesmarshal Tyler Woodlark wirkten schroff wie der Fels des Canyons, auf den er zuritt. Die enge Schlucht bot die Bühne für einen perfekten Hinterhalt, doch nichts hätte den Sternträger davon abgehalten, sie zu durchqueren.
Kid Cavendish und seine Bande mussten endgültig zur Strecke gebracht werden – und niemals zuvor war Woodlark den Banditen derart nahe gekommen. Diese Chance durfte er nicht verstreichen lassen.
Dabei war Cavendish nur die erste Station auf Tyler Woodlarks Pfad der Gerechtigkeit. Sollte er bei seinem Einsatz draufgehen, würden weitaus schlimmere Elemente das Land in den Abgrund treiben!
Es war nur ein kurzer Moment, in dem der Marshal überlegte, um den Canyon herumzureiten und seiner Sicherheit den Vorzug zu geben. Er verwarf den Gedanken aber bereits, nachdem er aufgekommen war. Mehr als ein Tagesritt wäre erforderlich gewesen, die Schlucht zu umkreisen, was Kid Cavendish einen unnötigen Vorsprung verschafft hätte.
Mit geschärften Sinnen und jederzeit bereit, sein Leben mit Waffengewalt zu verteidigen und seine Feinde zur Hölle zu schicken, ließ Woodlark seinen Hengst vorantraben und passierte den Eingang zur Schlucht. Sie war gerade einmal fünf Mannslängen breit und gespickt mit Vorsprüngen, hinter denen ein Gegner lauern konnte. Und vermutlich würde Cavendishs Horde sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, ihren hartnäckigen Verfolger auszuschalten.
Mehr als fünfzig Meilen war Tyler Woodlark der Fährte der Flüchtigen gefolgt, nachdem sie bei einem geradezu spektakulären Banküberfall nicht nur die Angestellten, sondern auch wahllos Dutzende Bürger ermordet hatten. Für Woodlark war es schon fast ein persönliches Anliegen, diesen Abschaum der Gesellschaft ein für alle Mal auszulöschen.
Meile um Meile geschah nichts. Es war ein zermürbender Ritt, der in jeder Sekunde vollste Konzentration und Anspannung voraussetzte. Nur ein flüchtiger Augenblick der Unaufmerksamkeit genügte, um Tyler Woodlark ins Jenseits zu befördern. Und die gegenwärtige Situation war durchaus geeignet, ihre Gefährlichkeit zu unterschätzen.
Der Bundesmarshal erreichte eine Stelle, die regelrecht zu einem Überraschungsangriff einlud. Allein seiner Erfahrung und seinen wachen Sinnen war es zu verdanken, dass er nicht in dem plötzlich auf ihn hereinbrechenden Kugelhagel zersiebt wurde.
Beim Ertönen des ersten Schusses warf er sich geistesgegenwärtig aus dem Sattel, rollte unter peitschenden Einschlägen über den Untergrund und verschanzte sich hinter einem kleinen Felsvorsprung, der es ihm kaum erlaubte, auch nur den Kopf anzuheben, ohne dass ihm dieser vom Hals geschossen wurde.
»Du steckst in der Falle!«, hallte es durch den Canyon. »Deine Leiche wird in der Sonne verfaulen, und die Geier werden sich an deinem Fleisch laben!« Gleich darauf donnerten mehrere Schüsse und streckten Woodlarks Pferd nieder.
Der Marshal zerbiss einen Fluch zwischen seinen Lippen. Seine Winchester und die Ersatzmunition waren unter dem Körper des toten Tieres begraben. Er hatte nur noch seinen Revolver und die Patronen in seinem Gürtel. »Du hältst mich nicht auf, Kid!«, schrie Woodlark zurück. »Ich klebe an dir wie ein eitriges Geschwür zwischen deinen Beinen!«
Die Antwort bestand aus den Salven aus einem halben Dutzend Gewehren. Die Geschosse prasselten auf Woodlarks Versteck ein, rissen Gesteinssplitter heraus und hackten in den sandigen Boden. Pulverdampf wehte heran, Staubwolken stiegen empor. Und die Drohung des Bandenbosses ließ nicht lange auf sich warten. »Wir sind zu siebt, du bist allein!«, brüllte Kid Cavendish, dessen jugendlich klingende Stimme nicht darüber hinwegzutäuschen vermochte, dass man es mit einem ausgebufften Räuber und Mörder zu tun hatte. »Wir kommen dich holen! Vielleicht erledigst du zwei oder drei von uns, aber wir haben einen Pakt mit dem Teufel geschlossen und fürchten den Tod nicht!«
Den Worten folgten Taten. Alle sieben traten gleichzeitig vor und entfachten ein bleihaltiges Feuerwerk. Für Woodlark gab es keine Chance, einen gezielten Schuss anzubringen, ohne von einer Kugel getroffen zu werden. Höchstens vierzig Yards trennten ihn von den Angreifern, und sie kamen rasch heran.
Es half nichts! Bundesmarshal Tyler Woodlark musste etwas unternehmen, ehe er überrannt und wehrlos abgeknallt wurde.
Seine Anspannung wuchs ins Unermessliche. Das ausgeschüttete Adrenalin überflutete seinen Körper. Und dann sprang er in die Höhe und fächerte über den Abzug seines Revolvers.
Gleich in der ersten Sekunde brachen drei Angreifer zusammen und krachten in vollem Lauf in den Staub. Woodlarks Revolver zuckte zur Seite, erwischten einen vierten Gegner, kurz bevor eine Riflekugel seine linke Schulter durchschlug.
Ächzend ging der Sternträger in die Knie, feuerte seine Trommel leer und warf sich hinter die Deckung des Felsvorsprungs. Hastig warf er die verschossenen Patrone aus und füllte seinen Revolver auf. Kaum rastete der Trommelverschluss ein, fegte auch schon ein Gewehrschütze heran.
Ohne Warnung zog er ab, hatte jedoch offenbar nicht mitgezählt, wie viele Kugeln er bereits aus seiner Winchester gejagt hatte. Das Erstaunen auf seinem Gesicht, als er nur ein metallisches Klacken hörte, sprach Bände. Einen Lidschlag darauf traf ihn bereits Woodlarks Bleigeschoss und drang in seine Brust.
Der Marshal katapultierte sich zur Seite, verließ seine Deckung und geriet nun vollends in Rage. Dreimal hintereinander zog er den Abzug seiner Waffe durch und spickte den sechsten Angreifer mit Blei. Der riss aufschreiend sein Gewehr empor, feuerte im Reflex in den Himmel und knallte auf die Felsen. Sein dumpfer Aufschlag wurde gefolgt vom durchdringenden Knacken seines Genicks. Der Leib des Mannes lag verdreht und halb aufgerichtet auf dem Felsvorsprung. Seine Pupillen hatten sich unnatürlich bis fast unter die Lider verschoben.
»Cavendish!«, schrie Woodlark und jagte dem feigen Flüchtenden seine letzten Kugeln hinterher. »Du wirst mir nicht entkommen! Deine Männer sind tot! Und du bist der Nächste!«
Das Getrappel von Pferdehufen wurde laut. Kid Cavendish setzte sich ab – und Tyler Woodlark konnte es nicht verhindern. Erst jetzt spürte er in vollem Umfang das Brennen und Pochen der Kugel in seiner Schulter. Trotzdem wollte er nicht aufgeben. Er würde sich das Blei herausschneiden, eines der Pferde der Banditen nehmen und die Verfolgung aufnehmen.
Und der wichtigste Auftrag, den er von der Regierung erhalten hatte, würde nicht darunter leiden, zuvor Kid Cavendish wie eine Kakerlake zu zerquetschen.
✰
Das Dossier las sich wie eine geduldete Verschwörung, die aus der Feder eines Autors stammte, der für gewöhnlich Geschichten fernab der Realität schilderte. Nur handelte es sich um alles andere als eine Erzählung, die rein der Unterhaltung diente. Und je mehr der Mann der Brigade Sieben aus seinen umfangreichen Unterlagen erfuhr, desto größer wurden seine Bedenken, weshalb diesen kriminellen Machenschaften nicht schon längst ein Riegel vorgeschoben worden war.
Die Antwort war so einfach wie absonderlich: Niemand in der Bevölkerung von Flagstaff und Umgebung nahm wahr, was wirklich vor sich ging. Der McKenzie-Clan besaß ein außerordentlich hohes Ansehen, ergriff Partei für die Schwachen und Schutzlosen und geriet nie in den Verdacht, verwerflichen Aktivitäten nachzugehen. Diese Familie schaffte es, Vertrauen und Sicherheit zu geben – und dennoch ermittelte man in Washington wegen Betrug, Veruntreuung, Raub und Mord im großen Stil.
Die Familie der McKenzies schien viele Bereiche des öffentlichen Lebens fest in der Hand zu halten, ihren Einfluss auszuweiten und ein eigenes kleines Imperium aufzubauen. Es war auch nicht ausgeschlossen, dass sie Politiker gekauft hatten, die ihr Deckung gaben. Es stellte sich allerdings die Frage, was ein einzelner Agent dagegen auszurichten vermochte. Lassiter war gut in dem, was er tat. Angesichts der Bedrohung aber, der er sich gegenübersah, wäre es sicher hilfreich gewesen, eine kleine Armee in der Hinterhand zu halten.
Mit gemischten Gefühlen ritt Lassiter die Mainstreet von Flagstaff entlang und suchte nach einer Unterkunft. Ihm war klar, dass dieser Auftrag nicht von heute auf morgen erledigt sein würde. Er brauchte eine Ausgangsbasis, um mit seinen Ermittlungen zu beginnen, diese auszuweiten und letztendlich den entscheidenden Schlag auszuführen. Das konnte eine Woche dauern, einen Monat oder länger. Vorgaben aus Washington hatte er nicht erhalten.
Die unterschiedlichsten Gedanken gingen Lassiter durch den Kopf. Hielt die Brigade Sieben ihn wirklich für derart kompetent, eine solche Mission allein durchzuführen? Oder sah sie sich gar in einer Zwickmühle und opferte einen ihrer Agenten, um zumindest vor bestimmten Senatsmitgliedern nicht als untätig dazustehen?
Die Beweislage schien eindeutig gegen die McKenzies zu sprechen. Es wäre das Einfachste, die Armee mit der Regelung der Angelegenheit zu betrauen. Dass dies nicht geschah, mochte auf politischen Widerstand zurückzuführen sein. Niemand wollte die Verantwortung für einen solchen Einsatz übernehmen, der gegebenenfalls die Gerichte beschäftigt und die Bürger auf die Barrikaden getrieben hätte.
Lassiter war kein Politiker und konnte so manche Entscheidung aus Washington nicht nachvollziehen, die dem gesunden Menschenverstand zu widerstreben schienen. Er war ein Pragmatiker, der einfach nur dem Gesetz dienen wollte, ohne jedoch seinen eigenen inneren Kompass zu vernachlässigen. Blinder Gehorsam war nicht Lassiters Stil. Er benutzte seinen Verstand und sein Bauchgefühl, wobei Letzteres ihm immer ein zuverlässiger Wegweiser gewesen war.
Vor dem Oakland-Hotel stieg Lassiter aus dem Sattel und leinte seinen Grauschimmel an. Ein Girl in aufreizender, aber nicht aufdringlicher Kleidung warf ihm einen interessierten Blick zu und seufzte kurz, als der Brigade-Agent an ihr vorüberschritt. An der Rezeption mietete er ein Zimmer für eine Woche, machte aber deutlich, unter gewissen Umständen länger zu bleiben.
Ohne sich großartig aufzuhalten, wollte Lassiter mit seinen Recherchen beginnen. Er musste so viele Informationen wie möglich sammeln, um gezielt gegen die McKenzies vorgehen zu können und sich dabei den Rücken freizuhalten. Daher suchte er das Office des Sheriffs auf, um sich einen ersten Eindruck von der Familie zu verschaffen. War sie wirklich so berühmt und berüchtigt, wie das Dossier vermuten ließ, musste der ortsansässige Gesetzeshüter einiges über sie wissen.
Äußerlich wirkte der Sheriff jung und schien nur durch seinen Schnauz- und Kinnbart an Alter zu gewinnen. Doch wenn man genauer hinsah, erkannte man, dass der Sternträger bereits auf die fünfzig zuging. Es waren diese kleinen Fältchen in seinem Gesicht, die erst bei eingehender Betrachtung sichtbar wurden.
»Wie kann ich Ihnen helfen?«, fragte der Mann mit sonorer Stimme, kurz nachdem Lassiter das Büro betreten hatte. »In einer halben Stunde sitze ich dem Bürgerrat bei, aber bis dahin stehe ich Ihnen zur Verfügung.«
Lassiter wollte behutsam vorgehen und nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Er nahm auf dem dargebotenen Stuhl Platz und sagte: »Mein Name ist Lassiter. Ich bin so etwas wie ein Ermittler...«
»Pinkerton?«, erkundigte sich der Sheriff.
»Nein, nein«, wehrte Lassiter ab. »Ich arbeite für eine Organisation, die sich gewisse Sorgen um die Zustände in unserem Land macht.«
Lächelnd erwiderte der Sheriff: »Verzeihen Sie meine Unhöflichkeit. Ich habe mich noch nicht bei Ihnen vorgestellt. Ich heiße Gavin McKenzie und bin seit knapp zwei Jahren im Amt. Bitte erzählen Sie mir, um welche Art von Sorgen es geht.«
Es war Lassiter, als hätte man ihm flüssiges Blei in die Venen gepumpt. Offenbar saß er einem Mitglied jener Familie gegenüber, gegen die er ermitteln sollte. Nach einer kleinen Pause, in der er seine Gedanken ordnete, gab er zu verstehen: »Die Leute, die mich beauftragt haben, sind der Meinung, es würde in Flagstaff Korruption und kriminelle Machenschaften geben. Ich halte das für absurd, bin aber leider genötigt, den Hinweisen nachzugehen. Mir ist es tatsächlich unangenehm, dieses Thema zur Sprache zu bringen, aber ich kann nicht zurückgehen, ohne aus offizieller Quelle einen Beweis für die Nichtigkeit der Anschuldigungen vorzubringen.«
Für einen winzigen Moment sah es aus, als wollten Gavin McKenzies Gesichtszüge einfrieren. Doch genauso schnell, wie dieser Eindruck entstanden war, wurde er von einem Lächeln übertüncht. »Ich bin natürlich sehr daran interessiert, alles zu erfahren, was zum Nachteil meiner Gemeinde beiträgt«, sagte er. »Meine Aufgabe ist es, jeden Schaden von den Bürgern fernzuhalten. Hat man Ihnen mitgeteilt, welche Personen in die Affäre verstrickt sind?«
Eine Fangfrage!, schoss es Lassiter durch den Kopf. Und hätte der Sheriff seinen Namen nicht genannt, wäre er unweigerlich in die Falle gelaufen. So aber entgegnete er: »Deshalb bin ich hier. Ich dachte, Sie könnten mir Aufschluss darüber geben.«
Gavin McKenzie verzog die Lippen, schaute zur Seite und schüttelte seinen Kopf. »Mir ist nichts zu Ohren gekommen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, um wen es sich handeln könnte.«
Lassiter bedankte sich und tippte an seinen Stetson. »Danke für die Auskunft, Sheriff. Ich bin sicher, Sie werden alles unternehmen, um einer drohenden Gefahr Herr zu werden. Aber verstehen Sie bitte auch mich. Ich bin meinen Auftraggebern Rechenschaft schuldig. Mit dem, was Sie mir mitgeteilt haben, werde ich hoffentlich sämtliche Bedenken zerstreuen können.« Er verließ das Office und machte sich zurück auf den Weg zum Hotel. Mit ein bisschen Glück stand die Dirne noch davor.
✰
In dem weitläufigen Zimmer des Herrenhauses herrschte gedämpftes Licht. Nur spärlich drangen die Sonnenstrahlen durch die Vorhänge und schälten die Silhouetten dreier Menschen aus den Schatten. Eine Gestalt stand unbeweglich gleich neben dem Fenster, eine zweite saß auf einem wuchtigen Holzstuhl vor einem ausladenden Schreibtisch und die dritte auf einem Schemel davor.
»Mrs. McKenzie«, sagte der schmächtige Mann auf dem Schemel. »Ich möchte Ihnen nochmals dafür danken, dass Sie mich empfangen haben. Ich weiß, Sie sind sehr beschäftigt, und deshalb...«
Eine grazile Frauenhand schnitt durch die Luft. »Miss McKenzie«, sagte die Rothaarige. »Ich bin nicht verheiratet. Das sollten Sie eigentlich wissen, Mr. Lambert, wenn Sie meiner Familie mehr Beachtung geschenkt hätten.«
Demütig senkte der Angesprochene den Kopf und flüsterte: »Es tut mir leid. Ich würde Sie auch nicht belästigen, wenn ich mir auf andere Art zu helfen wüsste.« Der Mann sah wieder auf, streifte mit seinem Blick die Gestalt neben dem Fenster und meinte: »Wäre es möglich, dass wir uns unter vier Augen unterhalten? Die Situation ist delikat, und ich möchte nicht, dass...«
Wieder unterbrach Allison McKenzie. »Das ist mein Bruder Jefferson. Er ist auch mein Anwalt und betreibt eine Kanzlei in Flagstaff, die Ihnen bekannt sein dürfte. Seine Anwesenheit innerhalb dieser vier Wände ist mir sehr wichtig. Sollten Sie jedoch darauf bestehen, dass er geht...« Die Frau ließ offen, welche Konsequenzen dies mit sich bringen würde.
»Nein, nein!«, wehrte Lambert ab. »Da haben Sie mich völlig falsch verstanden. Auch ich bin froh, dass Ihr Bruder mitbekommt, was ich zu sagen habe.«
Allison McKenzie ließ ein flüchtiges Lächeln erkennen. »Scheuen Sie sich nicht«, sagte sie, »mir Ihre Sorgen mitzuteilen. Ich nehme mir die Zeit, die notwendig ist, um Ihre Probleme zu erörtern.«
Zögerlich begann Lambert zu erzählen. »Ich besitze einen kleinen Gemischtwarenladen in Sedona«, begann er. »Mein Sohn hilft mir im Geschäft, fährt die Märkte ab und räumt die Waren ein. Er ist ein guter Junge, den ich zum amerikanischen Patrioten erzogen habe. Seine Mutter starb leider schon früh am Keuchhusten, aber ich habe nie aufgegeben und war ihm ein guter Vater.
Eines Tages aber – Richard war auf einem Markt in Lost Eden – wurde er auf der Straße von Rowdys angepöbelt. Sie waren betrunken und haben sich über ihn lustig gemacht. Er wollte sie ignorieren, doch diese vier Kerle haben ihn nicht in Ruhe gelassen. Als sie merkten, dass sie Richard nicht aus der Reserve locken konnten, brachten sie sein Fuhrwerk zum Stillstand und zerrten ihn vom Kutschbock. Sie schlugen auf ihn ein und traten ihn, bis er halb besinnungslos am Boden lag.
Niemand kam ihm zu Hilfe. Und selbst der Sheriff, der erst auftauchte, als die Strolche bereits verschwunden waren, meinte, so etwas würde schon mal passieren.
Er hat nicht einmal einen Arzt gerufen!«, gellte Lambert. »Mein Sohn lag mit zertrümmertem Kiefer, gebrochenen Armen und zerquetschten Eingeweiden auf der Straße – und der Sheriff hat nicht einmal einen Arzt gerufen!« Der Mann begann zu schluchzen und wischte sich Tränen aus den Augen. »Richard wird nie mehr der sein, der er einmal war. Er kann nicht einmal mehr selbst essen. Ich muss ihn füttern und versorgen und nebenbei noch den Laden bewältigen. Dem Jungen wurde die Zukunft genommen! Und ich kämpfe jeden Tag um meine Existenz, während diese Bastarde weiterhin auf freiem Fuß sind!«
Ausdruckslos schaute Allison McKenzie ihr Gegenüber an. »Was erwarten Sie, was ich für Sie tue?«, fragte die Frau.