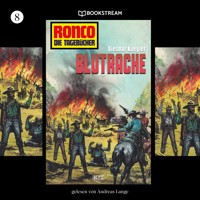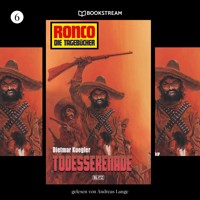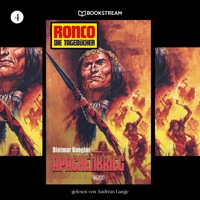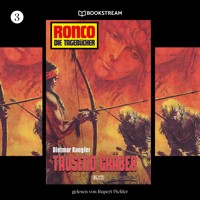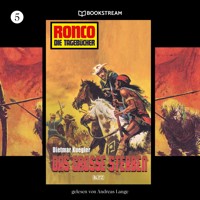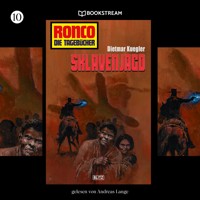Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lobo
- Sprache: Deutsch
Der Mann ist ein Killer. Er tötet ohne Mitleid. Am liebsten Frauen. Lobo bringt ihn an den Galgen. Aber der Killer überlebt und mordet weiter. Jetzt jagt Lobo ihn. Obwohl er weiß, dass die, die Ed Banteen am Galgen sehen wollen, auch ihn verachten. Weil Lobo ein Halbblut ist. Damit ist er weniger wert als der Mörder. Aber er ist der Einzige, der Banteen stellen kann, der Einzige, der ihm gewachsen ist. Eine gnadenlose Jagd beginnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LOBODer Einzelgänger
In dieser Reihe bisher erschienen
4201 Dietmar Kuegler Ausgestoßen
4202 Alfred Wallon Caleb Murphys Gesetz
4203 Dietmar Kuegler Todesfährte
4204 Alfred Wallon Victorios Krieg
4205 Alex Mann Schwarze Pferde
4206 Dietmar Kuegler Der Galgenbruder
4207 Alfred Wallon Ein Strick für Johnny Concho
Dietmar Kuegler
Der Galgenbruder
Als Taschenbuch gehört dieser Roman zu unseren exklusiven Sammler-Editionen und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt.Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.© 2022 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-396-4
Töte ihn zweimal
Kapitel 1
Lobo stand am Fenster, hatte die Gardine ein Stück gelüftet und schaute hinaus auf die Dächer von San Pedro. Es wurde Abend. Die Hitze des Nachmittags lastete noch immer wie ein zäher Brei auf den flachen Hütten der kleinen Stadt.
Die Schatten wurden länger. Lobo sah kaum einen Menschen auf der einzigen Straße von San Pedro.
Lobo ließ die Gardine los und wandte sich um. Das Zimmer war klein, aber erstaunlich sauber. Die Decke war niedrig. Lobo stieß fast mit dem Kopf dagegen.
Die Frau stand an der Tür. Sie war mittelgroß und üppig. Ihr Gesicht wirkte in dem rötlichen Schimmer der Abendsonne, der durch die Gardine in die Kammer eindrang, weich, glatt und sehr jung. Das blonde Haar floss ihr wie eine Löwenmähne auf die schmalen Schultern.
Als sie jetzt ihr dunkelrotes Kleid abstreifte, sah Lobo ihre vollen, straffen Brüste, die sich ihm herausfordernd entgegenreckten. Sie waren birnenförmig und hatten steil aufgerichtete Spitzen mit großen Vorhöfen.
Lobo war lange nicht mit einer Frau zusammen gewesen. Er war ein Mann, den die Einsamkeit der Wildnis wie ein unsichtbarer Schleier umgab. Die Einsamkeit war sein Schicksal, die Wildnis sein Zuhause. Er war ein Halbblut, ein Ausgestoßener, ein Einzelgänger, ein Mann ohne Freunde.
Das Bordell in San Pedro, in dem er sich jetzt befand, war ihm als der richtige Ort erschienen, für kurze Zeit seine Einsamkeit zu durchbrechen, die Verachtung, der er überall begegnete, zu vergessen.
Hier zählte seine Hautfarbe nicht. Er hatte fünf Dollar bezahlt und sich damit für ein paar Stunden die Liebe der Frau gekauft, die sich jetzt mit katzenhaft geschmeidigen, gleitenden Schritten auf ihn zu bewegte.
„Willst du dich nicht ausziehen?“, fragte sie. Ihre Stimme klang dunkel und weich. Sie passte zu ihr. „Gefalle ich dir nicht?“
Lobo antwortete nicht. Seine Blicke blieben an dem dunklen Dreieck zwischen ihren Schenkeln hängen. Er begann, sein Hemd aufzuknöpfen.
„Willst du deinen Revolver nicht abschnallen?“, fragte sie. Sie lächelte. Ihre Hände glitten zu seinen Hüften. Sie stand dicht vor ihm. Als sie sich auf die Zehenspitzen stellte, traf ihr heißer Atem sein Gesicht. Lobo griff nach ihren Schultern und zog sie an sich. Sie stöhnte hingebungsvoll, als er sie küsste, und schob ihr linkes Knie zwischen seine Beine.
Er hob den Kopf.
„Beeile dich“, sagte sie.
Er löste die Schnalle seines Waffengurtes. Der schwere Gürtel mit der Halfter, in der ein langläufiger Colt Army Kaliber 44 steckte, polterte zu Boden. Die Frau streifte ihm mit einer raschen Bewegung das Hemd von den Schultern und schmiegte sich an seinen breiten, muskulösen Oberkörper.
Lobo spürte ihre Haut an der seinen, er spürte den fordernden Druck ihres Körpers.
Da erklang der Schrei.
Es war eine Frau, die schrie. Es war der Schrei einer Sterbenden. Er kam aus einer der benachbarten Kammern.
Lobo hob den Kopf und lauschte gespannt. Er schob das Mädchen von sich weg und ging zur Tür. Ein weiterer Schrei ertönte.
Lobo riss die Tür auf und trat auf den Gang. Einige Türen hatten sich geöffnet. Spärlich bekleidete Mädchen schauten heraus. Lobo sah einen fetten, unförmigen Mann in ausgebeulten Unterhosen in einem Türrahmen stehen.
„Das war Joan“, sagte eine der Frauen. Sie zeigte auf eine Tür am Ende des Gangs, in dem nur eine staubige Petroleumlampe brannte und einen schwachen Lichtschein verbreitete. Lobo ging auf die Tür zu. Als er sie erreichte, hörte er dahinter ein klirrendes Geräusch. Er drückte die Klinke hinunter und schleuderte die Tür nach innen. Sie flog krachend gegen die Wand.
Erst sah er die Frau. Sie lag mit ausgebreiteten Armen quer über dem Bett. Sie war nackt. Sie war tot.
Der Kopf war unnatürlich zur Seite geneigt. Blut floss aus der großen Wunde am Hals und sickerte in das weiße Laken, auf dem die Frau lag. Der Oberkörper der Toten, ihre großen, schlaff wirkenden Brüste, waren mit Blut bedeckt. Die weit aufgerissenen Augen schimmerten glasig.
Lobo erfasste das alles mit einem Blick. Dann erst sah er den Mann.
Er stand am Fenster, das er Sekunden vorher zerschlagen hatte, um sich hinaus zu schwingen. Er war mittelgroß und stämmig. Das karierte Hemd, das er trug, war ihm zu eng. Es spannte sich straff über muskulösen Schultern und Oberarmen. Das Gesicht des Mannes war breitflächig, knochig und unrasiert, die Augen schmal und tückisch.
Als Lobo im Türrahmen auftauchte, riss er seinen Revolver aus dem Gürtel. Lobos Rechte zuckte instinktiv zur Hüfte. Sie griff ins Leere. Der Revolver lag mit dem Gürtel in der Kammer der blonden Frau.
Ein Schuss krachte. Lobo sah den orange-roten Mündungsblitz. Gleichzeitig warf er sich nach vorn.
Er fühlte einen sengenden Lufthauch, als die Kugel über seine linke Schulter strich, dann prallte er schon hart am Boden auf und rollte geschmeidig nach vorn ab.
Er spürte das Brennen kaum, das der Riss verursachte, den die Kugel des stämmigen Mannes hinterlassen hatte. Ein dünner Blutfaden rann über seinen nackten Oberkörper.
Als Lobo hochsprang, krachte ein zweiter Schuss. Die Kugel bohrte sich in die Decke der Kammer. Putz rieselte herunter. Dann traf Lobos rechter Stiefelabsatz den stämmigen Mann in den Unterleib. Der Mann brüllte wie ein verwundetes Tier. Er krümmte sich zusammen und fiel auf die Knie. Sein Gesicht lief blau an. Er schnappte wie ein an Land geworfener Fisch nach Luft. Er röchelte.
Lobo trat abermals zu. Mit der Stiefelspitze traf er das rechte Handgelenk des Mannes. Der Mann schrie abermals und ließ den Revolver fallen.
Als er sich taumelnd aufrichtete, schlug Lobo mit der rechten Faust zu. Der Hieb erwischte den Mann am linken Kinnwinkel. Der Kopf wurde ihm zur Seite geworfen. Er ruderte Halt suchend mit den Armen durch die Luft und taumelte rücklings gegen die Wand neben dem zerschlagenen Fenster.
Lobo hämmerte ihm seine Fäuste in den Leib und dann, als er sich nach vorn beugte, ins Genick. Kraftlos wie ein Stein plumpste der Mörder zu Boden und schlug mit dem Gesicht auf die rauen Bodendielen auf.
Lobo wandte sich ab. Erst jetzt bemerkte er das Brennen auf seiner linken Schulter, und als er mit der Rechten hinlangte, fühlte er das Blut warm und klebrig an seinen Fingern.
An der Tür standen mehrere Frauen. Sie starrten entsetzt in die Kammer.
„Er hat Joan umgebracht, dieses Schwein!“, schrie eine Frau mit überschnappender Stimme.
Lobo warf noch einen Blick auf die Tote auf dem Bett. Süßlicher Blutgeruch, der scharfe Gestank nach Urin und Schweiß hingen in der Kammer.
Lobo fröstelte plötzlich. Er zog die breiten Schultern hoch und ging zur Tür. Sie wichen ihm aus. Er trat in den Gang.
Der fette Mann, der in Unterhosen in einer Kammertür gestanden hatte, als er den Gang nach dem Todesschrei der Frau betreten hatte, war noch immer da. Er war jetzt fast angezogen und quetschte sich gerade, aufgeregt vor sich hin fluchend und schwitzend in eine sichtlich zu enge Hose.
Er stierte Lobo ängstlich an und fragte: „Ist sie tot?“
„Ja“, sagte Lobo. „Sie trägt fast den Kopf unter dem Arm.“
„Wie furchtbar“, erwiderte der dicke Mann mit einem Keuchen. „Das gibt einen Haufen Ärger.“
„Zunächst gibt es eine schöne Beerdigung“, sagte Lobo. Er ging an ihm vorbei. Das blonde Mädchen, mit dem er hatte schlafen wollen, stand in der Tür ihrer Kammer. Sie hatte sich ein Bettlaken um die Schultern geworfen und weinte leise. Lobo betrat die Kammer und zog sich an. Er hörte, wie mehrere Menschen die steile Treppe herauf eilten. Männerstimmen waren zu hören, dazwischen die Stimme einer ältlichen Frau. Es war die Besitzerin des Bordells. Lobo hatte bei ihr bezahlt. Bezahlt für nichts.
Lobo schnallte den Revolvergurt um. Er strich dem weinenden Mädchen über die Wange.
„Ich komme später wieder“, sagte er. „Ich habe noch fünf Dollar bei dir gut.“
Sie schluchzte und presste die Hände vor den Mund. Aus der Kammer der Ermordeten klang die schrille Stimme der Bordellwirtin. Das Klatschen von Schlägen war zu hören. Ein Mann schrie.
Ein junger Bursche, der mit den anderen die Treppe heraufgelaufen war, taumelte aus der Tür. Er lehnte sich mit kalkweißem Gesicht an die Wand des Ganges und übergab sich.
Lobo ging an ihm vorbei. Er sagte: „Nimm es nicht tragisch. Spätestens beim dritten Mal hat man sich daran gewöhnt.“
Er ging die Treppe hinunter und betrat die Bar des Bordells. Sie war leer bis auf den Keeper hinter der Theke. Auf den Tischen standen halb geleerte Gläser. Eine Flasche war umgefallen. Der Inhalt war ausgelaufen und hatte auf dem Fußboden eine bräunliche, scharf riechende Pfütze gebildet.
Nur wenige Lampen brannten. An den Fenstern hingen rote Samtvorhänge. Die Tapete war geblümt. Es gab ein paar dunkle Nischen.
Lobo setzte sich auf einen hohen Hocker an der Bar. „Whiskey“, sagte er.
Der Keeper schenkte ein. Sein Gesicht war ausdruckslos. Es schien ihn nicht im Geringsten zu interessieren, was oben vorgefallen war. Lobo redete nicht darüber. Er hatte einen bitteren Geschmack im Mund. Er trank, um ihn hinunterzuspülen.
*
Er hieß Ed Banteen. Sein Name war inzwischen bekannt. Er hatte das Bordell von Kitty Hemphil in San Pedro nicht zum ersten Mal aufgesucht.
Die Sonne ging unter, als sie ihn henkten. Die Abendsonne stand wie ein Feuerrad über der Steppe westlich der Stadt. Die Schatten des Abends waren längst eins mit der Dämmerung geworden, die sich zunehmend verdichtete.
Lobo stand abseits und schaute zu. Er lehnte an der rissigen, rauen Wand eines alten Frachtschuppens.
Die Bürger von San Pedro hatten sich versammelt, als zwei Männer Ed Banteen brachten. Sie hatten einen Baum ein Stück außerhalb der Stadt gewählt. Es war ein Cottonwoodbaum mit weit ausladendem Geäst, wie geschaffen für das, was sie vorhatten.
In einigem Abstand standen die Frauen aus dem Bordell von Kitty Hemphil. Einige weinten. Kitty Hemphil war dabei. Klein, rund wie eine Kugel, mit einem Gesicht, dessen Falten nicht einmal eine zolldicke Schminkschicht verbergen konnte. Sie weinte nicht, obwohl die Tote ihre Schwester gewesen war.
Als Ed Banteen gebracht wurde, herrschte eisiges Schweigen. Nur das leise Singen des Windes, der von der Wüste im Süden heranstrich, war noch zu hören.
Lobo sah eine Lassoschlinge durch die Luft wirbeln, sich über einen schenkelstarken Ast senken und weit geöffnet herunterfallen. Sie pendelte hin und her.
Banteen wurde zum Baum geführt. Er hatte Angst. Er wand sich in den Griffen der Männer, die ihn festhielten.
Er schrie: „Ich verlange eine Gerichtsverhandlung!“
Ein paar Männer lachten.
„Das Luder wollte mich betrügen!“, schrie Banteen.
Ein Mann trat vor, holte aus und schlug Banteen die geballte Rechte in das ungeschützte Gesicht. Banteen stieß einen gurgelnden Laut aus. Sein Kopf wurde in den Nacken geschleudert. Er blutete aus dem Mund, als er weitergeführt wurde. Seine Oberlippe schwoll an.
„Zieht ihn endlich hoch!“, rief jemand.
Lobo schaute sich um. Er fragte sich, warum der Marshal von San Pedro nicht auftauchte. Dann entdeckte er ihn unter der Menge. Er hatte seinen Stern abgenommen.
In diesem Moment legten sie Ed Banteen die Schlinge um. Banteen bäumte sich auf. Er schrie, bis er heiser war, und erwischte einen Mann mit einem Fußtritt in den Leib.
Da zogen sie ihn hoch.
Der Strick straffte sich. Ed Banteens Gebrüll brach ab. Ein durchdringendes Röcheln drang aus seinem weit geöffneten Mund.
Die Männer zurrten den Strick am Fuß des Baumes fest. Ed Banteen zappelte in der Schlinge. Sein Körper bewegte sich zuckend. Es dauerte Minuten, dann hing er still.
Die Sonne war untergegangen. Die Bürger hatten es plötzlich eilig, zurück in die Stadt zu gehen. Sie ließen Ed Banteen hängen.
Lobo zog seinen Tabaksbeutel aus der Hemdtasche. Er drehte sich eine Zigarette. Schweigend betrachtete er den Gehenkten, während er rauchte.
Der Tote erinnerte ihn an die Mörder seiner Eltern und seines Bruders. Weiße Skalpjäger, die er als halbes Kind gejagt hatte. Mann für Mann hatte er sie verfolgt und getötet, bis auf den Letzten. Bei dem war er zu spät gekommen. Er war vor seinen Augen gehenkt worden, gehenkt wie Ed Banteen.
Lobo warf die halb gerauchte Zigarette in den Staub und zertrat die Glut mit seinem Stiefelabsatz. Er wandte sich ab. Während er durch die dunkle Mainstreet von San Pedro ging, versuchte er, die düsteren Gedanken an die Vergangenheit zu vertreiben.
Es gelang ihm nicht. Der Anblick der toten Frau hatte ihn an seine Mutter erinnert. Die Skalpjäger hatten sie vergewaltigt, bevor sie sie umgebracht und ihr den Skalp abgerissen hatten.
Tavonah Gates, eine reinblütige Pima-Frau. Lobo konnte sie nicht vergessen, obwohl er es oft versucht hatte. Er hatte versucht, sich von allem zu lösen, was einmal sein Leben gewesen war. Seine Familie war ausgelöscht, es war so, als hätte es sie nie gegeben. Aber die Schatten der Vergangenheit holten ihn immer wieder ein.
Lobo hatte das Bordell von Kitty Hemphil erreicht. Er blieb stehen. Er zögerte. Dann betrat er den Vorbau und ging durch die Tür. Die Tische waren alle besetzt. Mehrere Mädchen standen an der Bar. Die blonde Frau war dabei, für die Lobo fünf Dollar bezahlt hatte.
Kitty Hemphil stand plötzlich vor ihm. Er sah sie im gedämpften Licht der wenigen Lampen und im dichten Zigarettendunst.
„Sind Sie der Mann, der das Schwein gefasst hat?“, fragte sie.
„Ja“, sagte Lobo.
„Sie sind Gast hier“, sagte Kitty. „Sie bezahlen keinen Cent.“
„Ich habe vorhin schon fünf Dollar bezahlt“, sagte Lobo.
„Kriegen Sie zurück“, sagte Kitty. „Sie sind mein Gast.“
„Danke“, sagte Lobo.
„Nehmen Sie sich ein Mädchen“, sagte Kitty.
Lobo ging an ihr vorbei zu der Blonden. Sie erkannte ihn wieder. Ihr Gesicht blieb ernst.
„Gehen wir auf dein Zimmer?“, fragte Lobo.
Sie nickte. Sie ging neben ihm zur Treppe. Er fragte sich, ob das die richtige Art war, die Vergangenheit zu vergessen, und er dachte bei sich, dass es zumindest nicht die schlechteste Art war.
Kapitel 2
Das Gesicht des Mannes war faltig und so schwarz wie Ebenholz. Seine schwieligen Hände hielten die Zügel, mit denen er das Gespannpferd vor seinem flachen Farmwagen lenkte.
Er saß nach vorn gebeugt auf dem Wagenbock. Ein verbeulter, speckiger Hut beschattete seine Stirn.
Der Mantel der Nacht klaffte im Osten auf. Morgennebel wallten über die Ebene, der Horizont schimmerte hell.
Der alte Schwarze schwenkte mit seinem Wagen auf die Overlandstraße nach San Pedro ein. Aus dem Nebel ragten vor ihm die Hütten der kleinen Stadt auf. Die Hufe des Gespannpferdes klapperten auf dem Weg, die Räder knarrten und zermalmten knirschend kleine Kiesel.
Er erreichte den Baum, an dem Ed Banteen hing. Überrascht hob er den Kopf, schob den Hut in den Nacken und zog die Zügel an.
Das Gespannpferd blieb stehen, der Wagen hielt an. Der alte Mann richtete sich auf dem Bock auf und blickte direkt in das Gesicht des Gehenkten, mit dem er sich jetzt auf gleicher Höhe befand.
Das Gesicht Banteens hatte sich bläulich verfärbt. Die Augen waren geschlossen, der Mund stand ein wenig offen.
Der Schwarze zögerte. Er spähte zur Stadt hinüber. Dort schlief noch alles. Ratlos zuckte er mit den Schultern und zog dann ein kurzes Messer aus einer Scheide am Gürtel. Er beugte sich vor, griff nach dem Körper Banteens, der sich erstaunlich warm anfühlte, zog ihn ein Stück zu sich herüber und zerschnitt mit einer schnellen Bewegung das Seil, an dem Banteen hing, etwa zehn Zoll oberhalb des Knotens.
Der Körper fiel sofort herunter. Der Alte konnte ihn gerade noch zu sich auf den Bock wuchten, bevor er zu Boden stürzte.
Er setzte Banteen auf die Bank. Der Oberkörper des Mörders stürzte zur Seite. Der Schwarze steckte das Messer ein und lockerte die Schlinge um den Hals von Banteen ein wenig. Er wollte den Mann zum Sargtischler bringen. Egal, was er getan hatte: Er hatte Anspruch auf ein anständiges Begräbnis.
Als er die Schlinge abnahm und ins Gras warf, sah er plötzlich, dass sich die Augenlider des Mannes zuckend bewegten. Er glaubte, sich getäuscht zu haben. Der Mann war tot. Es gab für ihn keinen Zweifel.
Er hatte keine Angst vor Toten. Er hatte in seinem Leben viel gesehen und getan. Vor dem Bürgerkrieg war er Sklave auf einer Tabakplantage in Kentucky gewesen. Dort hatte er bei Todesfällen die Leichen gewaschen.
Der alte Mann schob Ed Banteen ein Stück zur Seite, nahm seinen Platz auf dem Bock wieder ein und hob die Zügel.
In diesem Moment stöhnte der vermeintlich tote Mann.
Der Kutscher ließ vor Schreck die Zügel fallen. Er wandte den Kopf und starrte entsetzt in das Gesicht des Mannes neben sich, das immer noch bläulich schimmerte. Aber die Lippen bewegten sich leicht. Er atmete. Seine Augenlider zuckten wieder.
Dann drang ein schrilles Röcheln aus dem Mund Ed Banteens. Es schien, als fließe Leben in einen schon abgestorbenen Körper. Ein Zittern durchlief den Mann, als neue Kraft in seine Muskeln strömte. Die bläuliche Verfärbung des Gesichts machte einer wächsernen Blässe Platz.
Seine Arme begannen, sich schwach und unkontrolliert zu bewegen. Dann schlug er die Augen auf und musterte den Schwarzen neben sich, der Ed Banteen fassungslos anstarrte.
„Jesus Maria, bei allen heiligen Jungfrauen“, flüsterte der Alte.
Ed Banteen schien ebenfalls etwas sagen zu wollen. Seine Lippen bewegten sich, formten Worte. Aus seinem Mund kam aber nur ein heiseres Krächzen. Mit beiden Händen tastete er zu seinem Hals hoch, an dem der Strick einen deutlich sichtbaren Abdruck hinterlassen hatte.
Als Banteen den Kopf bewegte, verzerrte sich sein Gesicht vor Schmerzen. Trotzdem wurde sein Atem kräftiger.
„Gottverdammt“, flüsterte der Alte. „Gottverdammt!“
„Wasser“, krächzte Banteen. Sein Gesicht kriegte zusehends Farbe, die Blässe wich.
Mit zitternden Händen griff der alte Schwarze hinter sich und entkorkte eine Feldflasche. Er hielt sie Banteen an den Mund und ließ ihn trinken. Banteen verschluckte sich erst und erstickte fast doch noch. Dann trank er gierig und lehnte sich stöhnend zurück.
„Ich bringe Sie zum Doc, Mister“, sagte der Kutscher. „Sie brauchen einen Doc und dann einen Whiskey. Das ist es, was Sie brauchen, genau das.“
„Was ich brauche, weiß ich selbst“, sagte Banteen. Seine Stimme erschien ihm selbst fremd. Sie knarrte und klang kratzend und schwach. „Du kannst mich mal, Nigger.“
Der alte Mann musterte den anderen scheu. Er war Beleidigungen gewöhnt. Er hörte sie nicht mehr, selbst nicht von einem Mann, den er vom Strick geschnitten und ihm damit das Leben gerettet hatte.
„Ich wusste nicht, dass Sie noch leben, Mister.“
„Dann hättest du mich hängen lassen, wie?“ Banteen lag immer noch kraftlos auf der Bockbank. „Pech, ich lebe. Solange das Genick nicht gebrochen ist, kann man hoffen. Außerdem, sieh dir doch den Strick an, den diese Idioten genommen haben. Die Schlinge hat sich gar nicht richtig geschlossen.“
Banteen deutete verächtlich auf die abgeschnittene Schlinge, die neben dem Wagenweg im Gras lag. „Schlechter Hanf. Viel zu rau. Und dann der Knoten. Zum Kälbereinfangen gerade richtig, nicht, um jemanden aufzuhängen.“
Banteen versuchte zu lachen. Es gelang ihm nicht. Es hörte sich wie ein asthmatisches Husten an.
Er stemmte sich hoch. Unsicher stand er aufrecht auf dem Bock und schwankte.
„Ich fahre Sie in die Stadt, Mister“, sagte der alte Mann. Er griff nach den Zügeln.
Banteen fuhr herum. Er stützte sich an der Lehne des Bocks auf, sonst wäre er gefallen. Für einen Moment verlor er das Gleichgewicht und griff sich mit der linken Hand ins Genick, wo hörbar ein Wirbel knackte. Der Schmerz war so heftig, dass seine Augen einen Sekundenbruchteil später feucht schimmerten.
„Du wirst den Teufel tun!“, sagte Banteen. Seine Stimme klang gepresst. „Damit ich noch einmal gehenkt werde, diesmal aber richtig, wie?“
„Verzeihung, Mister.“
„Was willst du, du dämlicher schwarzer Hund?“ Banteen hatte sich wieder gefangen. „Glaubst du, dass ich dir dankbar bin, weil du mich heruntergeschnitten hast? Ich wäre schon nicht verreckt. Ich nicht. Mich muss man schon ein paarmal töten, bevor ich wirklich hinüber bin.“
„Dann steigen Sie ab, Mister“, sagte der alte Mann. In seine Augen trat Angst. „Ich will weiterfahren.“
„Du drehst sofort den Wagen um und fährst von der Stadt weg“, sagte Banteen.
„Ich muss einkaufen“, sagte der Schwarze.
„Du musst einen Scheißdreck“, sagte Banteen. „Wenn ich dir sage, dass du mich nach Westen fährst, dann wirst du gehorchen, du Drecksnigger. Oder hast du das Gehorchen nicht gelernt?“
Der Schwarze zog den Kopf ein und trieb das Pferd an. Er wendete den Wagen und lenkte ihn nach Westen. Hinter den Männern lichteten sich die Nebelschleier. Der helle Streifen am östlichen Horizont verbreitete sich zusehends.
„Fahr schneller!“, sagte Banteen. Er riss die Peitsche aus der Halterung neben dem Bock und ließ sie über dem Rücken des Pferdes knallen.
„Bitte, Sir“, sagte der Kutscher. „Der Wagen ist alt, Sir. Es ist mein einziger Wagen. Er bricht auseinander, wenn wir zu schnell fahren.“
„Was braucht ein Nigger wie du einen Wagen?“, sagte Banteen und ließ die Peitsche wieder knallen.
„Sir!“ Die Stimme des Schwarzen zitterte. „Bitte, Sir, ich fahre Sie, wohin Sie wollen, aber sagen Sie mir, was Sie vorhaben.“
„Hör auf zu reden und fahr!“, befahl Banteen.
Der Schwarze ließ die Zügel sinken und hielt den Wagen an. Seine Haltung straffte sich. In sein altes, faltiges Gesicht trat ein Ausdruck von Festigkeit. Er schien sich unvermittelt entschlossen zu haben, sich nicht mehr herumkommandieren zu lassen.
„Was ist los?“ Banteen drehte sich um und schaute zur Stadt zurück. San Pedro lag höchstens eine Meile entfernt in der Steppe. „Fahr weiter, oder soll ich dir mit der Peitsche dein altes Fell gerben?“
„Ich fahre Sie nicht weiter, Sir.“
„Du fährst nicht?“
„Nein, Sir.“
„Na gut“, sagte Banteen. Er saß steil aufgerichtet auf dem Bock. Sein Zustand besserte sich von Minute zu Minute. Ihm war bereits nicht mehr anzusehen, dass er gerade erst auf halbem Weg zu Hölle umgekehrt und ins Leben zurückgeholt worden war.
„Dann bleibst du eben hier“, sagte Banteen. „Dann lass dich hier verscharren!“
Er beugte sich vor und griff nach dem Messer des Schwarzen. Der alte Mann blickte Banteen aus erschrockenen geweiteten Augen an. Er rührte sich nicht vom Fleck, als Banteen das Messer hob und es ihm tief in die Brust rammte.
Als Banteen das Messer zurückzog, quoll Blut aus der Wunde und tränkte das Hemd des Mannes.
Die Zügel entglitten den schwieligen Händen. Unsicher und ängstlich tastete der Alte zur Brust und starrte erstaunt an sich hinunter, als ihm das warme, dunkle Blut zwischen den knotigen Fingern hindurchrann.
Banteens Augen waren kalt und ohne Gefühl. Er betrachtete das Messer einen Moment nachdenklich. Gerade ging die Sonne auf. Die Messerklinge blinkte matt, dort, wo sie nicht vom Blut verschmiert war.
Der alte Mann schien in sich zusammenzufallen. Sein Oberkörper sackte ein Stück nach vorn. Er atmete rasselnd. In Banteens grobknochigem, breitflächigem Gesicht zuckte kein Muskel, als er dem Alten das Messer in den Hals stieß.
Banteen erhob sich, ließ das Messer fallen und wischte seine blutigen Hände an seinen Hosenbeinen ab. Dann, nachdem er sich umgeschaut und festgestellt hatte, dass kein Mensch in der Nähe war, stieg er ab. Er schirrte das Gespannpferd aus und schwang sich auf den ungesattelten Hengst.
Er griff ins Kopfgeschirr und trieb das Tier an. Der Wagen mit dem toten Kutscher blieb in der Prärie zurück. Ein paar schmutzig graue Nebelfetzen trieben noch im leichten Wind. Die Sonne hing wie eine fruchtig-frische Orange am Horizont. Ed Banteen beugte sich auf dem Pferderücken vor, hämmerte dem Tier brutal die Absätze in die Weichen und sprengte über die Ebene auf die westlichen Hügel zu.
*
Lobo verließ den Mietstall, als die Sonne den Zenit erreichte. Die Mainstreet von San Pedro war menschenleer. Ein gelb-brauner Hund hastete mit einem Knochen im Maul aus einem Hinterhof über die staubige Straße und verkroch sich unter dem Vorbau eines Lagerhauses.
Der Himmel glich einem weißglühenden Hitzeschild. Die heiße Luft staute sich wie ein wabernder Brei unter den Vorbaudächern der Holzhütten. Der Wind aus der Wüste schien aus einem Ofenrohr zu kommen. Er brachte feine Staubkristalle mit, die sich an Häuserecken und in Hofeingängen zu kleinen Sandwirbeln vereinigten.
Lobo führte sein Pferd am Zügel. Es war ein grauer Morgan-Hengst, narbig, zäh und ausdauernd. Lobo bewegte sich mit lässigen, geschmeidigen Schritten durch die Straße. Er hatte den hochkronigen Hut tief in die Stirn gezogen. Die breite Krempe beschattete sein narbiges Gesicht.
Es war indianisch geschnitten, hager, mit tiefen Falten und hohen Wangenknochen. Dunkle Bartschatten bedeckten Kinn und Wangen. Er war noch keine fünfundzwanzig, wirkte aber älter. Seine Augen waren schmal und von kleinen Fältchen umgeben, vom vielen Blinzeln in Sonne und Wind. Am linken Kinnwinkel zeichnete ihn eine schmale Messernarbe, andere Narben, von Fausthieben und Tritten, waren in scharfen Falten verborgen.
Unter seinem Hut quoll volles, blauschwarzes Haar hervor und fiel bis auf die breiten, muskulösen Schultern.
Seine Haut hatte einen leichten Bronzeton und erinnerte am deutlichsten an seine indianischen Vorfahren.
Er trug einen Gürtel aus Büffelleder, der sich um seine schmalen Hüften spannte und rechts ein Holster mit einem schweren Army Colt hielt, auf dessen Nussbaumgriff noch schwach einige Stempel zu erkennen waren, die die Waffe als ehemaligen Armeerevolver auswiesen.
Links hing eine Messerscheide am Gürtel, aus der der Knochengriff eines Bowiemessers mit zehn Zoll langer Klinge ragte. Ein weiteres Messer, schmal, kurz, aber scharf genug, um Metall zu schneiden, trug er im rechten Stiefel. Im Scabbard am Sattel steckte ein wuchtiger Sharps-Karabiner Kaliber .52.
Lobo bewegte sich zum Stadtrand. Er hatte kein festes Ziel. Er wusste nicht, wohin er wollte. Er wusste nicht einmal, wo er das nächste Mal Gelegenheit erhalten würde, seinen ruhelosen Weg für eine kurze Rast zu unterbrechen. Er wurde nicht überall geduldet, nicht mit seiner Hautfarbe. Er erhielt nicht in jedem Saloon einen Whiskey, und nicht jeder Storekeeper verkaufte ihm Proviant.
Er musste selbst für das kleinste Stück Leben kämpfen. Er erhielt nichts geschenkt. Er hatte sich daran gewöhnt und lebte sein Leben, ohne zu klagen. Er dachte zuerst an sich selbst, weil sonst niemand an ihn dachte, er nahm keine Rücksicht auf andere, weil auch auf ihn niemand Rücksicht nahm. Er hatte keine Freunde, und er buhlte nicht um Anerkennung. Die Verachtung seiner Umwelt glitt von ihm ab, weil er die Weißen genauso verachtete für ihre Selbstherrlichkeit, für ihre Heuchelei, ihre doppelte Moral.
Er war hart geworden. Seit seine Eltern und sein Bruder ermordet worden waren, hatte er sich in einer Welt voller Hass und Feindschaft einen Platz erkämpfen müssen. Das alles hatte ihn geprägt. Es hatte ihn zu einem Mann gemacht, der sich nur auf sich selbst verließ, niemandem traute und nur das Recht des Stärkeren kannte.
Lobo passierte das Bordell von Kitty Hemphil. Er warf nur einen kurzen Blick auf die verwitterte Fassade. Die Vorhänge waren zugezogen.
Die Tür öffnete sich. Das blonde Mädchen, mit dem er während der Nacht zusammen gewesen war, trat heraus. Es hieß Francis.
„Kitty will mit dir sprechen“, sagte sie.
„Ich wollte weiterreiten“, sagte er.
„Es dauert nur ein paar Minuten“, sagte sie.
Er führte den Morgan zum Querholz vor der Veranda, ließ ihn hier stehen und trat auf den Vorbau.
„Es ist schade, dass du weiterreitest.“ Sie blickte an ihm vorbei. „Es war schön mit dir“, sagte sie. „Das sage ich nicht jedem. Es sind zu viele, weißt du. Die meisten vergesse ich, sowie sie die Tür hinter sich geschlossen haben, wenn ich mich nicht sogar vor ihnen ekle und sie nicht ansehe, wenn sie sich zu mir legen. Dich werde ich nicht vergessen, nicht so schnell.“
„Irgendwann vergisst man alles“, sagte er. „Du passt nicht hierher.“
„Vielleicht“, sagte sie. „Aber ich weiß nicht, was ich sonst tun soll in diesem Land.“
„Weggehen“, sagte er. Gleichzeitig wusste er, dass sie recht hatte. Es gab nicht viele Möglichkeiten für eine Frau, in diesem wilden Land zu überleben. Sie hatte es fast so schwer wie er.
„Wohin soll ich gehen?“, fragte sie. Sie schien keine Antwort zu erwarten. Sie wandte sich ab und betrat vor ihm das Haus. Sie hatte resigniert, und Lobo dachte, dass er genug eigene Sorgen hatte und sich nicht mit Francis‘ Problemen belasten konnte.
Kalter Zigarettenrauch hing in der Bar. Lobo sah den Keeper mit nacktem Oberkörper hinter der Theke stehen. Er polierte die Gläser. In seinem linken Mundwinkel hing eine Zigarette.
Francis führte Lobo zu einer geschickt getarnten Tür im Hintergrund der Bar. Sie blieb zurück, als Lobo die Tür öffnete und in den Raum dahinter trat. Sie schaute ihn traurig an.
Lobo schloss die Tür hinter sich und blieb stehen. Es dauerte einen Moment, bis seine Augen sich an das Zwielicht im Raum gewöhnt hatten. Die Vorhänge waren noch zugezogen. Die Luft in der Kammer war von einem schweren, süßlichen Parfümduft gesättigt.
„Ich bin froh, dass Sie gekommen sind“, sagte eine Stimme. Lobo wandte den Kopf und sah Kitty Hemphil in ihrem riesigen Himmelbett sitzen. Sie war jetzt nicht geschminkt und sah aus, als sei sie bei lebendigem Leib mumifiziert worden. Das graue Haar hing ihr strähnig um den Kopf. Sie trug ein blütenweißes, spitzenbesetztes Nachthemd und lehnte an einem wahren Kissenberg. Die kleinen fetten Hände lagen vor ihr auf der Bettdecke.
„Ich wollte gerade weg“, sagte Lobo.
„Sie haben gestern den Mörder meiner Schwester festgehalten.“
„Ich habe ihn niedergeschlagen.“
„Und wir haben ihn aufgehängt, richtig.“ Ihre Stimme klang kalt und geschäftsmäßig. Sie musterte ihn aus ihren runden Knopfaugen wie eine Schlange ihr Opfer.
„Sie wissen, was passiert ist?“
„Jemand hat ihn abgeschnitten“, sagte Lobo.
„Ist das alles?“
„Ja.“
„Noah Douglas hat ihn abgeschnitten“, sagte Kitty. Ihre Rechte glitt zum Nachttisch, auf dem eine Porzellanschale mit Gebäck stand. Sie griff nach einem herzförmigen Plätzchen und knabberte daran, während sie weitersprach.
„Noah Douglas ist ein Schwarzer. Ziemlich alt. Er hat eine Farm zehn Meilen südwestlich von San Pedro.“ Sie griff nach einem weiteren Plätzchen. „Hatte“, korrigierte sie sich. „Er hatte eine Farm. Jetzt ist er tot. Genau wie meine Schwester Joan. Banteen hat ihm fast den Kopf abgeschnitten.“
„Banteen?“
„Er lebt“, sagte sie. „Ich weiß, es ist kaum zu glauben, und als ich es hörte, habe ich es auch nicht geglaubt. Aber es ist so. Er hat das Hängen überlebt. Das gibt es. Banteen ist ein kräftiger Mann, ziemlich zäh. Aber das ist ja egal. Wichtig ist nur, dass er lebt. Der alte Douglas hat ihn in seiner Gutmütigkeit abgeschnitten. Banteen muss wieder zu Bewusstsein gekommen sein und hat nichts Eiligeres zu tun gehabt, als Douglas die Kehle durchzuschneiden und mit seinem Wagenpferd abzuhauen.“
„Was wollen Sie?“, fragte Lobo.
Das faltige Gesicht Kittys verzerrte sich zu einer Grimasse des Hasses. „Ich will ihn!“, sagte sie.
„Von mir?“
„Ja“, sagte sie. „Ich will, dass Sie ihn fangen, dass Sie ihn töten. Töten! Verstehen Sie? Er hat meine Schwester umgebracht. Er hat sie abgestochen wie ein Schwein. Er hat sie geschlachtet wie ein Stück Vieh. Er muss sterben!“
„Schreien Sie nicht so“, sagte Lobo. „Ich kann sehr gut hören. Was geht mich das alles an? Ich habe mit diesem Banteen nichts zu schaffen.“
„Sie wollen nicht?“
„Warum sollte ich?“
„Ich will Banteens Kopf“, sagte Kitty. Ihre Stimme klang jetzt wieder ruhig, hatte aber nichts von der Kälte und Schärfe verloren. „Er hat Joan fast den Kopf abgeschnitten. Ich will, dass Sie seinen ganz abschneiden und ihn dann herbringen. Ich gebe Ihnen Geld dafür.“
„Das ist etwas anderes“, sagte Lobo.
„Ich wusste, dass Sie es tun würden. Sie sind der Mann dazu. Sie haben ihn hier zusammengeschlagen, obwohl Sie keinen Revolver hatten und er auf Sie geschossen hat. Das hätte kein anderer geschafft. Keiner von denen, die ich kenne. Jeder andere hätte den Schwanz eingekniffen, wäre fortgelaufen oder hätte sich abknallen lassen. Sie sind hart, Sie sind stark, Sie können kämpfen. Ich kenne Männer wie Sie. Sie sind ein Wolf.“
„Wie viel?“, fragte Lobo. Er hatte keine Lust, sie länger reden zu hören. Die halbdunkle Kammer schien immer enger zu werden, die parfümgeschwängerte Luft wurde immer stickiger.
„Fünftausend“, sagte sie. Sie blickte ihn lauernd an. „Das ist ein Vermögen.“
„Fünftausend für Banteens Kopf“, sagte Lobo.
„Für seinen Kopf“, sagte Kitty. „Ich will seinen Kopf hier vor mir liegen sehen, vom Hals abgeschnitten.“
„Für fünftausend können Sie den ganzen Mann verlangen“, sagte Lobo.
„Ich will nur seinen Kopf“, sagte Kitty. „Töten Sie ihn! Töten Sie ihn zum zweiten Mal.“
„Geben Sie mir das Geld“, sagte Lobo.
Sie beugte sich zu Seite, zog eine Schublade des Nachttisches auf und holte ein Bündel Dollarnoten heraus. Sie hielt es ihm hin. Lobo griff danach.
„Tausend“, sagte sie. „Die Anzahlung. Den Rest kriegen Sie für den Kopf. Das ist eine große Anzahlung. Wenn Banteen Sie tötet, bin ich die tausend Dollar los, und Banteen lebt immer noch.“
„Ihr Risiko“, sagte Lobo. „Banteen wird mich nicht töten. Sie kriegen seinen Kopf. Die tausend Dollar sind gut angelegt.“
„Das hoffe ich“, sagte sie. „Er kann keinen sehr großen Vorsprung haben. Als der alte Douglas gefunden wurde, war er noch warm, und sein Wagenpferd ist eine alte Schindmähre.“
„Ich reite sofort“, sagte Lobo.
„Sie tun wohl alles für Geld?“, sagte sie.
„Das Geld interessiert mich nicht“, sagte er. „Ich habe kein persönliches Interesse an Banteen, deswegen würde ich ihn ohne das Geld nicht verfolgen. Wenn es nur darum ginge, Ihre Rache zu befriedigen, Madam, könnten Sie mir eine Million bieten, und ich würde nein sagen. Ich reite hinter Banteen her, weil er ein Frauenmörder ist, weil er vom gleichen Schlag ist wie die, die meine Mutter umgebracht haben. Ihr Geld zählt erst in zweiter Linie, verstehen Sie?“
„Nein“, sagte sie. „Mich interessiert nur, dass Sie ihn jagen. Warum ist mir egal. Sie haben Ihre Anzahlung. Jetzt verlieren Sie keine Zeit. Ich will seinen Kopf! Vergessen Sie das nur nicht! Bringen Sie mir Banteens Kopf. Töten Sie ihn zum zweiten Mal, Mister ...?
„Lobo”, sagte Lobo. „Lobo Gates. Aber das können Sie vergessen. Lobo genügt.“