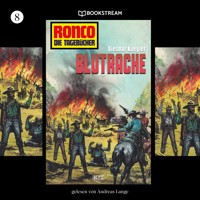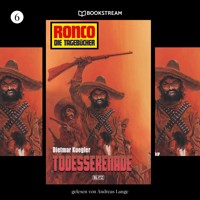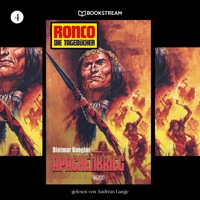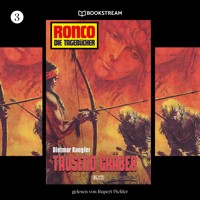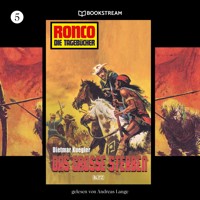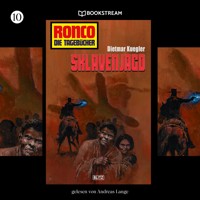Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ronco - Die Tagebücher (Historische Wildwest -Romane)
- Sprache: Deutsch
Mai 1857. Apachen-Krieger setzen das Pease-River-Tal in Flammen. Das Land färbt sich rot von Blut. In diesen Tagen entscheidet sich das Schicksal des zwölfjährigen Ronco. Er wird zum Gefangenen der Mimbreños, zum weißen Apachen. Dieser Band enthält folgende Romane: Verbrannte Erde (3) Der weiße Apache (4) Die Texte wurden vom Autor überarbeitet. Die Printausgabe umfasst 254 Buchseiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In dieser Reihe bisher erschienen
2701 Ich werde gejagt
2702 Der weiße Apache
Dietmar Kuegler
Der weiße Apache
Diese Reihe erscheint in der gedruckten Variante als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2019 BLITZ-VerlagRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogo: Mark FreierSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-151-9Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
Verbrannte Erde
25. September 1878.
Ich verstecke mich auf dem Dachboden der Braddock-Ranch, zehn Meilen westlich von Cow Spring. Gerade sind die Soldaten weggeritten, die hinter mir her waren. Sie haben mich bis hierher verfolgt. Wieder einmal. Ich habe Glück gehabt.
Draußen ist es dunkel und still. Der Rancher war vor ein paar Minuten hier und hat mir gesagt, dass ich die nächsten Tage hier oben bleiben soll. Das sei sicherer. Er hat recht. Er ist ein guter Mann.
Ich habe die Petroleumlampe, die an der Decke hängt, heruntergenommen und neben mich auf den Tisch gestellt. So habe ich Licht zum Schreiben.
Ich will meine Geschichte da weiterführen, wo ich vor etwa einem Monat mit dem Schreiben aufgehört habe. Ich habe vielleicht vieles geschildert, was für andere nicht interessant sein mag. Für mich aber ist jede Einzelheit wichtig, jede Kleinigkeit.
Ich habe bis jetzt den Teil meiner Kindheit aufgeschrieben, der zwar abenteuerlich, aber für das Land, in dem ich aufgewachsen bin, und für die Zeit, nicht ungewöhnlich war. Wenn ich nun weiterschreibe, werde ich zwangsläufig zu den Dingen kommen, die mein Leben damals völlig veränderten. Aber ich will der Reihe nach erzählen, um nichts auszulassen. Es war im Jahre 1857 ...
1.
Ich starrte auf den wackligen, zweirädrigen Handkarren, den Padre Hieronymus zog. Er war mit blauschwarzen Schlehen beladen, aus deren Saft in der Mission Medizin gebraut werden sollte. Ich trottete hinterher. Ich hatte den ganzen Nachmittag zusammen mit Padre Hieronymus Schlehen gepflückt, bis der Karren voll gewesen war. Eine stumpfsinnige Arbeit, wie mir schien.
Es ging auf den Abend zu. Ich war müde. Ich hatte mir diesen Tag anders vorgestellt. Es war ein schöner Tag gewesen. Zum ersten Mal in diesem Jahr hatte die Sonne richtig geschienen. Jetzt ging sie im Westen unter. Eine riesige, rote Kugel. Der Himmel hatte die Farbe einer kupfernen Kuppel.
Es war der 3. Mai des Jahres 1857. Es war der Tag, an dem Padre Hieronymus starb.
Er zog den Karren mit den Schlehen. Es strengte ihn an. Er hatte den mageren Oberkörper, um den das braune Mönchsgewand schlotterte, weit vorgebeugt und ging mit schleppenden Schritten. Er atmete abgehackt. Der Karren war sehr schwer. Wir hatten mehr Schlehen gefunden, als erwartet. Padre Ambrosius wollte daraus einen Schnaps brauen, der gut für den Magen sein sollte.
Ich dachte nur an eines: Bald würden wir zu Hause sein.
Bald würde Padre Hieronymus sterben. Ersaufen wie eine junge Katze.
Ich hatte einmal dabei zugesehen, wie Jerry Ricks einen Wurf junger Katzen ersäufte. Die große graue Katze auf der Ricks-Farm brachte die Jungen in einem Winkel der Scheune zur Welt. Jerry nahm ihr die Jungen weg und warf sie in einen mit Wasser gefüllten Eimer. Ich stand dabei. Ich sah nur, wie die erste krepierte, wie dieses unförmige, kleine Knäuel von undefinierbarer Farbe verzweifelt zu schwimmen versuchte, um sich zu retten. Jerry stieß es unter Wasser, bis es sich nicht mehr rührte. Da musste ich heulen, drehte mich um und lief davon. Das war zwei Jahre her. Als Padre Hieronymus starb, war ich auch dabei. Aber ich lief nicht davon.
Wir wanderten auf den Fluss zu. Wir sprachen nicht. Padre Hieronymus hätte gar nicht die Kraft zum Sprechen gehabt. Das Ziehen des Karrens nahm ihn zu sehr in Anspruch. So war das dünne Quietschen der Karrenräder auf den rostigen Zapfen der Achse das einzige Geräusch, das uns stetig begleitete.
Der Abendhimmel spiegelte sich im Fluss. Der Pease River war etwas breiter als gewöhnlich. Die Wellen schwappten über die Uferböschungen. Die Schmelzwasser aus den Bergen, die im Frühjahr zu Tal geflutet waren, brachten das Flussbett noch immer zum Überlaufen. Rechts und links vom Strom stand das Gras auf den Weiden schon wieder hoch. Die Blüten der zahllosen Sträucher an den Ufern leuchteten in allen Farben – Salbei, Mesquite, Kreosot und viele andere. Die schmale Brücke tauchte vor uns auf. Jetzt war es nicht mehr weit zur Mission. Eine Meile nur.
Ich verspürte plötzlich Hunger. Vielleicht hatte Padre Elfego Apfelkuchen gebacken.
Die Karrenräder rumpelten über die ausgetretenen Bohlen der Brücke, die sich im Laufe der Jahre an den Rändern hochgebogen hatten. Sie knarrten, und die Stützbalken ächzten unter unseren Schritten. Die Brücke musste erneuert werden. Die Farmer hatten es auf einer Versammlung in der Scheune der Longley-Farm im Frühjahr besprochen. Dann war es vergessen worden. Inzwischen hatte eine weitere Überschwemmung das Land heimgesucht, und die Brücke stand noch immer. Aber niemand kümmerte sich um sie.
Unter den von Wasser und Sonne ausgelaugten Planken gurgelte der Strom. Ich dachte, dass es vielleicht gut wäre, über das Geländer ins Wasser zu spucken und mir dabei etwas zu wünschen. Wenn man von der kleinen Brücke ins Wasser spuckte und sich etwas wünschte, ging es in Erfüllung. Das wussten wir im Pease River Valley alle.
Einmal hatte Jay Kingsley dem alten Bender, der ihn beim Äpfelklauen erwischt hatte, die Pest an den Hals gewünscht. Am nächsten Tag war eine Kuh auf der Bender-Farm krepiert, und in derselben Woche hatte sich Sam Bender den rechten Fuß gebrochen.
Ich überlegte, was ich mir wünschen sollte. Da blieb Padre Hieronymus stehen.
Ich nahm an, dass er Atem schöpfen wollte. Aber er drehte sich zur Seite, dass ich sein Gesicht sehen konnte. Er presste beide Fäuste an die Brust und beugte sich ein Stück vor. Sein Gesicht verzerrte sich und färbte sich dunkel. Seine Lippen zitterten und hatten auf einmal einen bläulichen Schimmer. Seine Augen glänzten fiebrig.
Da wusste ich Bescheid.
Wir standen mitten auf der Brücke, und Padre Hieronymus erlitt einen seiner Hustenanfälle. Er kriegte diese Anfälle zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten. Immer aber, wenn er sich überanstrengte.
Ich hatte es schon oft erlebt. Es war eine böse Sache. Ich hatte auf einmal ein flaues Gefühl im Magen. Ich fühlte mich verdammt hilflos. Ich stand da, mager, schmalschultrig, die Hände tief in den Taschen meiner geflickten Hose, einen Schritt hinter dem Karren mit den Schlehen, den Padre Hieronymus losgelassen hatte. Er war nach vorn gekippt. Das Deichselende lag auf den Brückenbohlen. Ein paar Schlehen waren aus dem Wagen gefallen.
Ich sah, wie der Padre litt. Ganz langsam krümmte er sich zusammen. Ohne einen Laut von sich zu geben. Er schwankte plötzlich. Sein magerer Körper wurde wie von einer unsichtbaren Faust geschüttelt. Dann stieg der Husten aus seiner Kehle auf. Quälend, gepresst, rasselnd. Der Padre wand sich in Krämpfen. Er hustete ohne Unterlass. Er konnte nicht einmal Luft holen. Ich dachte, sein Kopf würde platzen. Sein Husten klang unnatürlich laut in der Stille des Abends – und seltsam dumpf und hohl.
Er konnte sich kaum noch auf den Beinen halten. Der Schmerz presste ihn zusammen wie einen leeren Kartoffelsack.
Auf einmal sah ich Blut auf seinen Lippen. Es waren erst nur ein paar Flecke, dann rann ein dünner roter Faden zum linken Kinnwinkel hinunter. Mit den Ärmeln seines braunen Gewandes wischte er es ab. Und plötzlich war der Anfall vorbei.
Schweiß rann in dichten Bahnen über das eingefallene Gesicht von Padre Hieronymus. Er war bleich und rang nach Luft. Er zitterte am ganzen Körper. Langsam nur bekamen seine Wangen wieder etwas Farbe.
Ich stand noch immer still dabei. Das Entsetzen steckte mir in den Knochen. Ich sah, wie Padre Hieronymus sich langsam nach vorn beugte und sich schwer auf das Brückengeländer stützte. Keuchend lehnte er sich an die wetterzerfressenen Balken.
Es knackte.
Eisig durchfuhr mich der Schreck.
„Padre Hieronymus!“, rief ich.
Da brach das Geländer. Einfach so.
Der Padre verlor das Gleichgewicht. Er war zu schwach, um sich halten zu können. Er ruderte mit den Armen durch die Luft.
Ich sprang an dem Karren vorbei, warf mich nach vorn und kriegte noch einen Zipfel des braunen Gewandes zu fassen.
Aber ich war nicht stark genug. Ich konnte ihn nicht halten. Ich schrie auf. Tränen traten in meine Augen, als Padre Hieronymus kopfüber in den reißenden Fluss stürzte.
Er ging unter. Auf der Stelle. Er tauchte wieder auf. Sein Gesicht war schrecklich verzerrt. Er hatte Angst.
Angst ...
Ich hatte auch Angst. Wahnsinnige Angst.
Er wollte rufen. Wasser drang in seinen Mund. Eine Welle schwappte über seinen Kopf und riss die kleine braune Kappe fort, die die Mönche zu tragen pflegten.
Ich wusste, dass er nicht schwimmen konnte. Aber er ruderte wie verrückt mit beiden Armen. Er wurde von der starken Strömung gepackt. Sie hob ihn hoch und schleuderte ihn gegen einen der Brückenpfeiler. Er prallte mit der rechten Seite dagegen. Es krachte. Ich hörte es ganz deutlich. Ich hielt mir die Ohren zu.
Ich beugte mich vor und sah, dass sein Kopf an der rechten Seite aufgeschlagen war und blutete. Er versuchte, sich an dem schenkelstarken Holzpfeiler festzuklammern. Er schrie nicht. Er unternahm auch gar nicht den Versuch, zu rufen. Er kämpfte verbissen.
Ich warf mich flach auf die Brückenbohlen und streckte meine Arme aus. Ich war wie von Sinnen. Wellen, die gegen die Brückenpfeiler klatschten, spritzten mir ins Gesicht. Ich merkte es nicht.
Ich glaube, Padre Hieronymus versuchte, meine Arme zu greifen. Aber er schaffte es nicht. Stattdessen riss der Strom ihn plötzlich los und schwemmte ihn fort.
Er sackte nach unten weg, tauchte aber wieder auf.
Er wollte nicht sterben. Ich sah, wie er verzweifelt um sein Leben rang. Er verschwand unter der Brücke und tauchte auf der anderen Seite wieder auf, wo er weiter Flussabwärts mitgerissen wurde.
Ich sprang auf, lief über die Brücke und rannte neben dem Padre am Ufer her.
Er versuchte noch immer, mit den Armen irgendwie zu paddeln und dabei ans Ufer zu gelangen. Aber der Fluss war tief an dieser Stelle, die Ufer steil und die Strömung stark.
Seine Bewegungen wurden schwächer. Er tauchte immer öfter unter und immer seltener auf. Er trieb schnell ab.
Ich weinte jetzt und schrie seinen Namen.
Schließlich drehte ich mich um und rannte zurück. Ich lief wie noch nie in meinem Leben und stolperte oft. Ich fiel hin und schlug mir das rechte Knie auf. Aber ich blieb nicht stehen. Ich lief. Atemlos.
Die Mission tauchte vor mir auf. Lange Schatten reckten sich mir entgegen. Kein Mensch war auf dem Hof. Hinter den Fenstern brannten Lichter.
Ich hetzte durch die Dämmerung, stürmte über den Hof und riss die Tür des Hauses auf, in dem Padre Emanuel sein Arbeitszimmer hatte.
Er saß noch an seinem Schreibtisch und hob erstaunt den Kopf, als ich hereinpolterte. Ich brachte kein klares Wort heraus. Doch irgendwie musste er mich verstanden haben. Er stand auf und lief an mir vorbei. Ich folgte ihm. Als ich auf den Hof stürzte, eilten Padre Erastus und Padre Tenebro zum Stall. Sie zogen einen Eselskarren heraus.
Ich lief hinter ihnen her und wollte mitfahren. Sie wollten das nicht. Ich hörte, wie Padre Emanuel hinter mir rief. Und Padre Tenebro winkte heftig ab. Aber ich hielt nicht an. Da stoppten sie kurz, ließen mich aufsteigen und fuhren weiter.
Wir rollten an der Brücke vorbei. Der Karren mit den Schlehen stand einsam in der Dämmerung. Wir fuhren dicht am Fluss entlang. Padre Hieronymus war nirgends zu sehen.
Ich fühlte mich ganz elend und weinte die ganze Zeit still vor mich hin. Wir fuhren, so schnell wir konnten, und suchten das ganze Ufer ab. Wir rollten an der ehemaligen Wilkins-Farm vorbei. Aber erst eine knappe Meile weiter fanden wir Padre Hieronymus.
Es war am Wald, da, wo die Biber einen kleinen Damm gebaut hatten, an dem sich die wilde Strömung des Pease River brach.
Das Wasser schimmerte rotgolden. Es hatte den Glanz des Sonnenuntergangs eingefangen und trug den Schleier der heraufziehenden Nacht bereits in sich.
Hier lag Padre Hieronymus im Wasser. Bewegungslos. Mit dem Gesicht nach unten. Die Wellen bauschten sein braunes Gewand.
Ich sprang vom Wagen und wollte hinlaufen. Padre Erastus stand plötzlich hinter mir, hielt mich fest und schrie mich an. Es war das erste Mal, dass er das tat. Erschrocken blieb ich stehen.
Da gingen die Padres an mir vorbei. Sie wateten in den Fluss und zogen Padre Hieronymus aus dem Wasser.
Er war tot. Sein Gesicht schimmerte bläulich und wirkte aufgedunsen. Er war ertrunken.
Sie unternahmen trotzdem Wiederbelebungsversuche, umsonst natürlich. Warum handelt man in solch einer Situation so? So sinnlos.
Ich wünschte jetzt, ich wäre nicht mitgefahren.
Als sie Padre Hieronymus auf die Ladefläche des Wagens legten und sich um ihn herum auf dem Holz Pfützen bildeten, wandte ich mich ab.
Es kostete mich Überwindung, wieder auf den Wagen zu steigen. Während der Rückfahrt blickte ich starr nach vorn.
Padre Hieronymus war immer still und gut gewesen, bescheiden und erfüllt von einer echten Demut. Er hatte nie ein lautes Wort gesprochen. Er hatte nie geklagt, nie gejammert. Er hatte still gelitten. Er hatte sich an seinem Leben gefreut, trotz seiner schlimmen Krankheit, die ihn von Jahr zu Jahr mehr ausgezehrt hatte.
Dabei war es ihm hundserbärmlich gegangen. Er hatte vor Schmerzen häufig nicht aufrecht gehen können. Ab und zu hatte ich ihn nachts husten gehört. Seine Kammer lag nicht weit von der meinen.
Manchmal war ich aufgewacht, hatte gelauscht und gehört, wie er sich quälte. Aber er war damit stets allein fertig geworden. Er hatte nie jemanden um Hilfe gerufen. Er hatte niemandem zur Last fallen wollen.
Jetzt war er tot. Ersoffen wie eine junge Katze.
Es war zum Heulen. Und ich heulte. Padre Erastus legte mir die Rechte auf die schmalen Schultern. Ich merkte es nicht.
Wir erreichten die Mission. Es war schon dunkel. Die Mönche warteten auf uns. Sie hielten Fackeln und Petroleumlaternen in den Händen. Ich schaute nicht zu, wie Padre Hieronymus abgeladen und in der Kapelle aufgebahrt wurde. Ich lief in meine Kammer und warf mich aufs Bett.
In der Kapelle wurde die Glocke geläutet.
Ich kann meinen Gefühlszustand schlecht beschreiben. Ich fühlte mich innerlich zerrissen.
Am nächsten Tag hatten wir ein neues Grab in der Mission. Es waren nun schon fünf. Sie lagen alle im Schatten des Turms der Kapelle.
Ich hasste Gräber. Sie waren für mich Zeichen verlorener Hoffnung, Zeichen einer Endgültigkeit, der man hilflos ausgeliefert war.
2.
Ich ging nach der Beerdigung zur Danton-Farm. Ich hatte das Bedürfnis, mit jemandem zu sprechen. Damit fing das Unheil an.
Als ich auf den Hof lief, hörte ich die Stimme von Clay Wilkins, meinem Freund.
Aus einer weit geöffneten Stallluke flogen in regelmäßigen Abständen Mistfladen. Ich sah immer nur kurz die Zinken einer Gabel auftauchen, die dann wieder im Innern verschwand.
Von daher ertönte auch die Stimme. Clay sang Streets of Laredo. Nicht schön, aber laut.
Ich ging zur Stallluke, blieb vor dem angehäuften Mist stehen und rief Clays Namen.
Das Singen verstummte. Statt der Mistgabel erschien ein verschwitztes Gesicht. Eine unbezähmbare Haartolle hing in die pickelige Stirn. Clay Wilkins.
Er grinste breit, als er mich erkannte, und kroch durch die Luke nach draußen.
„Was ist los?“, fragte er. „Du siehst aus wie Maismehl mit Pisse.“
Er stand vor mir. Sein Oberkörper war nackt. Er war nicht ganz so mager wie ich. Er war ein Jahr älter und bekam an Schultern und Armen kräftige Muskeln, auf die er sehr stolz war. Er zog sein viel zu weites Hemd über.
„Padre Hieronymus ist tot“, sagte ich.
„Oh.“ Sein Grinsen verschwand. „Verteufelte Sache.“ Er steckte die Hände in die Taschen seiner verwaschenen, zu kurzen Hose.
„Wenn man es bedenkt – er war ja immer krank.“
„Er ist ertrunken“, sagte ich. „Das verdammte Brückengeländer ...“
Seltsamerweise verstand er sofort. „Er ist durch das Geländer gebrochen?“
Ich nickte.
„Die verdammte Brücke sollte schon seit Monaten repariert werden“, sagte er.
„Jetzt ist es auch egal“, sagte ich. „Jetzt ist Padre Hieronymus tot, und von einem neuen Geländer wird er auch nicht wieder lebendig.“
Clay war klug genug, zu schweigen. Ich hätte schon wieder losheulen können.
Wir schlenderten hinunter zu der großen, breiten Brücke über den Pease River, die Clays Vater noch gebaut hatte, kurz bevor er ermordet worden war.
Ein Stück weiter westlich sahen wir Bob Danton bei der Arbeit. Er war Clays Schwager und hatte nach dem Tod von Clays Eltern die Farm übernommen.
„Bob zieht Bewässerungsgräben“, sagte Clay.
„Das Land ist fruchtbar“, sagte ich. „Wozu Bewässerungsgräben?“
„Wir werden den besten und größten Mais der Gegend haben“, sagte Clay. „Bob wird ein paar Windräder aufstellen, die das Wasser in die Gräben pumpen.“
Ich schluckte meinen Kummer hinunter. Die Sache interessierte mich. Bisher hatte es kein Farmer für notwendig gehalten, Bewässerungsgräben anzulegen und Windräder aufzustellen.
Bob Danton stand bis zu den Knien im kalten Wasser. Er hatte die Hosenbeine hochgekrempelt. Ich sah, dass seine Knie vor Kälte bläulich schimmerten. Er hielt einen breiten Spaten in den Fäusten und stach damit handbreite Schollen von den Rändern des Grabenansatzes. Der Graben hatte bereits eine Länge von knapp zehn Yards und war etwa zwei Fuß breit. Eine dünne Erdschicht trennte ihn noch vom Pease River. Aber die Wellen des Flusses schwappten immer wieder über den schwachen Damm und hatten den Graben mit einer schmutzig grauen Schlammbrühe gefüllt.
„Padre Hieronymus ist tot“, sagte Clay. Ich schluckte. „Er ist ertrunken“, sagte Clay. „Er ist durch das Geländer der kleinen Brücke gebrochen.“
Ich schluckte abermals, sagte aber nichts. Bob schaute mich an. Er hatte kein besonders intelligentes Gesicht. Er gehörte wohl auch nicht zu den Klügsten dieser Erde. Aber er schien zu ahnen, was ich empfand. Vielleicht sah er es mir auch an.
Er stieg aus dem Graben, steckte den Spaten in den Boden und krempelte die Hosenbeine wieder hinunter. Dann schlüpfte er in die hochschäftigen Stiefel, die neben dem Graben standen. Er stopfte die Hosenbeine hinein.
„Bist du mit dem Ausmisten fertig?“, fragte er.
„Fast.“ Clay senkte den Kopf.
„Du kannst später weitermachen. Ihr könnt mir helfen.“
Bob ging mit keinem Wort auf die Todesnachricht ein. Aber als er an mir vorbeischritt, legte er seine schwielige Rechte auf meine Schulter. Ich verstand, was er damit ausdrücken wollte.
Wir gingen hinter Bob her. Im Gras unterhalb des Hügels, auf dem die Farmgebäude standen, lagen die Stangen und Balken für zwei Turmgerüste, an denen sich bald die Windräder drehen sollten.
Wir trugen die Einzelteile der Gerüste zum Graben hinüber. Bob hatte bereits abgesteckt, wo der erste Turm stehen sollte. Er hatte kleine Pflöcke so in den Boden gesteckt, dass sie ein Quadrat von zweieinhalb zu zweieinhalb Yards bildeten. Dünne Schnüre, die er von Pflock zu Pflock gespannt hatte, verdeutlichten das noch. Er hatte innerhalb dieses Quadrats die Grasschollen abgehoben.
„Habt ihr eigentlich noch Schule?“, fragte Bob.
„Morgen wieder“, sagte ich. Clay nickte lustlos. „Noch dreimal in der Woche, bis zum Ende dieses Monats. Im vorigen Jahr war um diese Zeit schon Schluss. Aber seit der Richter da ist ...“
Der Richter!
Nachdem die Texas Ranger 1854 bei uns im Pease River Valley in dem prächtigen Herrenhaus des ehemaligen Colonels Stephens ein mexikanisches Spionagenest ausgehoben hatten, hatte sich viel verändert.
Ein paar Monate später war ein würdiger, weißhaariger Mann gekommen. Er hatte das Haus von Colonel Stephens erworben, der – nachdem er zum Tode verurteilt und zu lebenslanger Haft begnadigt worden war – nun im Staatsgefängnis von Fort Worth schmachtete. Er hieß Abraham Collins und war einst Richter in Houston gewesen. Jetzt lebte er im Ruhestand.
Er hatte eine Frau, die in seinem Alter war. Sie trug stets riesige Hüte mit allerhand Federn und künstlichem Gemüse darauf. Sie war sehr zierlich und hatte das Gesicht einer freundlichen Spitzmaus.
Richter Collins dagegen war ein Mann, der Autorität verbreitete. Er hatte sich sofort am öffentlichen Leben im Pease River Valley beteiligt und eine ungeheure Energie entwickelt. Einmal im Monat hielt er auf seinem Hof Gerichtstag ab, wenn es etwas zu verhandeln gab. Außerdem war er auf den löblichen Gedanken verfallen, sich um die Missionsschule zu bemühen. Er hatte die Padres davon überzeugt, dass nicht nur Lesen und Schreiben zum Leben gehörten. Ein ordentlicher Geschichtsunterricht, so meinte er, bilde erst den richtigen Menschen.
Die Padres hatten sein Angebot angenommen. Seitdem versuchte Richter Collins einmal wöchentlich, uns zu richtigen Menschen zu erziehen. Er hatte auch dafür gesorgt, dass die Schulzeit nicht bereits im April, sondern erst Ende Mai unterbrochen wurde.
„Der Richter ist ein kluger Mann“, sagte Bob. „Wenn er es so für richtig hält.“
Ein Wagen näherte sich. Ein leichter Farmwagen mit kleiner Ladefläche. Pete Longley saß auf dem Bock, der älteste Sohn der Longley-Sippe.
Der Wagen hielt unweit des Flussufers. Pete Longley blieb auf dem Bock sitzen. Er beugte sich vor, nahm den Hut ab und kratzte sich auf dem Kopf.
„Hallo“, sagte er.
„Du kannst gleich absteigen und helfen“, sagte Bob.
Pete Longley grinste. Er zog ein Ledersäckchen aus der Tasche, holte Tabak heraus und dünnes, weißes Papier und drehte sich eine Zigarette.
„Ich fahre morgen nach Mulberry“, sagte er. „Soll ich dir was mitbringen?“
„Bist du deshalb gekommen?“
„Ja.“
„Nett von dir.“ Bob Danton trat an den Wagen, stützte die rechte Faust auf den Peitschenhalter seitlich vom Bock und ließ sich von Pete Longley eine Zigarette geben.
„Salz könnte ich brauchen“, sagte Bob. „Kaffee und Zucker auch, und etwas Tabak.“
„Ist das alles?“
„Denke schon.“
„Ich werd’s besorgen.“ Pete Longley schaute auf den Bewässerungsgraben. „Meinst du, dass sich das lohnt?“
„Sicher.“
„Der Boden ist gut“, sagte Pete Longley. „Er ist fett und fruchtbar. Du vergeudest Zeit. Die Felder müssen nicht extra bewässert werden.“
„Wir werden sehen.“
Pete Longley nahm die Zügel wieder hoch. Er schaute uns an. Clay und ich standen neben dem zerlegten Turmgerüst.
„Ihr beiden solltet in nächster Zeit etwas aufpassen und nicht zu weit von den Häusern weggehen, wenn ihr allein seid“, sagte er.
Wir schwiegen. Pete Longley nahm die Zigarette aus dem Mund. Er stülpte seinen Hut wieder auf. „Es sind wieder Indianer aufgetaucht“, sagte er.
„Indianer?“, sagte Clay. „Indianer gibt’s doch gar nicht mehr.“
„Seit hundert Jahren nicht mehr“, sagte ich.
Pete grinste. „Seit hundert Jahren? Schön wär’s.“ Er wandte sich an Bob. „Weiter südlich sollen sie eine Farm angegriffen haben, habe ich gehört. Es sieht nicht gut aus. Apachen.“ Er nickte. „Im Norden sollen die Comanchen viel Unheil anrichten.“ Er warf uns noch einen Blick zu. „Also gebt auf euch Acht.“
Dann schnalzte er mit der Zunge. Das Gespannpferd trabte an. Der Wagen rollte nach Osten davon und verschwand hinter dem Hügel, auf dem die Farm stand. Bob Danton rauchte seine Zigarette zu Ende. Danach kehrte er zu uns zurück, und wir arbeiteten weiter.
„Indianer“, sagte Clay. „So ein Unsinn.“
„Kein Unsinn“, sagte Bob. „Ihr geht nicht mehr allein in den Wald und auch sonst nirgendwohin. Verstanden?“
Wir nickten. Bob Danton krempelte die Hosenbeine wieder auf, zog die Stiefel aus und stieg in den Graben. Wir holten eine Schiebkarre von der Farm und fuhren den Lehm ab, den er ausschachtete.
Es war sehr heiß. Wir schwitzten bald. Aber die Arbeit bereitete Spaß.
Damals konnte noch keiner von uns ahnen, dass bald Krieg im Land herrschen würde.
Wir schoben die vollen Schiebkarren zum Fuß des Farmhügels. Bob Danton kam ein gutes Stück voran. Nach etwa einer Stunde war der schmale Graben schon fast dreizehn Yards lang.
Wir ruhten einen Moment aus. Clay schöpfte Wasser aus dem Fluss und trank es aus der hohlen Hand.
Da sah ich Rauch im Südosten. Ich sprang auf und streckte die Rechte aus.
Eine kräftige schwarze Wolke stieg in den sonnigen, blauen Himmel, vier bis fünf Meilen entfernt.
„Die Harrison-Farm“, sagte Clay. „Was kann da los sein?“
Bob Danton sprang mit einem Satz aus dem Graben. Er schlüpfte in seine Stiefel und lief an uns vorbei zur Farm. Wir folgten ihm. Inzwischen verstärkte sich die Rauchsäule.
Als wir den Hof erreichten, führte Bob Danton bereits ein Pferd aus dem Stall. Er hielt sein Sharps-Gewehr in der Linken und schwang sich auf den ungesattelten Rücken des Tieres.
„Ihr bleibt hier!“, rief er uns zu. Dann war er auch schon auf und davon.
„Komm“, sagte Clay. Er rannte in den Stall. Ich war immer hinter ihm. Clay holte das zweite Pferd aus der Box. Er führte es zu einem flachen Einspänner. Ich half ihm beim Einschirren, ohne ein Wort zu sagen. Ich dachte genauso wenig wie er daran, Bobs Anweisung zu befolgen.
Wir stiegen auf den Bock. Clay nahm die Zügel. Ich knallte mit der Peitsche. Wir fuhren durch das breite Stalltor auf den Hof hinaus. Lizzy, Bobs Frau, Clays Schwester, stand an der Tür des Farmhauses. Sie hielt eine blaue Leinenschürze in der Hand.
„Was ist denn los?“, rief sie.
Ich zeigte mit dem Peitschenstiel in die Richtung des Rauches. Dann rollten wir schon den Hügel hinunter. Das Pferd trabte immer schneller. Wir hörten Lizzy hinter uns rufen. Aber wir hielten nicht an. Wir schwenkten auf den schmalen Karrenweg ein, der von der Farm zur Overlandstraße führte, die das Tal von Norden nach Süden durchschnitt.
Der Rauch vor uns wurde immer dichter. Er nahm die Form eines riesigen, schwarzen Pilzes an. Ich richtete mich in voller Fahrt auf und spähte nach vorn.
Bob Danton war nirgends mehr zu sehen. Ich wunderte mich darüber. Ein Seitenblick zeigte mir, dass Clay das gleiche dachte. Ich setzte mich wieder und hielt mich fest, denn der Wagen schlingerte plötzlich. Das rechte Vorderrad war durch ein tiefes Schlagloch gefahren.
„Hoffentlich ist Bob nichts passiert“, sagte Clay.
Seine Stimme klang leise. Ich schaute ihn wieder an und bemerkte den feuchten Glanz in seinen Augen. Er sagte nichts mehr, schaute nur starr geradeaus und hielt die Zügel in seinen Händen. Wir schluckten den Staub, der unter den Hufen des Pferdes aufwirbelte, und schwiegen beide.
Wind kam plötzlich auf. Er zerteilte den Rauchpilz vor uns. Die steile, grauschwarze Säule senkte sich nach Norden.
Die Sonne stand ein gutes Stück westlich vom Zenit. Es war vielleicht vier Uhr am Nachmittag. Ich fragte mich, warum es so still war im Land. Den Rauch mussten alle gesehen haben.
Da tauchte vor uns auf dem Weg ein umgestürzter Wagen auf. Es war ein leichter Farmwagen. Er lag auf der Seite. Das Gespannpferd war daneben niedergestürzt. Die rechte Deichsel war abgebrochen, die linke hatte sich in den Leib des Pferdes gebohrt. Ein breitrandiger, speckiger Hut hing auf der hochkant stehenden Bocklehne.
Es war Pete Longleys Wagen.
Ich sprang auf und kurbelte an der Bremse. Clay stemmte sich in die Zügel. Das Pferd wieherte und schnaubte grell. Es wich ein Stück vom Weg ab. Quietschend pressten sich die Bremsbacken auf die Vorderräder. Fast wären wir auf das gestürzte Gefährt aufgeprallt. Nur knapp einen halben Yard entfernt rollten wir vorbei und blieben dann stehen. Die Flanken des Pferdes zitterten.
Ich sprang vom Bock. Clay blieb sitzen. Er hatte die Zügel im Schoss liegen und den Kopf gesenkt. Er weinte lautlos.
Ich lief zu dem umgestürzten Wagen. Das Pferd war tot. Fette Schmeißfliegen wimmelten über der hässlichen Wunde im Leib und hatten sich auf die weit aufgerissenen Augen gesetzt. Ringsherum war der Boden von Pferdehufen zertrampelt.
Neben dem Wagen entdeckte ich Pete Longley.
Er lag auf dem Rücken. Arme und Beine hatte er von sich gestreckt. Er war fast nackt. Sein Körper war von gefiederten Pfeilen gespickt. Es mussten etwa zwanzig oder dreißig sein. Er sah aus wie ein großer bunter Igel. Sein ganzer Körper war voller Blut. Kein Fleckchen weiße Haut war mehr zu erkennen. Ich erkannte sein Gesicht kaum wieder. In den Augen spiegelte sich der Himmel. Mund und Nase waren blutverkrustet. Auf seinem Kopf war ein handtellergroßer runder Fleck. Ihm war auch der Skalp genommen worden.
Mein Magen hob sich. Ich drehte mich schnell um. Ich schmeckte Magensäure im Mund. Mir wurde schwindlig. Ich tappte um das tote Pferd herum, ging zum Wagen zurück und stieg wieder auf den Bock.
„Fahr weiter“, sagte ich.
Clay hob die Zügel. Das Pferd trabte an.
„Wenn Bob was passiert ist“, sagte Clay. Seine Stimme zitterte. Dann schwieg er wieder.
„Pete Longley ist tot“, sagte ich.
Er reagierte nicht.
Der Wagen gewann rasch wieder an Tempo. Der Fahrtwind peitschte uns ins Gesicht. Ich schmeckte Staub zwischen meinen Zähnen.
Nach fast einer halben Stunde tauchte vor uns eine Farm auf – die Trümmer einer Farm. Die Rauchsäule war dünner geworden. Das Feuer war schon fast niedergebrannt.
Schwarzverkohlte Balken ragten wie drohende Finger in den Himmel. Von der Scheune standen nur noch die Grundmauern. Das Dach des Wohnhauses war eingestürzt, ebenso ein Teil des Westflügels.
Wir sahen einige menschliche Körper auf dem Hof liegen, über den der Wind die Rauchschwaden blies. Abseits stand ein sattelloses Pferd mit hängenden Zügeln. Bob Dantons Pferd.
Clay biss sich in die Unterlippe. Er weinte wieder still. Ich nahm ihm die Zügel aus den Händen und hielt den Wagen am Hofrand an.
Glühende Ascheteilchen wehten uns entgegen. Der scharfe Brandgeruch reizte unsere Schleimhäute. Ich hustete.
Wir stiegen ab. Im Wohnhaus kippte ein großer Balken um. Der Krach ließ uns zusammenzucken. Eine Wolke von Staub, Ruß und Asche wirbelte auf.
Über der runden steinernen Brunnenfassung, in der Mitte des Hofes, lag der halb nackte Körper eines toten Indianers.
„Ronco! Clay!“
Der Ruf ertönte von der Scheunenruine her. Wir fuhren herum. Da stand Bob Danton an einer Ecke, mit rußgeschwärztem Gesicht, in den Händen seine Sharps.
Clay schluchzte laut auf. Er rannte an mir vorbei und stolperte in Bobs Arme.
„Ihr seid verrückt“, sagte Bob. „Wie konntet ihr herkommen?“
Ich blickte in seine Augen. Ich sah Angst darin.
„Sie sind noch in der Nähe“, sagte er. Wir fragten nicht, wen er meinte.
„Wir haben Pete Longley gefunden“, sagte ich.
Bob lief an uns vorbei zu den Menschen, die auf dem Hof lagen und sich nicht rührten. Es waren Mrs. Harrison und Jess, der älteste Sohn. Abseits davon lagen Lilly und Mr. Harrison. Hermann, der jüngste Sohn der Harrisons, war nirgends zu sehen.
Bob kniete bei Mr. Harrison nieder. Er schaute uns an und schien meine Gedanken zu erraten.
„Sie haben ihn mitgenommen“, sagte er. Seine Stimme klang brüchig. „Ich habe gesehen, wie sie Hermann weggeschleppt haben. Er lebte ...“ Bob beugte sich über Mr. Harrison. Er legte seine Sharps auf den Boden, schob beide Arme unter den Körper des Farmers, hob ihn auf und trug ihn zum Wagen. Es war kein Lebenszeichen bei Mr. Harrison festzustellen. Aber Bob sagte, dass er lebe. Er legte ihn auf die Ladefläche des Wagens.
„Schnell!“, sagte er immer wieder. „Nur schnell weg von hier.“
Ich hob den Sharps-Karabiner auf und trug ihn hinter Bob her.
„Zur Mission“, sagte Bob. „Wir müssen zur Mission mit ihm.“
Wir kletterten auf den Wagen, während Bob sein Pferd bestieg. Ich übernahm die Zügel. Clay hockte sich neben Mr. Harrison und hielt ihn fest, damit er nicht vom Wagen rutschen konnte.
Hinter uns rauchten noch immer die Trümmer der Farm.
Ich lenkte den Wagen vom Hof und steuerte ihn nach Norden, auf den Fluss zu.
Hätten wir Zeit gehabt, wäre Clay und mir sicher schlecht geworden. Aber uns blieb keine Zeit dazu. Wir mussten handeln, als wenn wir erwachsen wären.
Als wir den Fahrweg zur Mission erreichten, sahen wir die Indianer. Dreihundert Yards westlich von uns tauchten sie auf einem Hügel auf. Einer hielt eine Lanze in der Faust, an dessen Spitze ein gut ein Yard langer Zopf aus Menschenhaaren befestigt war. Darin steckten Adlerfedern.
Indianer – die gibt’s doch gar nicht mehr! Seit hundert Jahren nicht mehr ...
Gott, was waren wir für Idioten!
„Schneller!“, schrie Bob, als er die Indianer sah. Er riss sich den Hut vom Kopf, beugte sich vor und schlug mit dem Hut auf unser Gespannpferd ein. „Fahrt um Himmels willen schneller.“
Die Indianer sprengten über den Hügel. Sie jagten in breiter Front auf den Fahrweg zu. Sie wollten uns den Weg abschneiden.
Bob schlug wie ein Verrückter auf sein Pferd ein, und ich hielt mit einer Hand die Zügel und schwenkte mit der anderen die Peitsche.
Die Indianer rückten näher. Es waren Apachen. Sie saßen wie angewachsen in den flachen Kissensätteln auf den Rücken ihrer gescheckten Ponys.
3.
Wir schafften es, an den Apachen vorbeizukommen, bevor sie den Weg erreichten. Schüsse krachten jetzt. Ein- oder zweimal spürte ich den Luftzug einer Kugel. Ein paar Mal machte es dumpf plopp, wenn Geschosse sich in die Seitenbracken des Wagens bohrten.
Plopp, plopp – Holz splitterte.
Die Indianer schwenkten hinter uns auf den Fahrweg ein. Die Jagd ging weiter. Aus den Augenwinkeln sah ich, dass Bob seine Sharps hochnahm, sich umdrehte und abdrückte.
Ich hörte Clay hinter mir triumphierend schreien, dass ein Apache aus dem Sattel gestürzt sei. Ich hatte keine Zeit, darauf zu achten. Ich musste zusehen, den dahinrasenden Wagen unter Kontrolle zu halten.
Ich hörte das Donnern der Hufe hinter uns. Die Apachen näherten sich. Ich hatte Angst, wahnsinnige Angst. Ich musste immerzu an Pete Longley denken, wie sie ihn zugerichtet hatten.
Ich hörte Clay schreien. Da holte ich mit der Peitsche aus und schlug dem Gespannpferd den dünnen Riemen genau zwischen die Ohren.
Es machte einen Satz nach vorn, der mich fast vom Bock schleuderte. Dann schoss es davon wie eine Rakete. Ich konnte die Zügel kaum noch halten.
Durch die aufwirbelnden Staubschleier sah ich plötzlich seitlich von uns zwei Reiter auftauchen – Weiße. Sie schossen. Wenig später erblickte ich die weißen Adobegebäude der Mission vor mir.
*
Schaumflocken hingen vor den Nüstern der Pferde. Ich taumelte, als ich auf dem Missionshof vom Bock stieg. Das Tor der Mission fiel zu. Ich sah noch in der Ferne die Apachen davonjagen.
Es war vorbei.
Padre Ambrosius stand vor mir. Groß, breit, dick und so herrlich beruhigend. Ich lehnte mich an ihn. Er hielt mich fest.
Ich sah, wie Padre Tenebro zusammen mit Bob Danton Kane Harrison vom Bock hob. Der Farmer war noch immer bewusstlos und wurde ins Gästehaus getragen.
Cyril Ricks und Frank Stoddard waren auch da. Sie waren die beiden Reiter gewesen, die seitlich von uns aufgetaucht waren und mit ihren Schüssen die Apachen vertrieben hatten. Auch sie hatte der Rauch der brennenden Harrison-Farm angelockt.
Wir gingen ins Haus.
Bob redete. Er redete ohne Unterlass. Schnell und viel und durcheinander. Er war nervös. Er erzählte von Pete Longleys Besuch und was er über die Indianer gesagt hatte.
Frank Stoddard sog an seiner Maiskolbenpfeife, obwohl sie kalt war. „Unten im Süden gibt es ein paar Kerle, die den Rothäuten Gewehre und Pulver verkaufen“, sagte er. „Ein Trader hat’s mir erzählt.“
„Die Apachen sind seit Monaten wieder auf dem Kriegspfad“, erklärte Cyril Ricks. „Es ist ein Wunder, dass wir nicht schon früher von ihnen gehört haben.“
„Was wird mit Pete Longleys Leiche?“, fragte Bob Danton.
„Wir müssen sie bergen“, sagte Frank Stoddard. „Sonst fressen ihn die Krähen.“
Sonst fressen ihn die Krähen ... Ich schauderte.
„Jemand muss die Armee benachrichtigen“, sagte Cyril Ricks. Er hatte nicht zugehört und stand am Fenster. Er starrte nach draußen. Als er sich eine Zigarette drehte, zitterten seine Hände.
„Morgen ist Schule“, sagte Bob Danton. „Und die Apachen reiten wieder.“
„Es ist zu spät, um den Unterricht abzublasen“, sagte Padre Erastus.
„Es wird schon gut gehen“, meinte Frank Stoddard. Er sog noch immer an seiner kalten Maiskolbenpfeife.
Bob Danton trank den Brandy, den Padre Erastus allen gebracht hatte, mit einem Schluck aus.
Clay sagte: „Wir müssen zu Lizzy.“