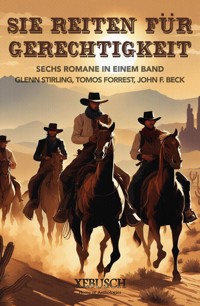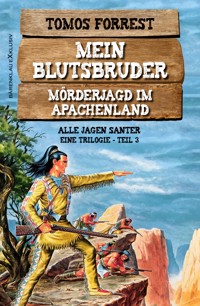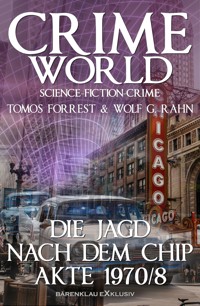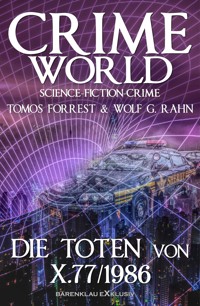3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Der »Weiße Mann« besiedelt immer mehr das Land der Apachen. Einige von ihnen ziehen jedoch eine Schneise des Todes hinter sich her, weil sie die Meinung vertreten, dass Indianer es nicht wert sind, am Leben gelassen zu werden: egal ob Mann, Frau oder Kind.
Intschu-tschuna, Häuptling der Mescalero, ruft die Apachen auf, sich zu einen und gemeinsam den Kampf gegen die Weißen aufzunehmen. Sein Sohn, der im besten Alter ist, ein großer Krieger zu werden, hat in diesen Zeiten schwere Prüfungen zu bestehen und so manche Aufgaben zu lösen – einige davon scheinen schier unlösbar zu sein …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Tomos Forrest
Mein Blutsbruder
Sohn des
Apachen-Häuptlings
Band 1 aus der Reihe
»Sohn des Apachen-Häuptlings«
Impressum
Neuauflage
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Kathrin Peschel nach einem Motiv von Klaus Dill, 2023
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Aus der Feder von Tomos Forrest sind weiterhin erhältlich oder befinden sich in Vorbereitung:
Das Buch
Der »Weiße Mann« besiedelt immer mehr das Land der Apachen. Einige von ihnen ziehen jedoch eine Schneise des Todes hinter sich her, weil sie die Meinung vertreten, dass Indianer es nicht wert sind, am Leben gelassen zu werden: egal ob Mann, Frau oder Kind.
Intschu-tschuna, Häuptling der Mescalero, ruft die Apachen auf, sich zu einen und gemeinsam den Kampf gegen die Weißen aufzunehmen. Sein Sohn, der im besten Alter ist, ein großer Krieger zu werden, hat in diesen Zeiten schwere Prüfungen zu bestehen und so manche Aufgaben zu lösen – einige davon scheinen schier unlösbar zu sein …
***
1. Kapitel
Aus dem Süden herauf ritt ein einsamer Mann auf einem Maulesel, der nur sehr langsam einen Huf vor den anderen setzte. Er hatte seinen schwarzen Überrock längst ausgezogen und zusammengerollt hinter den Sattel gebunden, die Ärmel seines vor langer Zeit einmal weißen Hemdes aufgekrempelt. Ein breitrandiger, schwarzer Hut von unbestimmter Form bedeckte seinen Kopf, unter dem seine dunklen Haare mit einigen markanten Silberfäden darin hervorquollen. Ein Blick in das Gesicht des Mannes, das von der Sonne gerötet und schweißbedeckt war, hätte an einem anderen Ort beim Betrachter ein Gefühl des Vertrauens erweckt, denn dieser Mann wirkte einfach freundlich und friedfertig. Jetzt aber war auch seine Stirn gerunzelt, seine sonst so treuherzig blickenden Augen rollten unruhig hin und her, ohne ein echtes Ziel zu finden.
Trotz der glühenden Hitze, die von dem harten Boden noch reflektiert wurde, hatte er lange Zeit mit sich gerungen, ob er auch das Kollar abnehmen und den Hemdkragen öffnen sollte. Immerhin war es das Zeichen seiner Würde, aber dann entschied sich Joshua Frings doch für mehr Erleichterung bei seinem anstrengenden Ritt durch die fast wüstenähnliche Gegend. Mittlerweile klebte dem Baptistenprediger das Hemd am Körper, und er hatte große Schwierigkeiten beim Öffnen der oberen Hemdknöpfe und dem Abknöpfen des Kollars.
Nirgendwo gab es hier Bäume oder Sträucher, die hoch genug waren, um einen Schatten zu werfen. Also stieg der Prediger kurzerhand aus dem Sattel, entledigte sich seiner überflüssigen Bekleidungsstücke und griff bei der Gelegenheit zu seiner Wasserflasche. Erschrocken stellte er fest, dass sie kaum noch zu einem Viertel gefüllt war. Behutsam ließ er das sonnengewärmte Wasser in den Mund laufen und behielt es dort so lange es ging. Anschließend benetzte er seine linke Innenhand und rieb dem Maulesel damit über das Maul, was das Tier mit einem dankbaren Schnauben quittierte.
»Halte durch, mein Freund, es kann nicht mehr weit bis zum Rancho sein. Dort findest du ausreichend Wasser und Gras und ich kann endlich meine müden Knochen ein wenig ausruhen.« Und mit einem Blick zur gleißenden Sonne murmelte er scheu: »Du legst deinem Diener schwere Prüfungen auf, oh Herr! Aber wer bin ich, dass ich hadern darf, nur weil du mich prüfst, Herr!« Wenig später saß er wieder im Sattel und folgte den tief eingedrückten Wagenspuren, die wohl von einer Karawane verursacht wurde. Frings war zwar schon seit Jahren in dieser Gegend unterwegs und bemühte sich, die Apachen zu bekehren, aber er war nicht in der Lage, das Alter einer Spur zu beurteilen. Plötzlich jedoch schreckte er aus seiner wieder eingenommenen, lethargischen Haltung hoch.
In der Hoffnung, schon etwas von dem Rancho und seinen ausgedehnten Weideflächen zu erkennen, hatte er wieder einmal den Blick über die hitzeflirrende Landschaft geworfen und dabei die Vögel bemerkt, die über einer bestimmten Stelle kreisten.
»Was ist das, Burro?«, sprach er seinen Maulesel mit dem Namen an, der im Spanischen entweder das Tier bezeichnet, oder aber auch für dumm oder auch stur steht. Frings und Burro waren seit langer Zeit ein unzertrennliches Gespann, und wenn der Geistliche den Namen beim Kauf vom Händler einfach übernommen hatte, so war das in diesem Falle durchaus liebevoll gemeint. Der Mann, der ihm das Tier in San Francisco verkauft hatte, war damit über Monate in den Bergen unterwegs und hatte – wie so viele andere – nach Gold gesucht. Als der Handel abgeschlossen war, der Esel sich aber nicht von der Stelle bewegen wollte, rief ihm der Mexikaner zu: »No seas burra – sei nicht albern«, und verpasste ihm dazu einen aufmunternden Schlag auf das Hinterteil, der tatsächlich den gewünschten Erfolg brachte. Der Prediger kannte nicht den Unterschied zwischen einem Maultier und einem Maulesel, denen man im Allgemeinen nachsagte, dass die aus einer Verbindung zwischen einem Hengst und einer Eselstute gezeugten Tiere als besonders störrisch galten. Letztlich war es ihm auch egal, denn das Tier zeigte sich durchaus willig und trug seinen neuen Besitzer klaglos auch lange Zeit durch die größte Hitze.
Jetzt aber weigerte es sich nach einer Weile, weiterzugehen.
»Du meinst also, wir sollten nicht zu den dunklen Gegenständen gehen, Burro? Aber das sind Aasvögel, die dort kreisen, und ich fürchte ein Unglück. Komm, sei ein gutes Tier, lass uns nachsehen, ob wir helfen können. Das ist schließlich Christenpflicht!«
Aber das Muli war nicht bereit, auch nur einen Schritt weiterzumachen.
Seufzend glitt Frings wieder aus dem Sattel, nahm seine Wasserflasche heraus, goss den letzten Rest in die Handinnenseite und ließ das Tier alles auflecken. Tatsächlich war es jetzt damit einverstanden, seinen Weg fortzusetzen. Doch der Prediger bereute nach kurzer Zeit bereits, dass er nicht einen großen Bogen um die schwarz verkohlten Reste der Wickiups gemacht hatte, die jetzt deutlich zu erkennen waren. Frings wusste nichts von den Menschen, die hier ihr karges Dasein fristeten, wo es kaum genügend Gras gab, um darauf ein paar Pferde weiden zu lassen. Bald erahnte der Prediger, was sich hier offenbar abgespielt hatte.
Hier war offensichtlich ein furchtbares Massaker geschehen, man hatte die einfachen Hütten, die sich hier eine kleine Gruppe der Apachen an einem fast ausgetrockneten Tümpel errichtete, niedergebrannt und wohl alle Menschen getötet. Frings fand vier tote Frauen zwischen den niedergebrannten Wickiups, drei Leichen von erwachsenen Männern lagen am Rand des Tümpels. Verzweifelte Blicke in die Umgebung gaben ihm keinerlei Aufschluss, aus welcher Richtung wohl die Feinde gekommen waren. Hier gab es nur die tiefen Wagenspuren, denen er nun schon seit Stunden gefolgt war. Aber für den Prediger war es unvorstellbar, dass eine Handelskarawane mit weißen Männern eine solche Tat begangen haben konnte.
Er überlegte kurz, ob er die Toten hier an Ort und Stelle beerdigen sollte, aber dazu hatte er nichts weiter als seine Hände zur Verfügung. Erst, als er einmal um das Wasserloch gegangen war, entdeckte er die Hufspur eines unbeschlagenen Pferdes, das sich von südwestlicher Richtung genähert hatte. Die Spuren waren dann durch die anderen für ihn nicht mehr erkennbar. Erst, als er einen größeren Kreis abschritt, entdeckte er sie erneut und vermutete, dass dieser Reiter zum Pueblo der Mescalero ritt, das sich nach seiner Einschätzung noch einen starken Tagesritt hinter dem Ranchero in einem Tal befand.
»Nein, Burro, wir können hier leider nichts mehr ausrichten und müssen zum Rancho. Der alte Sam wird mir gewiss mit seinen Männern helfen, die Toten würdig zu bestatten! Nur weiter, wir müssen heute den Rancho erreichen! Wer hat nur eine so abscheuliche Tat begangen? Doch nicht die Weißen – aber auch gewiss nicht ein einzelner Indianer!«
Damit stieg er wieder etwas steifbeinig in den Sattel und trieb den Maulesel erneut an.
2. Kapitel
Die Sonne brannte wie an jedem Tag auch jetzt wieder unbarmherzig von einem wolkenlosen, blauen Himmel auf die rötlich gefärbte, rissige Erde. Der Scout, der dem Treck ein paar Yards vorausritt, sah sich nach den anderen um. Unwillkürlich huschte ein Lächeln über sein von der Sonne verbranntes Gesicht, erreichte aber nicht seine dunklen Augen. Vielmehr musterte er die erschöpften Männer hinter sich mit einem derart feindseligen Blick, dass sein kaum noch verhohlener Hass offen zutage trat. Hätte ihn einer der Männer auf den Frachtwagen jetzt beobachtet, so wäre wohl auch das letzte Vertrauen rasch geschwunden, dass man in den Scout gesetzt hatte. Seine Zeit würde kommen, sicher schon in der kommenden Nacht.
Schon vor mehr als einer Stunde hatte sich der Wassermangel auf sehr unangenehme Weise bemerkbar gemacht. Die Wasserstelle, auf die sie am Vortag gestoßen waren, hatte nur noch sehr wenig Wasser – und das mussten sie sich auch noch erkämpfen.
Aber das letzte mitgeführte Fass, dass sie vor dem Aufbruch zu ihrer Reise quer durch das Land gefüllt hatten, zeigte eine unangenehm riechende, schmutzig-braune Brühe, als man es öffnete und eine Schöpfkelle hineintauchte. Entsetzte Laute wichen von den trockenen, aufgeplatzten Lippen der Männer, die sich dichter um den Scout drängten.
»Das konnte niemand ahnen!«, bemerkte ein hoch gewachsener Mann im staubbedeckten Anzug eines Städters. Er schien so gar nicht in diese Gegend zu passen, sondern passte viel eher an einen der zahlreichen Spielertische in den üblichen Spielerzelten in San Francisco oder den anderen Orten, die der Goldrausch in Kalifornien hervorbrachte. Männer seines Schlages suchten nicht nach dem Gold in der Erde und den Wasserläufen. Die Goldsucher brachten es ihnen freiwillig an die Spieltische, und die Spieler kannten genügend Tricks, um es ihnen abzunehmen.
Das lange, dunkelblonde Haar fiel dem Spieler bis auf die Schultern. Es war jetzt, genau wie bei allen Männern, vom Schweiß und Dreck verklebt und vertiefte den Eindruck, dass diese Gruppe schon seit längerer Zeit die letzte Ansiedlung verlassen haben musste.
»Es wäre die Aufgabe des Scouts gewesen, das Wasser zu kontrollieren, bevor wir in diese Wüste aufbrechen!«, warf ein anderer ein. Auch er war für diese Gegend vollkommen unpassend gekleidet. Er trug, wie der andere, einen Gehrock, hatte ihn aber längst auf einen der Wagen geworfen, und lief nur noch in seinem ehemals weißen Hemd umher. Im Hosenbund hatte er allerdings einen Revolver stecken, dessen Griff herausschaute. Sein Gesicht war, wie bei den anderen, sonnenverbrannt und staubbedeckt. Er mochte wohl bereits fünf Jahrzehnte mit einem wüsten Lebenswandel hinter sich haben, und scharfe Linien um Nase und Mund hatten sich gebildet, die seinem Gesicht etwas von der Physiognomie eines Geiers verliehen. Wie der Schnabel dieses Aasvogels ragte seine Nase weit hervor, und die kleinen, stechenden Augen trugen nicht sonderlich zur Milderung seines Ausdrucks bei.
Ein weiterer Mann trat aus der Gruppe an den Scout heran. Die Art, in der sich die beiden Männer musterten, ließ sogleich auf gegenseitige Ablehnung schließen.
Das war auch nicht weiter verwunderlich, denn der kleinwüchsige Señor Miguel Peralta bildete sich einiges auf seine Abstammung von den Spaniern ein, die vor langer Zeit in das Land kamen. Und damit war er ein geborener Feind des Scouts.
Morning Sun, wie sein englischer Name lautete, war ein Apache vom Stamm der Jicarilla und verachtete deshalb den kleinen Mexikaner. Aber sie waren auf den Scout angewiesen, denn kein anderer hatte sich bereiterklärt, die Frachtwagen mitten durch das Gebiet der kriegerischen Apachen zu führen.
»Es ist bis zum Rancho nicht mehr weit!«, vermeldete jetzt der Scout. »Dort finden wir Wasser und eine grüne Weide für die Tiere!«
»Möchte wissen, wo hier eine grüne Weide herkommen soll!«, antwortete der mit dem Raubvogelgesicht, Pete Thompson. »Diese verfluchte Rothaut führt uns doch absichtlich in die Irre. Ich wette, dass uns die anderen Rotfelle bei dem Rancho schon erwarten!«
»Glaube ich nicht, Pete. Sollten die Apachen von den niedergebrannten Wickiups erfahren haben, hätten sie sich wohl kaum zurückgehalten. Und Morning Sun hat uns ja versichert, dass sich niemand um diese Chi-he-nde-Apachen kümmern würde. Nach seiner Aussage gehören sie zu den Ausgestoßenen, und immerhin hat er selbst eine der Frauen erschossen. Nein, auch wenn ich den Burschen ebenfalls nicht leiden kann, müssen wir ihm vorerst noch vertrauten.«
Er dachte an die verächtliche Miene des Jicarilla, als sie die Wickiups erreichten und er sofort auf eine Frau schoss, die gerade zum Tümpel ging, um Wasser zu schöpfen. ›Das Volk der roten Farbe ist nichts wert, niemand will sie, niemand braucht sie. Sie sind Abschaum!‹, hatte der Scout verächtlich ausgerufen, und als der Schuss gefallen war und die anderen mit ihren Waffen in den Händen angelaufen kamen, hatte keiner von uns gezögert, auf sie zu schießen. Ein verfluchtes Pech nur, dass es kaum noch Wasser bei ihren elenden Hütten gab!, dachte Matt Bradley, drehte seinen Kopf und starrte plötzlich auf einen fernen Punkt im Westen, und nun wurden auch der Mexikaner und Thompson aufmerksam.
»Was ist, Texas? Hast du die Indsmen entdeckt?«, erkundigte sich sein Partner und reckte vergeblich den Hals, weil er nichts ausmachen konnte.
Man nannte den Großen nicht nach dem noch weitgehend unbesiedelten und als Verbrechernest bezeichneten Staat Texas, sondern nach dem Pokerspiel Texas Hold’em, bei dem ihm niemand etwas vormachen konnte. Diese Variante wird mit zweiundfünfzig Karten und bis zu zehn Spielern gespielt. Es geht um die höchste Punktzahl, eine Menge Bluff und darum, die anderen Spieler letztlich zur Aufgabe zu bewegen. Wer die unbewegliche Miene des Spielers kannte, sein absolutes Poker-Face, konnte oft nicht glauben, wie hoch Matt Bradley, genannt Texas, dabei bluffte. Doch von einem stoischen Gesichtsausdruck konnte jetzt nicht mehr die Rede sein. Ohne auf die Frage zu antworten, trieb er plötzlich sein schon sehr mattes Pferd an und schloss zu dem Scout auf.
»Ein Unwetter, habe ich Recht?«, erkundigte er sich und deutete nach Westen.
»Ja, aber wir werden vorher beim Rancho eintreffen!«, antwortete der Apache mit finsterer Miene.
»Aber nicht, wenn wir diesen Zockeltrab beibehalten!« Damit drehte er sich um und rief mit einer wahren Stentorstimme den anderen zu: »Da hinten braut sich ein Unwetter zusammen! Wenn wir uns nicht beeilen, werden wir nicht nur durchnässt werden, sondern können von Glück reden, wenn wir hier in der Wüste nicht plötzlich ertrinken! Vorwärts, gebt den Tieren die Peitsche, es geht um Leben und Tod!«
Ohne auf die anderen weiter zu achten, spornte er sein Pferd zu schnellster Laufart an, und das arme Tier schien auch schon die Gefahr zu spüren, die da an einem noch immer fast wolkenlosen Himmel herannahte.
»Texas! So warte doch auf mich! – Was zur Hölle ist in den Burschen gefahren, es ist doch überhaupt nichts zu sehen!«, schimpfte Thompson, während sein Pferd sich bemühte, zu den vorderen Reitern aufzuschließen.
»Ich war vor einem Jahr schon einmal in der Nähe und kenne die Anzeichen!«, rief ihm sein Partner zu. »Glaub mir oder lass es bleiben, Pete. Aber wir werden in Kürze wahre Sturzseen von oben ertragen müssen! Es geht jetzt um unser aller Überleben!«
Die Wagen mit den Gerätschaften, gezogen von Mulis, wirbelten dicke Staubwolken auf, die sich über eine Meile hinter dem Treck hinzog. Aber die Tiere waren alle am Ende ihrer Kräfte angelangt, jeden Augenblick konnte eines von ihnen stürzen und die anderen in ein heilloses Durcheinander stürzen.
Die Umgebung veränderte sich während des Parforceritts beträchtlich. Wo eben noch karger, ausgetrockneter Boden bis zum Horizont reichte, traten immer mehr einzelne Grasbüschel auf, wurden mehr und mehr und wuchsen schließlich zu einer zusammenhängenden Fläche mit bald darauf dunkelgrünem Gras zusammen. Der Scout hatte nicht zu viel versprochen, jetzt waren die ersten Fenzen erkennbar, hinter denen die Rinder und sogar ein paar Pferde weideten. Endlich kamen die niedrigen Gebäude des Rancho in Sichtweite, aber nun hatte auch das Unwetter die Menschen erreicht.
Wie auf Kommando öffnete der Himmel seine Schleusen, und die Wassermassen fielen vom Himmel, verwandelten die Landschaft innerhalb kürzester Zeit in einen trüben Teich. Das Wasser konnte selbst auf der grünen Fläche nicht rasch ablaufen, und endlich waren die ersten Reiter am Tor vorüber, preschten auf das Hauptgebäude zu und sprangen dort von ihren Pferden. Gerade hieb der Spieler, den sie Texas nannten, mit der Faust gegen die Eingangstür, als die auch schon aufgerissen wurde und ein schlohweißer Mann mit fast dunkelbraunem Gesicht, zerfurcht von vielen bestandenen Abenteuern, öffnete und dem Spieler eine doppelläufige Büchse vor die Brust hielt.
Mit einem knarrenden Geräusch öffneten sich zu beiden Seiten der massiven Holztür zwei schmale Schießscharten, und Matt Texas Bradley bemerkte, wie die dunklen Gewehrläufe herausgeschoben wurden und bedrohlich in ihre Richtung wiesen.