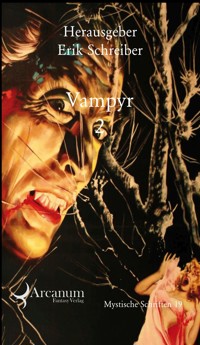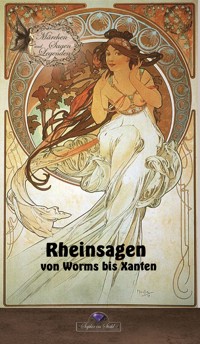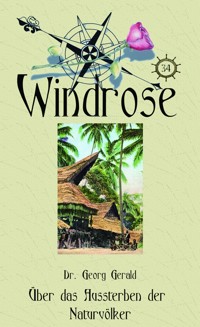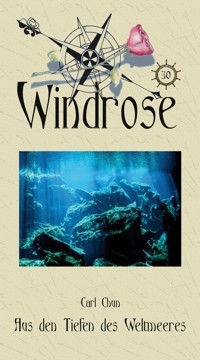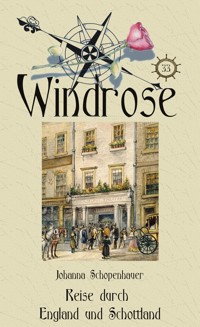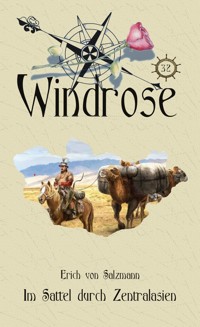4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Diese Sammlung ist die zweite, die innerhalb der Reihe "mystische Schriften" des Arcanum Fantasy Verlages erschien. Der erste Band nannte sich Fledermäuse. Dieses e-book, wie auch das Taschenbuch enthält folgende Kurzgeschichten. Inhaltsverzeichnis Meister Leonhard Das Grillenspiel Wie Dr. Hiob Paupersum seiner Tochter rote Rosen brachte Amadeus Knödlseder. Der unverbesserliche Lämmergeier J. H. Obereits Besuch bei den Zeit-egeln Die vier Mondbrüder
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Herausgeber
Erik Schreiber
Gustav Meyrink
noch mehr
Fledermäuse
Phantastische Geschichten
Arcanum Fantasy Verlag
e-book 225
Mystische Schriften 14
Gustav Meyrink - noch mehr Fledermäuse - Phantastische Geschichten
Erstveröffentlichung: Kurt Wolff Verlag (1916)
Neuauflage 01.02.2024
© Saphir im Stahl Verlag
Erik Schreiber
An der Laut 14
64404 Bickenbach
www.arcanum-fantasy-verlag.de
Titelbild: Simon Faulhaber
Vertrieb: neobooks
Herausgeber
Erik Schreiber
Gustav Meyrink
noch mehr
Fledermäuse
Phantastische Geschichten
Arcanum Fantasy Verlag
Inhaltsverzeichnis
Meister Leonhard
Das Grillenspiel
Wie Dr. Hiob Paupersum seiner Tochter rote Rosen brachte
Amadeus Knödlseder. Der unverbesserliche Lämmergeier
J. H. Obereits Besuch bei den Zeit-egeln
Die vier Mondbrüder
Biographie
Meister Leonhard
Unbeweglich sitzt Meister Leonhard in seinem gotischen Lehnstuhl und starrt mit weit offenen Augen gerade aus.
Der Flammenschein des lodernden Reisigfeuers in dem kleinen Herd flackert über sein härenes Gewand, aber der Glanz kann nicht haften bleiben an der Regungslosigkeit, die Meister Leonhard umgibt, gleitet ab von dem langen weißen Bart, dem gefurchten Gesicht und den Greisenhänden, die in ihrer Totenstille mit dem Braun und Gold der geschnitzten Armlehnen wie verwachsen sind.
Meister Leonhard hält seinen Blick zum Fenster gekehrt, vor dem mannshohe Schneehügel die ruinenhafte halbversunkene Schlosskapelle umgeben, in der er sitzt, aber im Geiste sieht er hinter sich die kahlen, engen, schmucklosen Wände, die ärmliche Lagerstätte und das Kruzifix über der wurmstichigen Tür – sieht den Wasserkrug, den Laib selbergebackenen Bucheckernbrotes und das Messer daneben mit dem gekerbten Beingriff in der Ecknische.
Er hört, wie draußen die Baumriesen krachen unter dem Frost, und sieht die Eiszapfen im grellen schneidenden Mondlicht herabfunkeln von den weißbeladenen Ästen. Er sieht seinen eigenen Schatten hinaus durch den Spitzbogen des Fensters fallen und mit den Silhouetten der Tannen auf dem glitzernden Schnee ein gespenstisches Spiel treiben, wenn das Feuer der Kienspäne im Ofen die Hälse reckt oder sich duckt, – dann wieder sieht er ihn plötzlich zusammengeschrumpft wie zu einer Bockgestalt auf schwarzblauem Thron und die Knäufe des Lehnstuhls als Teufelshörner über spitzigen Ohren.
Ein altes buckliges Weib aus dem Meiler, der stundenweit, jenseits der Moorheide tief unten im Tale liegt, humpelt mühsam durch den Wald herauf und zieht einen Handschlitten mit dürrem Holz; erschreckt glotzt sie in den blendenden Lichtschein und begreift nicht. Ihr Blick fällt auf den Teufelsschatten im Schnee – sie erfasst nicht, wo sie ist und dass sie vor der Kapelle steht, von der die Sage geht, der letzte gegen den Tod gefeite Spross eines fluchbeladenen Geschlechtes hause darin.
Voll Entsetzen schlägt sie das Kreuz und hastet mit wankenden Knien zurück in den Wald.
Meister Leonhard folgt ihr eine Weile im Geiste auf dem Weg, den sie nimmt. Er kommt an den brandschwarzen Trümmern des Schlosses vorüber, in dem seine Jugend verschüttet liegt, aber es berührt ihn nicht: Alles ist ihm Gegenwart, leidlos und klar wie ein Gebilde aus farbiger Luft. Er sieht sich als Kind unter einer jungen Birke mit bunten Kieseln spielen und sieht sich zu gleicher Zeit als Greis vor seinem Schatten sitzen.
Die Gestalt seiner Mutter taucht vor ihm auf mit den ewig zuckenden Gesichtszügen; alles an ihr bebt in beständiger Unruhe, nur die Haut ihrer Stirn ist unbeweglich, glatt wie Pergament und straff über den runden Schädel gespannt, der gleich einer fugenlosen Elfenbeinkugel das Gefängnis eines summenden Fliegenschwarms unsteter Gedanken zu sein scheint.
Er hört das ununterbrochene, keine Sekunde pausierende Rascheln ihres schwarzen seidenen Kleides, das wie das nervenaufpeitschende Schwirren von Millionen Insektenflügeln die Räume des Schlosses erfüllt, durch Boden- und Mauerritzen dringt und Mensch und Tier den Frieden raubt. Selbst die Dinge stehen unter dem Bann ihrer schmalen, immer befehlsbereiten Lippen, sind beständig wie auf dem Sprung und keines wagt sich heimisch zu fühlen. Sie kennt das Leben der Welt nur vom Hörensagen, über den Zweck des Daseins nachzuforschen, hält sie für überflüssig und für eine Ausrede der Faulheit; wenn nur von früh bis spät ein zweckloses ameisenhaftes Umherrennen im Hause herrscht, ein sinnwidriges Da- und Dorthinstellen von Gegenständen, ein fiebriges Sichmüdemachen bis in den Schlaf hinein und ein Zermürben ihrer Umgebung, glaubt sie ihre Pflicht gegen das Leben zu erfüllen. Nie kommt ein Gedanke in ihrem Hirn zu Ende, kaum entsteht er, wird er schon zu hastiger zweckloser Tat. Sie ist wie der vorwärtshaspelnde Sekundenmesser einer Uhr, der in seiner Zwergenhaftigkeit sich einbildet, dass die Welt ins Stocken gerät, wenn er nicht dreitausendsechshundertmal zwölfmal des Tages im Kreise herumzappelt, voll Ungeduld die Zeit in Staub zu zerfeilen, und es nicht erwarten kann, dass die gelassenen Stundenzeiger die langen Arme heben zum Schlag auf die Glocke.
Oft mitten in der Nacht reißt die Besessenheit sie aus dem Bette und sie weckt die Dienerschaft: Die Blumentöpfe, die in unabsehbaren Reihen auf den Fenstersimsen stehen, müssen sogleich begossen werden; sie ist sich nicht klar über das „warum“, es genügt: sie „müssen“ begossen werden. Niemand wagt ihr zu widersprechen, jeder wird stumm angesichts der Erfolglosigkeit, mit dem Schwert des Verstandes gegen ein Irrlicht kämpfen zu wollen.
Nie fängt eine Pflanze Wurzel, denn täglich setzt sie sie um, niemals lassen sich die Vögel auf dem Dach des Schlosses nieder, in Scharen durchkreuzen sie in dunklem Wandertrieb den Himmel, schwenken hierhin und dorthin, aufwärts und abwärts, bald zu Punkten werdend, bald breit und flach wie schwarze flatternde Hände.
Selbst in den Sonnenstrahlen ist ein ewiges Zittern, denn immer herrscht Wind und verweht ihr Licht mit jagenden Wolken; es geht ein Schwanken und Zausen von früh bis Abend, von Abend bis früh durch die Blätter und Zweige der Bäume, und nie kommen Früchte zur Reife, – schon der Mai bläst alle Blüten davon. Die Natur ringsum ist krank von der Unrast im Schlosse.
Meister Leonhard sieht sich vor seiner Rechentafel sitzen, er ist zwölf Jahre alt, drückt die Hände fest an die Ohren, um das Schlagen der Türen und das unablässige Treppauf Treppab der Mägde nicht zu hören und das Schrillen der Stimme seiner Mutter, – es nützt nichts: die Ziffern werden eine Herde wimmelnder boshafter winziger Kobolde, laufen ihm durchs Hirn, durch Nase, Mund und Augen aus und ein und machen sein Blut rasen und seine Haut brennen. Er versucht’s mit dem Lesen, – umsonst, die Buchstaben tanzen vor seinen Blicken: ein nicht zu fassender Mückenschwarm. – „Ob er seine Aufgabe denn immer noch nicht kann?“ schrecken ihn die Lippen der Mutter auf; sie wartet die Antwort nicht ab, ihre irren wasserblauen Augen suchen in allen Ecken, ob nicht irgendwo Staub liegt; Spinnweben, die nicht da sind, müssen mit Besen abgekehrt, Möbel umgestellt, hinaus und wieder hereingerückt, Schränke zerlegt und nachgesehen werden, damit sich keine Motten einnisten, man schraubt die Tischbeine ab und wieder an, Schubladen fliegen auf und zu, man hängt die Bilder um, reißt Nägel aus den Wänden und schlägt sie daneben ein, die Dinge geraten in Tobsucht, der Hammer fliegt vom Stiel, Leitersprossen brechen, Kalk bröckelt von der Decke, – der Maurer soll sofort kommen! –, Wischtücher klemmen sich ein, Nadeln fallen aus der Hand und verstecken sich in Dielenritzen, der Wachhund im Hof reißt sich los, kommt mit klirrender Kette herein und rennt die Stehuhr über den Haufen; der kleine Leonhard bohrt sich von neuem in sein Buch und beißt die Zähne zusammen, um einen Sinn zu erhaschen aus den schwarzen krummen Haken, die da drin hintereinander herlaufen, – er soll sich anderswo hinsetzen, der Sessel muss ausgeklopft werden; er lehnt sich, das Buch in der Hand, ans Fensterbrett, – das Fensterbrett muss gewaschen und weiß gestrichen werden; warum er denn überall im Weg ist? Und ob er seine Aufgabe jetzt endlich kann? Dann fegt sie hinaus; die Mägde müssen alles liegen und stehen lassen und rasch ihr nach und Schaufeln, Äxte und Stangen holen für den Fall, dass im Keller Ratten sind.
Das Fensterbrett ist halb gestrichen, von den Stühlen fehlen die Sitze und das Zimmer gleicht einem Trümmerhaufen; ein dumpfer grenzenloser Hass gegen die Mutter frisst sich in das Herz des Kindes. Jede Faser in ihm lechzt nach Ruhe; es sehnt die Nacht herbei, aber selbst der Schlaf bringt ihm die Stille nicht, wirre Träume halbieren seine Gedanken, so dass aus einem zwei werden, die einander jagend verfolgen und nie erreichen; die Muskeln können sich nicht entspannen, der ganze Körper ist in beständiger Abwehrstellung gegen blitzartig hereinbrechende Befehle, das oder jenes Sinnlose vollbringen zu sollen.
Die Spiele während des Tages im Garten entspringen nicht jugendlicher Lust, die Mutter ordnet sie an ohne Verständnis, wie alles, was sie tut, um sie in der nächsten Minute zu unterbrechen; ein längeres Beharren bei einer Sache erscheint ihr als Stillstand, gegen den sie glaubt, ankämpfen zu müssen wie gegen den Tod. Das Kind traut sich nicht vom Schlosse weg, bleibt immer in Hörweite, es fühlt: Es gibt kein Entrinnen, ein Schritt zu weit und schon fällt ein lautes Wort aus den offenen Fenstern herab und hemmt den Fuß.
Die kleine Sabine, ein Bauernmädchen, das unten beim Gesinde wohnt und ein Jahr jünger ist als er, sieht Leonhard nur von weitem, und gelingt es ihnen, einmal für kurze Minuten zusammenzukommen, reden sie in hastigen abgerissenen Sätzen, so wie Leute, die von sich begegnenden Schiffen einander eilige Worte zurufen.
Der alte Graf, Leonhards Vater, ist lahm auf beiden Füßen, er sitzt den ganzen Tag im Rollstuhl in seinem Bibliothekszimmer, stets im Begriffe zu lesen; aber auch hier ist keine Ruhe, stündlich wühlen die nervösen Hände der Mutter in den Büchern, stauben sie ab und schlagen sie mit den Deckeln aneinander, Merkzeichen flattern auf den Boden, Bände, die heute hier stehen, stehen morgen hoch oben auf den Borden oder türmen sich zu Bergen, wenn plötzlich die Tapeten hinter den Gestellen mit Brot oder Bürsten abgerieben werden sollen. Und ist die Gräfin für eine Zeit in den andern Räumen des Schlosses, so steigert sich nur die Qual des geistigen Wirrwarrs durch das nagende Gefühl der Erwartung, dass sie jeden Augenblick unversehens zurückkommen kann.
Abends, wenn die Kerzen brennen, schleicht sich der kleine Leonhard zu seinem Vater, um ihm Gesellschaft zu leisten, aber es kommt zu keinem Gespräch; wie eine Glaswand, durch die hindurch eine Verständigung unmöglich ist, steht es zwischen ihnen; zuweilen öffnet der Alte, als fasse er gewaltsam den Entschluss, seinem Kinde etwas Wichtiges, Einschneidendes zu sagen, mit einem erregten Vorneigen des Gesichtes den Mund, aber immer bleiben ihm die Worte in der Kehle stecken, er schließt die Lippen wieder, fährt nur stumm und zärtlich mit der Hand über die glühheiße Stirne des Knaben, aber seine Blicke flackern dabei zur Türe hin, die jeden Augenblick eine Störung bringen kann.
Dumpf ahnt das Kind, was in der alten Brust vorgeht: Dass es Übervollsein des Herzens und nicht Leere ist, die die Zunge seines Vaters stumm macht, und wieder steigt ihm der Hass gegen die Mutter bitter zum Halse hinauf, die es in Gedanken mit den tiefen Furchen und dem verstörten Ausdruck des Greisengesichtes in den Kissen des Rollstuhls in unklare Verbindung bringt; ein leiser Wunsch, man möge eines Morgens die Mutter tot im Bette finden, wird in ihm wach, und zu der Folter beständiger innerer Unruhe treten die Qualen eines höllischen Wartens, – es belauert im Spiegel ihre Züge, ob sich keine Spur von Krankheit in ihnen zeigt, beobachtet ihren Gang voll Hoffnung, die Zeichen beginnender Müdigkeit zu entdecken. Aber eine unerschütterliche Gesundheit belebt die Frau, sie kennt kein Schwachsein, scheint immer neue Kraft zu bekommen, je mehr die Menschen in ihrer Nähe siech und schlaff werden.
Von Sabine und der Dienerschaft erfährt Leonhard, dass sein Vater ein Philosoph ist, ein Weiser, und dass in den vielen Büchern lauter Weisheit steht, und er fasst den kindlichen Entschluss, die Weisheit zu erringen, – vielleicht fällt dann die unsichtbare Schranke, die ihn von seinem Vater trennt, und die Furchen werden wieder glatt, das gramvolle Greisengesicht wieder jung.
Aber niemand kann ihm sagen, was Weisheit ist, und die pathetischen Worte des Geistlichen, an den er sich wendet: „Die Furcht des Herrn, das ist Weisheit“, machen ihn vollends verwirrt.
Dass es die Mutter nicht weiß, steht felsenfest bei ihm, und langsam dämmert ihm daraus die Erkenntnis, dass alles, was sie tut und denkt, das Gegenteil von Weisheit sein muss.
Er fasst sich ein Herz und fragt seinen Vater, als sie einen Augenblick allein sind, was Weisheit ist, – unvermittelt, abgerissen, wie ein Mensch, der einen Hilferuf ausstößt; er sieht, wie die Muskeln in dem bartlosen Gesicht seines Vaters arbeiten vor Anstrengung die richtigen Worte zu finden, die einem wissbegierigen Kindesverstand angepasst sind, – ihm selbst zerspringt der Kopf fast vor krampfhaftem Bemühen, den Sinn der Rede zu begreifen.
Er fühlt genau, warum die Sätze so hastig und abgebrochen aus dem zahnlosen Munde kommen, – dass es wieder die Angst vor Störung durch die Mutter ist, die Scheu, dass heilige Samenkörner entweiht werden könnten, wenn sie der zersetzende nüchterne Hauch trifft, den seine Mutter ausströmt, – dass sie zum Giftkraut werden können, falls er sie missversteht.
All seine Mühe, zu erfassen, ist umsonst, schon hört er laute eilige Schritte draußen auf dem Gang, die schrillen abgehackten Befehle und das entsetzliche Rascheln des schwarzen, seidenen Kleides. Die Worte seines Vaters werden schneller und schneller, er will sie auffangen, um sie sich zu merken und später darüber nachzudenken, hascht nach ihnen, wie nach schwirrenden Messern, – sie entgleiten ihm, lassen blutende Schnittwunden zurück.
Die atemlosen Sätze: „schon die Sehnsucht nach Weisheit ist Weisheit“, – „ringe nach einem festen Punkt in dir, dem die Außenwelt nichts anhaben kann, mein Kind“, – „sieh alles, was geschieht, wie ein gemaltes lebloses Bild, an und lass dich davon nicht berühren“, – bohren sich in sein Herz ein, aber sie haben eine Maske vor dem Gesicht, die er nicht zu durchdringen vermag.
Er will weiter fragen, die Tür springt auf, ein letztes Wort: „Lass die Zeit an dir ablaufen wie Wasser“ weht an seinem Ohr vorüber, die Gräfin rast herein, ein Kübel fällt über die Schwelle, schmutzige Flut ergießt sich über die Fliesen. „Steh nicht im Weg! Mach’ dich nützlich!“ gellt es ihm nach, wie er voll Verzweiflung die Treppen hinunterläuft in sein Zimmer.
Das Bild der Kindheit erlischt, und Meister Leonhard sieht wieder den weißen Forst im Mondschein vor seinem Kapellenfenster, – nicht schärfer und nicht schwächer als die Szenen aus seiner Jugend: Vor seinem starren kristallenen Geist ist Wirklichkeit und Erinnerung gleich leblos und gleich lebendig.
Ein Fuchs trabt vorüber, langgestreckt, ohne Laut; der Schnee staubt glitzrig auf, wo sein buschiger Schweif den Boden streift, die Augen leuchten grün aus dem Dunkel der Stämme, verschwinden im Dickicht.
Hagere Gestalten in ärmlicher Kleidung, Gesichter, ausdrucksarm und nichtssagend, verschieden durch das Alter und doch einander so seltsam ähnlich, erstehen vor Meister Leonhard; er hört ihre Namen flüsternd im Ohr, gleichgültige alltägliche Namen, die kaum ein Mittel sind, ihre Träger zu unterscheiden. Er erkennt sie wieder als seine Hauslehrer, die kommen und nach einem Monat gehen, – nie ist seine Mutter mit ihnen zufrieden, entlässt einen nach dem andern, weiß keinen Grund dafür und sucht auch keinen; wenn sie nur da sind und gleich wieder fort wie Blasen in brodelndem Wasser. Leonhard ist ein Jüngling mit keimendem Flaum auf der Lippe und bereits so groß wie seine Mutter. Wenn er ihr gegenübersteht, sind seine Augen auf gleicher Höhe wie die ihrigen, aber immer muss er wegschauen, wagt den Versuch nicht, zu dem es ihn beständig reizt und stachelt: ihren leeren fahrigen Blick zu bannen und den tödlichen Hass hineinzusengen, den er gegen sie empfindet; jedes Mal würgt er es herunter, fühlt, dass der Speichel in seinem Munde bitter wie Galle wird und sein Blut vergiftet.
Er sucht und scharrt in seinem Innern und kann doch die Ursache nicht finden, die ihn so ohnmächtig macht gegen diese Frau mit ihrem unsteten fledermaushaften Zickzackflug.
Ein Chaos von Begriffen dreht sich in seinem Kopf wie ein rasendes Rad, jeder Herzschlag schwemmt neues Trümmerwerk halbfertiger Gedanken in sein Hirn und schwemmt es wieder weg.
Pläne, die keine sind, Ideen, die sich selbst widerlegen, Wünsche ohne Ziel, blinde heißhungrige Begierden, sich drängend und aneinander zerschellend, tauchen empor aus den Wirbeln der Tiefe, die sie sofort wieder einsaugt; Schreie ersticken in der Brust und können nicht an die Oberfläche.
Eine wilde heulende Verzweiflung ergreift Besitz von Leonhard, steigert sich von Tag zu Tag; in jedem Winkel erscheint ihm gespenstig das verhasste Gesicht seiner Mutter; aus den Büchern, wenn er sie aufschlägt, springt es ihm schreckhaft entgegen; er traut sich nicht umzublättern aus Angst, es von neuem zu sehen, wagt nicht sich umzudrehen, dass es nicht leibhaftig hinter ihm stehe: Jeder Schatten gerinnt in die gefürchteten Züge, der eigene Atem rauscht wie das schwarze seidene Kleid.
Seine Sinne sind wund und empfindlich wie bloßliegende Nerven; wenn er im Bette liegt, weiß er nicht, ob er träumt oder wacht, und übermannt ihn endlich der Schlaf, wächst aus dem Boden ihre Gestalt im Hemde, weckt ihn und schrillt ihn an: Leonhard, schläfst du schon?
Ein neues, seltsam heißes Gefühl wirft ihn hin und her, beklemmt ihm die Brust, verfolgt ihn und treibt ihn, die Nähe Sabines zu suchen, ohne dass er sich klar wird, was er von ihr will; sie ist erwachsen und trägt Röcke bis zum Knöchel, das Rascheln ihres Kleides erregt ihn noch mehr als das seiner Mutter.
Mit seinem Vater ist keine Verständigung mehr möglich: tiefe Nacht umfängt seinen Geist; in regelmäßigen Zwischenräumen dringt das Stöhnen des Greises grauenhaft durch die Hetzjagd im Hause, Stunde für Stunde waschen sie sein Gesicht mit Essig, schieben seinen Sessel dahin und dorthin, quälen den Sterbenden zu Tode.
Leonhard wühlt sich mit dem Kopf in die Kissen, um nicht zu hören, – ein Diener zupft ihn am Ärmel: „Um Gotteswillen schnell, schnell, mit dem alten Herrn Grafen geht’s zu Ende“. Leonhard springt auf, begreift nicht, wo er ist und dass die Sonne scheint, und wieso es nicht finstere Nacht wird, wenn sein Vater stirbt; er taumelt, sagt sich mit steifen Lippen vor, dass er das alles nur träumt, läuft hinüber ins Krankenzimmer; nasse Handtücher hängen in Reihen zum Trocknen an Wäscheschnüren quer durch den Raum, Körbe versperren den Weg, der Wind bläst durch die offenen Fenster herein und bauscht die weiße Leinwand, – ein Röcheln irgendwoher aus der Ecke.
Leonhard reißt die Stricke herab, dass die Wäsche nass auf den Boden klatscht, schleudert alles beiseite, kämpft sich hin zu den brechenden Augen, die ihm aus dem Rollstuhl, als der letzte Vorhang fällt, blind und gläsern entgegenstarren, stürzt auf die Knie, drückt die teilnahmslose, vom Todesschweiß feuchte Hand an seine Stirn; er will das Wort „Vater“ rufen und kann nicht, es fehlt plötzlich in seinem Gedächtnis; es liegt ihm auf der Zunge, aber er vergisst es voll Entsetzen in der nächsten Sekunde, eine wahnsinnige Angst drosselt ihn, dass der Sterbende nicht mehr zu sich kommt, wenn er ihm das Wort nicht zuruft, – dass nur dieses Wort allein die Macht hat, das erlöschende Bewusstsein von der Schwelle des Lebens für einen kurzen Augenblick noch zurückzubringen; er rauft sich das Haar und schlägt sich ins Gesicht: Tausend Worte stürmen zu gleicher Zeit auf ihn ein, nur das eine, das er mit brennendem Herzen sucht, will nicht erscheinen, – und das Röcheln wird schwächer und schwächer.
Stockt.
Fängt wieder an.
Bricht ab.
Verstummt.
Der Mund klappt auf.
Bleibt offen stehen.
„Vater!“, schreit Leonhard auf; endlich ist das Wort da, aber der, dem es gilt, rührt sich nicht mehr.