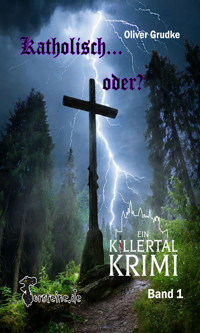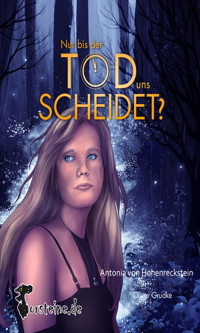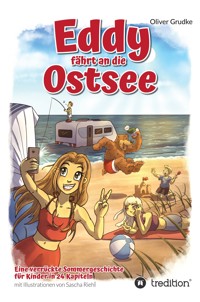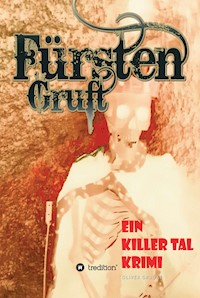2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein sehr schwerer, fast depressiver und doch zugleich auf der anderen Seite sehr herzlicher und tiefer Liebesroman, bei dem alle Höhen und Tiefen des Protagonisten hautnah gefühlt werden können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
OLIVER GRUDKE
***
NUR EIN KLEINES STÜCK DER ZEIT
© 2021 Oliver Grudke
Umschlag, Illustration: Sascha Riehl
Lektorat, Korrektorat: Nadine Senger
Verlag und Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-36330-4
Hardcover:
978-3-347-36331-1
e-Book:
978-3-347-36332-8
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
…nur ein kleines Stück der Zeit
Für
das kleine Stück der Zeit,
das wir uns genommen haben.
Den Kuss, den ich bekommen habe, und der hätte nicht sein dürfen.
Für die Liebe und die Nähe, die Du mir gegeben hast.
Und für Dich, wo auch immer Du nun bist …
Ich liege wach. Nicht seit Stunden oder noch länger. Nein, ich liege immer wach. Jede Nacht. Und das schon so lange.
Doch es macht mir nichts aus.
Nichts macht mir noch etwas aus.
Ich bin nicht krank, nicht arm und nicht in Nöten.
Und doch gibt es nichts mehr, für das es sich lohnt, da zu sein.
In meiner Seele ist keine Freude, keine Liebe, nur Gleichgültigkeit. Leere.
Und sonst nichts.
Und doch stehe ich jeden Morgen wieder auf und verrichte mein sinnloses Tagwerk.
Sinnlos, da es keinen Zweck erfüllt.
Natürlich, es sichert mein Einkommen, meine Existenz.
Doch für wen?
Doch für was?
Wenn meine Existenz aufhören würde, wer würde es bemerken.
Wer könnte es, oder wollte es?
So viele Menschen gibt es. So vielen begegne ich täglich, und doch ist da nichts.
Keine Liebe, Nähe, Wärme und keine Menschlichkeit.
Warum sollte es dann bei mir anders sein?
Vielleicht, weil ich es mir wünsche.
Doch es wird nie mehr anders, und meine Existenz wird zu Ende gehen.
Bald!
Das hoffe ich.
Und ich hoffe, dass dann nur noch Stille herrschen wird. Stille und der Tod. Denn der Tod ist mir dann willkommen.
Dann?
Nein, er ist mir heute, ja jetzt schon willkommen. Doch er besucht mich nicht. Er besucht nur jene, die zu lieben gelernt haben. Jene, die die Liebe spenden können. Jene, für die es sich gelohnt hat, zu leben.
Jene besucht er, und jene hat er besucht.
Und somit auch mich, denn dieser Besuch hat alles Licht, alles Leben in mir ausgelöscht.
Zurück blieb nur die leere Hülle, eine, die nicht sterben kann.
Noch nicht!
Weil ich zu feige war. Zu feige bin.
Ich war es nicht wert, bei ihr zu sein. Mit ihr ein kleines Stück des Weges zu gehen.
Ich war es nicht wert, diese unheimlichen Küsse zu bekommen.
Ich nicht, weil ich nichts wert bin. Niemandem etwas bedeute.
Und doch gab es eine andere Zeit. Es war nur ein kleines Stück der Zeit, in der wir uns bewegen. In der wir leben.
In der ich lebe.
Alleine.
Sie war anders. Anders als all die Menschen, als all der Egoismus, Neid. Sie war einfach, geradeaus.
Sie war unheimlich hübsch.
Sie habe ich geliebt, und ich werde nie jemand anderes lieben.
Aber sie hat auch mich geliebt. Nicht weil ich reich, hübsch, berühmt oder mächtig bin. Nein, sie hat mich geliebt, nur um meinetwillen.
Als ich dies erkannte, war es zu spät und ich habe sie verletzt. Ja, ich muss weitergehen, denn ich habe sie getötet.
Meine Waffe war die der anderen: Egoismus in seiner größten Ausprägung. Ich habe nicht hingehört. Nicht zugehört, was mein Herz mir sagen wollte.
Doch nun spricht es längst nicht mehr zu mir. Denn heute sind es genau sechs Jahre, dass ihr Herz stumm blieb und auch meines gebrochen wurde.
Und all das war meine Schuld. Mein Egoismus, der ihre Liebe zu mir schamlos ausgenutzt hatte.
Ich wollte alles und habe nichts bekommen. Nichts, nur das kleine Stück der Zeit, das nie, nie mehr zurückkehren wird.
Meine Knochen schmerzen und ich stehe auf. So mache ich es jeden Tag um genau diese Zeit. Vielleicht tue ich dies, um so meinen Schmerz zu unterdrücken. Zu vergessen. Doch ich sollte ehrlich sein. Ich kann den Schmerz nicht unterdrücken und vergessen. Er hat sich in meine Seele gebrannt, wie ein Stück heißes Eisen und die Flammen darin lodern immer heftiger.
Sie war so jung, so unbeschwert und dann musste das Schicksal unsere Herzen zusammenführen.
Damals vor sechs Jahren.
Damals an diesem heißen Tag.
Damals, als mein Leben für ein kleines Stück der Zeit einen Sinn bekommen hatte.
Doch nichts wird diese Zeit je zurückbringen.
Nichts und niemand wird mir dich je zurückbringen.
Nie werde ich deine Lippen wieder auf den meinen spüren, nie kann ich je wieder meinen Arm um dich legen, dein Lachen, deine Augen, deine Bewegungen erleben.
Ich kann nicht einmal deine letzte Ruhestätte besuchen. Es wird mir verwehrt.
Doch ich habe längst begriffen, dass du dort nie gewesen bist, nie sein wirst.
Denn in Wirklichkeit bist du immer in meinem Herzen.
--------
Die Sonne brennt heute heißer als ich es je erlebt habe. Doch vielleicht ist es auch die Ohrfeige, die mir meine Frau aus Wut gegeben hat.
„Du bist ein Versager und zu nichts zu gebrauchen!“, hat sie geschrien und ich denke fast, sie hat recht. Ich kann nichts richtig und habe auch keinen richtigen Beruf. Doch gibt es denn den richtigen Beruf? Ist nicht jeder Beruf, der es einem ermöglicht, das tägliche Brot zu erarbeiten, „der richtige“? Was bedeutet Zufriedenheit, Glück und Freude? Die meisten wissen es nicht mehr. Sie haben es vergessen, ja vielleicht nie gewusst oder gespürt. Die Menschheit hat sich weit entfernt von den Werten, die uns ausmachen. Fast glaube ich, diese Werte gibt es nicht mehr.
Für meinen Großvater war es Glück und Zufriedenheit zugleich, wenn er gemeinsam mit seinem Patenonkel auf der kleinen Bank, welche zwischen den Gärten stand, abends gemeinsam sitzen konnte und vielleicht noch eine Flasche Bier zu trinken bekam. Dann saßen die beiden und haben den Vögeln zugesehen oder der untergehenden Sonne. Dies waren immer friedliche Momente und glückliche zugleich. Doch heute sitzt niemand mehr. Alle wollen Party, was erleben, Action. Und dabei zerstören sie, was von der friedlichen Welt noch übrig ist. Und sie zerstören sich selbst, denn ihre Seelen werden nichts mehr fühlen. Für mich ist mein Leben Action genug. Nicht, dass in meinem Leben viele Dinge passieren. Im Gegenteil. Es ist langweilig, vielleicht, weil ich langweilig bin.
Und doch muss ich mich täglich aufraffen, um mich dem Leben zu stellen. Dieses wird immer teurer und es wird immer schwerer, den Lebensunterhalt zu erwirtschaften.
Zumindest für mich. Einen, der es zu nichts gebracht hat.
>Die Hilfe für alle Arbeiten<
Das steht auf meinem Pritschenwagen, den ich nun schon seit fast fünfzehn Jahren fahre. Und ich hoffe, dass er noch einmal so lange hält, denn einen neuen könnte ich mir nicht leisten. Dann könnte ich nichts mehr arbeiten und meine Frau würde mich dann sicherlich verlassen.
Wäre das schlimm?
Gerne würde ich darauf antworten, doch ich habe noch keine Antwort darauf. Die einfache Frage wäre: Liebe ich sie?
Auch darauf gibt es derzeit keine Antwort. Ich weiß nicht einmal, ob ich sie je geliebt habe. Ja, ich möchte weitergehen und fragen, ob ich je gewusst habe, was Liebe ist.
Denn eines ist sicher: Gespürt habe ich dieses Gefühl nie.
Aber mich kann man auch nicht lieben. Ich sehe nicht gut aus, bin nun schon fast Fünfzig. Habe keinen guten Beruf, kein Geld. Nichts, was man lieben könnte.
Manchmal frage ich mich, ob es bei all den anderen die Liebe gibt. Oft fahre ich durch die neuen Wohngebiete. In denen schöne, neue, saubere Häuser stehen. Davor große Fahrzeuge und spielende Kinder.
Eine heile Welt.
Aber gibt es dort die Liebe?
Ich denke nicht. Nicht bei allen, bei machen vielleicht. Häufig hört man von Trennungen, Patchwork-Familien und Affären.
Wo sind unsere Werte?
Versteckt unter dem Geld? Dem Schein zu sein, was man nicht ist?
Ich lache und wische mir den Schweiß aus der Stirn, denn bei mir ist alles so wie es zu erkennen ist.
Ich bin schmutzig und alt. Keine Schönheit und habe Schwielen an den Händen.
Die Sonne brennt immer stärker und es fällt mir schwer, mein Werkzeug aus dem Wagen zu holen.
Nicht nur heute, ich merke das schon länger. Doch da ist niemand, mit dem ich die Sorgen teilen kann. Niemand, der mir zuhören würde, niemand, der sich dafür interessieren würde.
Ich setze mich auf die Stufe der kleinen Umspannstation, die ich eigentlich reinigen sollte, und sehe in das kleine Tal hinab.
Es ist schön.
Wild.
Romantisch. Ein kleiner Fluss windet sich zwischen schroffen Felsen und grünen saftigen Wiesen entlang. Hie und da bildet er sogar kleine Weiher und Tümpel. Am Ende des Tales ist ein hoher bewaldeter Berg. Und doch schauen alte Mauern über die hohen Gipfel der Bäume.
Eine Ruine aus längst vergangenen Zeiten.
Es ist so schön hier, und je länger ich hier sitze, umso ruhiger werde ich. All das, was mich bedrängt, fällt von mir ab. Erst jetzt merke ich, dass ich hier noch nie war.
Noch nie von dem Ort oder der Burg etwas gehört habe.
Ich stehe auf und schlendere durch das frische Gras. Mit jedem Schritt, mit dem ich mich dem kleinen Teich nähere, beginnt meine Umwelt um mich herum zu verschwinden. Die Stimmen, der Lärm, die Hektik. All diese Dinge verblassen mehr und mehr. Es ist fast, als würde ich aus der Zeit treten.
Im Teich schwimmt ein Schwanenpaar. Friedlich, als gäbe es nichts, vor dem die beiden Angst haben sollten. Ich fühle mich als Eindringling. Ich sollte nicht hier sein und die Ruhe stören, denn ich gehöre zu jenen, die das Schöne nun wohl bald endgültig zerstört haben. Ich sollte zurückgehen. Doch ich tue es nicht. Als ich meinen Blick kurz von den Schwänen abwende, sehe ich nur die Natur. Das Tal, den Fluss und die Bäume.
Keine Häuser, keine Autos, keine Menschen. Jetzt bemerke ich, wie mich das alles belastet.
Wie mich mein Leben belastet. Immer nur auf der Flucht zu sein.
Auf der Flucht vor dem Versagen, der Unfehlbarkeit der anderen, dem Neid, dem Egoismus.
Auf der Flucht vor meiner Angst.
Angst vor mir selber und Angst vor den Menschen.
Das ist dumm, denn auch ich gehöre zu ihnen. Zu jenen, die zerstören und töten.
Doch die Schwäne denken anders darüber. Sie kommen auf mich zu.
Freudig auf mich zu, als wollten sie mich als einen guten Freund begrüßen.
Willkommen heißen.
Sie fürchten sich nicht vor mir, denn sie wissen, dass ich ihnen nie etwas zuleide tun könnte.
Ich setze mich an das Ufer in den Schatten einer dieser wundervollen Purpurweiden. Meine Knochen knacken dabei. Ich merke, dass ich noch nie in meinem Leben innegehalten habe. Noch nie mir Gedanken über den Sinn und die Zukunft gemacht habe. Ich krame in meinen Taschen, denn zu gerne würde ich den Schwänen etwas Brot geben. Mich bedanken für das einfache und schöne Willkommen.
Doch ich habe nichts dabei und schäme mich dafür. Doch sollte ich das? Die Tiere freuen sich einfach, dass ich da bin.
Sollte so nicht immer Freundschaft sein?
Einfach und unkompliziert?
Sollte so nicht die Liebe sein?
Ja, so sollte sie sein. Doch ich habe diese so noch nicht gespürt, und das wird nun auch nicht mehr geschehen. Nächstes Jahr werde ich fünfzig Jahre alt. Dann gibt es keine Veränderungen mehr, keine großen Zukunftsaussichten. Man kann immer zurückblicken und sich Gedanken machen, was hätte in der Vergangenheit geändert werden können. Doch ist dies nur Zeitverschwendung, denn die Vergangenheit, egal ob gut oder schlecht, wird nie mehr zurückehren.
Ich hole ein Blatt Papier aus meiner Hosentasche und einen kleinen Bleistift. Ich möchte mir meine Gedanken aufschreiben.
Das tue ich gerne, das Schreiben. Doch davon weiß niemand etwas.
Warum auch, es würde niemanden interessieren.
Die Sonne hat nun einen Weg durch das Blätterdach der Purpurweide gefunden und zwingt mich, zu gehen. Es wird auch Zeit, wenn ich mein Tagwerk noch schaffen sollte. Heute bei der Hitze wird dies schwierig. Der Rückweg fällt mir schwer. Und er kommt mir länger vor. Viel länger als ich dachte. Ich merke die Hitze und mein Alter. Beides bekommt mir nicht. Auch spüre ich, dass meine Zeit wohl bald zu Ende ist. Vielleicht ist dies nur ein Gefühl, aber es ist sehr stark.
Auch davon habe ich niemandem etwas erzählt.
Wen würde es interessieren? Meine Frau?
Nein! Sie will nur, dass genug Geld auf dem Konto ist.
Ich könnte sie verlassen, ja sicher. Doch ich habe Angst. Angst, dann noch einsamer zu sein als ich es jetzt schon bin. Als ich an meinem Wagen zurück bin, fährt laut klingelnd eine Familie mit Fahrrädern an mir vorbei. Eine junge Familie, mit neuen Fahrrädern, zwei Kindern und schönen Klamotten.
Es ist Urlaubszeit und ich ernte wieder die abfälligen Blicke. Blicke, die mir zeigen, dass ich störe. Hier und jetzt, wo die Leute nur die saubere Natur sehen wollen. Keinen schmutzigen Handwerker.
Längst machen mir diese Blicke nichts mehr aus. Doch jetzt spüre ich den Hunger und weiß, dass außer einer Flasche Cola nichts im Wagen sein wird.
Es ist nie mehr dabei, denn für mehr würde das Geld heute auch nicht reichen. Doch mein Hunger ist zu groß. Wenn ich nichts esse, dann kann ich meine Arbeit heute nicht erledigen. Dann kann ich die Rechnung morgen nicht stellen und nächste Woche am Ersten fehlt das Geld. Dann wird mir die Bank endgültig den Hauskredit kündigen.
Als ich die Wagentür zuschlage, sehe ich die roten Dächer eines kleinen Dorfes.
„Einen Versuch ist es wert!“, sage ich zu mir selber, doch so recht daran glauben will ich nicht.
Die Zeiten haben sich geändert und in fast keinem Dorf gibt es noch einen Bäcker oder einen Metzger.
Aber ich will es versuchen und finde auch noch ein paar Münzen unter dem Beifahrersitz. Das Dorf lieg nahe der Ruine, etwas tiefer und scheint sehr klein zu sein. Am Eingang direkt neben dem Ortschild ist ein großer Bauernhof.
„Bärenstein!“, lese ich den Namen des Ortes, von dem ich noch nie gehört habe und stelle mir vor, wie es wohl vor hunderten von Jahren gewesen sein muss, als es noch echte Bären hier gab. Meine Gedanken schweifen ab und beginnen eine Geschichte zu erzählen. Dann sehe ich schon die letzten Häuser und meine Vermutung bestätigt sich. Es gibt doch keine Möglichkeit, etwas zu Essen zu kaufen. Und als ich wegen des Anhängers an meinem Wagen nur mit großen Schwierigkeiten das Wendemanöver schaffe, sehe ich plötzlich das Schild mit rotem Pfeil, welches in einen Hinterhof zeigt.
>Metzgerei<
steht dort in einer alten Schriftart. Ich halte an und schau verstohlen in den Hof. Tatsächlich stehen dort noch weitere Handwerkerfahrzeuge. Ein weiterer Mann kommt auf die Straße zurück und hat eine kleine weiße Tüte in der Hand. Also gibt es eine Möglichkeit, etwas zu kaufen. Doch schon merke ich wieder meine Unsicherheit, ja Angst in mir aufkeimen. Ich trage schäbige Kleidung und schmutzige dazu. Dann bin ich hier fremd und weiß nicht, was mich erwartet.
Vielleicht wieder Ablehnung, Neid und Spott.
Fast fahre ich einfach weg.
Doch mein Hunger und die Erkenntnis, ohne etwas zu Essen die Arbeit nicht zu schaffen, sind stärker.
Ich steige aus und spüre dabei meine Nervosität. Aber auch die Ruhe, die von diesem Ort ausgeht. Das Dorf hat keine Durchgangsstraße und alles wirkt gemächlicher. Ich gehe in den kleinen Innenhof. Dort am Ende steht ein Schild mit dem Aufdruck Metzgerei. Neben einem großen angelaufenen Schaufenster steht ein lachendes Schwein aus Kunststoff. Ich gehe weiter und wische mir meine Hände an meiner Hose ab.
Ein junger Mann in einem der neumodischen Handwerker-Outfits kommt aus dem Laden.
„Hey, grüß dich!“, sagt er freudig und hüpft in seinen Lieferwagen.
„Hallo!“, sage ich mit belegter Stimme und freue mich. Heute nun schon zum zweiten Mal wurde ich von jemandem, der mich nicht kannte, freudig begrüßt.
Freundschaftlich begrüßt.
Ich winke ihm zu, als er aus dem Innenhof fährt. Er lacht und winkt zurück.
Das ist so schön.
In der kleinen Metzgerei schein die Zeit stehen geblieben zu sein. Alles ist, wie ich es noch aus den Metzgereien meiner Kindheit kenne. Weiße Fliesen. Eine Kühltheke inmitten des Raumes. Dahinter ein Hackklotz. Und an der Hand eine Schiene, an der große Würste hängen. Auf der Theke eine alte Registrierkasse und ein abgewetzter bunter Teller für das Wechselgeld. An der Seite steht ein Regal mit Eiern und Nudeln.
„So, jetzt, junger Mann. Was kann ich für Sie tun?“, sagt plötzlich eine Stimme, doch ich sehe niemanden.
„Darf es eine Vesper sein?“, fragt die Stimme und dann sehe ich die alte Frau hinter der Kasse. Sie ist so klein, dass sie fast nicht auf den Tresen reichen kann. Ihr Rücken ist so krumm, dass dieser bereits einen rechten Winkel zum Körper bildet. Ihre Augen sind aufgequollen und haben dicke Tränensäcke. Die Frau trägt dazu eine weiße Kittelschürze.
„Ich hätte gerne ein belegtes Brötchen!“, sage ich.
„Soso. Ein belegtes Brötchen. Was darf ich denn drauflegen? Schinken? Salami? Bierwurst?“
Ich wirke unsicher und bin es auch.
„Egal!“, höre ich mich sagen. Die Frau sieht mich durchdringend an. Dann wickelt sie das Brötchen in ein Wachspapier und steckt beides anschließend in eine Tüte, auf der ein lachendes Schwein zu sehen ist.
„Das macht Eineuroachtzig!“, sagt sie und wendet ihren Blick nicht von mir ab. Ich werde nervös und suche die Münzen. Ich habe diese nicht gezählt und hoffe, dass es reicht.
Was, wenn nicht?
Dann würde ich mich schämen.
Doch für was?
Dafür, dass ich einen schlechten Beruf habe.
Einen, der keiner ist, sondern nur eine Tätigkeit.
Eine, die bestimmt jeder erledigen könnte.
Dafür, dass ich so schäbig aussehe, oder mich so fühle.
Dafür, dass ich mich ausgeschlossen fühle.
„Bitte!“, sage ich und lege die Münzen, die ich jetzt gezählt habe, auf die abgewetzte Schale.
„Nur ein Brötchen?“, sagt die Frau und ich denke, es ist keine Frage, sondern eine Feststellung.
„Möchte auf die Linie achten!“, lüge ich und nehme mein Brötchen.
„Soso!“ Die Frau legt die Münzen in die alte Registrierkasse. Ich weiß, dass sie erkannt hat, dass ich lüge. Dafür schäme ich mich nun auch noch.
„Könnten Sie mir vielleicht kurz zur Hand gehen, junger Mann?“ Die Frau kommt um den Tresen herum.
„Ja, ich, also. Natürlich!“, sage ich spontan. Doch zuerst habe ich an meine Arbeit gedacht und daran, heute noch nichts geschafft zu haben.
„Sehen Sie, diese Kisten sollten noch hinter das Haus. Der Geselle und der Meister sind schon im Feierabend und alleine, ja Sie sehen es ja, ich bin einfach zu alt.“
Jetzt sehe ich ihre krummen und knotigen Finger. Ihr Rücken ist so krumm, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass sie noch in der Lage ist, zu gehen.
Und doch wirkt sie freundlich, zufrieden, ja glücklich.
Ich nehme die Kisten und trage diese durch die Schlachträume hinter das Haus.
„Stellen Sie sie nur hier einfach ab. Den Rest erledige ich dann“, sagt die Frau und ich nicke.
Als ich die letzte Kiste abstelle, nickt sie mir freundlich zu.
„Ich hätte da noch eine Bitte an Sie.“ Wieder sieht sie mich durchdringend an. Ich werde nervös, da ich nicht nein sagen möchte und es eigentlich auch nicht kann. Und doch drängt die Zeit. Sie drängt mich zurück an meine schäbige sinnlose Arbeit.
„Ich helfe gerne!“, sage ich und fühle, dass dies die richtige Entscheidung ist.
„Sehen Sie, so viele belegte Brötchen sind übrig geblieben, und die muss ich nun alle wegschmeißen. Da dachte ich, Sie könnten vielleicht noch ein paar, oder alle mitnehmen.“ Sie hält mir eine große weiße Tüte hin und lächelt.
Ich freue mich.
„Das kann ich doch nicht annehmen!“, heuchle ich.
„Sie müssen. Und Sie müssen noch eine Tasse Kaffee mit mir trinken. Setzen Sie sich doch etwas. Und essen Ihr Brötchen!“ Dann geht sie mühevoll zurück in die Metzgerei.
Hinter dem Haus steht ein Nussbaum. Schön grün und groß. Darunter steht eine einfache Holzbank. Eigentlich ist es nur ein Brett, das über zwei Holzblöcke gelegt wurde. Es sieht wettergegerbt und krumm aus. Doch man sitzt hervorragend darauf.
Wieder bemerke ich die Stille und Ruhe. Der Ausblick ist malerisch, hinüber zum Tümpel und den schroffen Felsen über das ganze Tal hinauf zur Ruine. Es kommt mir vor, als wäre es eine Traumwelt. Auch erscheint alles in warmen Tönen, als entspränge alles aus einer Szene in einem Film. Alles in mir entspannt sich und ich genieße mein Brötchen.
Meine Ängste und Sorgen werden immer kleiner. Ja, ich denke jetzt nicht mehr daran und genieße diesen Moment. Diesen Teil der Zeit in meinem Leben.
Zum ersten Mal wird mir bewusst, dass auch mein Leben begrenzt ist. Dass alle Momente nur ein einziges Mal erlebt werden können.
Und diesen Ort möchte ich nun länger erleben als ich es mir eigentlich erlauben kann.
Die alte Frau kommt zurück und lächelt mich an. Fast denke ich, sie kann meine Gedanken lesen.
Vielleicht kann sie es ja.
„So, bitte sehr. Dort stehen Milch und Zucker!“ Sie reicht mir eine große alte bunte Tasse.
„Danke, ich trinke schwarz!“
„Ich auch!“, sagt sie und fällt schwerfällig und erschöpft auf die Bank neben mir. In der Zwischenzeit habe ich mir noch ein Brötchen genommen. Sie klopft mir auf meine Knie.
„Sie arbeiten hart!“, sagt sie dann.
Woher weiß sie das? Kennt sie mich? Meine Gedanken werden immer leichter.
Dann zeigt sie mir ihre Hände.
„Genau wie die Ihren, nur etwas älter!“ Sie wippt leicht mit dem Kopf.
„Unglaublich schön hier!“, sage ich mit vollem Mund.
„Ja, ich sitze hier nun schon mein ganzes Leben lang und genieße die Aussicht. Genieße das Tal, die Stille. Doch in letzter Zeit ist es mir fast zu still. Selten leistet jemand mir Gesellschaft. Ich bin froh, dass Sie heute da sind.“ Sie schlürft ihren Kaffee.
Ich denke an mein Leben und daran, dass hier auch kaum noch jemand eine Rolle spielt. Daran, dass ich kaum noch in jemandes Leben eine Rolle spiele.
Daran, dass ich für niemanden mehr wichtig bin.
„Ich habe noch nie einen so schönen Moment erlebt!“ Ich schaue in die Sonne und fast denke ich, die Vögel stehen still.
„Sie sind nicht verheiratet!“, sagt sie dann und schaut auf meine Hand.
„Doch. Schon. Schon lange!“, stottere ich.
Sie zeigt mir ihre rechte krumme Hand. Und den Ring daran.
Ich trage keinen.
„Ich trage keinen wegen der Arbeit!“, lüge ich.
„Er hat mich noch nie gestört. Wir waren 42 Jahre verheiratet und doch war es nur ein kleines Stück der Zeit.“ Sie wischt sich eine Träne ab.
„Jetzt schauen Sie aber verwundert? Was denken Sie, wie alt ich bin?“ Sie lacht und ich traue mich nicht, etwas zu sagen. Es könnte unhöflich, es könnte falsch oder verletzend sein.
Ich mag nicht, wenn jemand verletzt wird.
Und doch werde ich selber viel zu oft verletzt.
Doch ich beschwere mich nicht, denn jetzt ist ein schöner Moment.
Sie klopft mir auf meinen Schenkel.
„In meinem Alter darf man dieses nennen. Ich werde nächsten Monat vierundneunzig Jahre. Ja vierundneunzig und ich arbeite noch immer. Nicht wegen des Geldes, nein, ich tue es gerne. Dies ist ein Teil meines Lebens und das, was es ausmacht. Sehen Sie, junger Mann …“
„Jung bin ich nun wirklich nicht mehr“, murmele ich und denke daran, dass der größte Teil meines so sinnlosen Lebens wohl vorbei sein wird.
„Junger Mann“, fährt sie mit fester Stimme fort. „Ich darf das sagen, wo Sie doch vielleicht erst halb so alt sind wie ich.“ Wieder lächelt sie. Sanft.
Ich zucke mit der Schulter und nehme mir noch ein Brötchen. Schon lange habe ich nichts so Gutes gegessen. Normalerweise kaufe ich in den Discountern nur das Billigste. Ohne darauf zu achten, wie viel Arbeit hinter den Produkten stecken kann.
Vielleicht, weil auch ich keine Werte habe.
Nein! So ist es nicht. Ich habe Werte, doch habe ich vergessen, mich an diese zu erinnern.
„Und weil dies hier alles ein Teil von mir ist, oder ich ein Teil des Ganzen bin, so mache ich noch etwas weiter. Nur etwas, denn der Meister und der Geselle haben schon bessere Angebote aus der Stadt.“ Die Frau wippt nachdenklich mit dem Kopf.
„Und Ihre Kinder? Was ist denn mit denen?“, frage ich, merke aber sofort, dass dies eine falsche Frage war.
„Ja, was ist mit denen? Nun, wir hatten nie welche? Und so bin ich alleine, jetzt, da mein Mann schon fast zehn Jahre tot ist. Mein Gott, zehn Jahre. Wo bleibt nur die Zeit?“ Ich sehe eine Träne auf ihrer Wange und doch lächelt sie noch immer.
Gütig.
Zufrieden.
„Haben Sie Kinder?“ Sie schaut mich an und ich schüttele nur den Kopf.
„Noch ist Zeit!“, sagt sie dann.
„Meine Frau möchte keine“, sage ich sehr wortkarg.
„Und Sie?“
„Ich? Ja, also ich, ich schon. Sehr gerne, sehr sogar!“, höre ich mich sagen und kann fast nicht glauben, dass es meine Worte sind.
„Dann ist noch Zeit und Sie sollten Ihrem Herzen folgen!“ Die Frau aus der Metzgerei wirkt müde. Ich habe sie angestrengt. Ich sollte gehen, denn die Sonne steht schon tief und ich habe noch immer zu wenig gearbeitet.
Und doch bleibe ich.
Warum?
Weil ich es möchte.
Ich nehme mir noch ein Brötchen und schwöre dabei, dass es für heute das letzte sein wird. Die Sonne taucht alles in ein warmes oranges Licht. Noch intensiver als vorhin. Ich sehe hinauf zu den Mauern der alten Burg.
„Ist das eine Burg oder so?“, frage ich mit vollem Mund.
„Sie kennen Bärenstein nicht?“, fragt die Frau, deren Namen ich noch immer nicht kenne, voller Verwunderung.
„Nein, nie gehört.“
„Dann werde ich Ihnen die Geschichte erzählen. Wenn Sie möchten?“
Ich nicke, weil ich die Geschichte hören möchte. So gerne wie ich noch nie eine Geschichte hören wollte. Und doch habe ich eigentlich keine Zeit.
Und doch bleibe ich. Weil ich die Geschichte hören möchte.
Und weil ich noch nie an einem so friedlichen Ort gewesen bin.
Weil mein Leben noch nie innegehalten hat. Immer war ich auf der Flucht.
Auf der Flucht vor mir selber und meiner Angst.
Ich möchte nicht mehr fliehen.
Ich möchte innehalten.
„Um ungefähr tausend nach Christi kamen die ersten Mitglieder der Familie in dieses wilde Tal. Es war rau und bot kaum ausreichend Nahrung. Und doch gefiel es den Herren von Bärenstein hier und sie blieben. Zuerst im Tal. In einfachen Hütten. Sie lebten in Frieden mit ihren Nachbarn und den Tieren. Auch den Bären, die hoch oben in den Felsen lebten. Doch die Zeiten wurden wilder und kriegerischer. Viele der Nachbarn verstrickten sich in Kriege und Fehden. Die Bären zogen fort und überließen den Grafen ihren Schutz. Doch Kriege und Kampf war für die Herren von Bärenstein nie eine Option. Sie wollten weiter in Frieden leben und arbeiten. Doch hatten sie auch Angst und bauten deshalb diese mächtige Burg in den Felsen der Bären. Alsbald nannten sie sich auch danach, Grafen von Bärenstein. Den Titel erhielten diese vom König. Denn auch der König zog in den Krieg und die Bärensteiner hatten Geld, das diese verliehen, auch an den König. Auch an ihre Nachbarn. Doch selber lehnten sie immer jeglichen Kampf und Krieg ab. Sie blieben fleißig und schufen sich ein immer größeres Vermögen an. Ihr Einfluss war größer als der des Königs.
Und so kamen die Neider und Heuchler auf. Sie denunzierten die Herren von Bärenstein und dann wurde ihre Burg erobert.“
„Eine spannende Geschichte. Schade, dass die Grafen untergegangen sind“, sage ich laut und stelle mir die Zeiten im Mittelalter vor.
Plötzlich wirkt die Frau hellwach und greift meine Hand. Fester als ich es ihr je zugetraut hätte.
„Aber nein, junger Mann. Aber nein. Ich versichere Euch, die Bärensteiner sind nicht untergegangen. Ihre Burg, ja vielleicht, zu einem Teil. Doch die Nachfahren jener ehrenhaften Menschen sind noch immer da draußen. Man sagt, diese besitzen ein Vermögen, das unvorstellbar groß ist. Und sie werden es nur für die guten Dinge einsetzen und jedem helfen, der Hilfe benötigt, sollte sein Ansinnen ein friedliches sein“, höre ich die nette alte Frau sagen. Mir gefällt die Geschichte und doch denke ich nur, es ist eine Geschichte und kann mir heute nicht vorstellen, wie ich mich irren werde.
„Dann danke ich Ihnen“, sage ich und stehe auf, denn es gibt noch so vieles zu tun. Die Zeit, die hier unter dem Nussbaum hinter der alten Metzgerei keine Macht zu besitzen scheint, wartet dennoch da draußen und fordert meine Eile.
„Ach sagen Sie doch bitte Amalie zu mir. Einfach Amalie.“
„Gerne!“, sage ich und nenne ihr meinen Namen.
„Ein schöner Name“, sagt sie, doch ich denke, dieses Mal flunkert sie. Mein Name ist nicht schön. Er bedeutet nichts. Und es gibt niemanden in der Geschichte, der je mit so einem Namen berühmt wurde.
Mein Name ist so wie ich: Unbedeutend.
„Also, Amalie, vielen vielen Dank. Ich muss noch etwas arbeiten.“ Ich spüre, wie die Zeit mir Vorwürfe macht. Wie meine Angst zurückkehrt.
„Ach wofür denn. Ich bin es, die zu danken hat. Schon so lange hat mir niemand mehr Gesellschaft geleistet. Aber wenn du noch etwas zu arbeiten hast, solltest du dich beeilen. Das Wetter wird schlechter.“ Amalie zeigt in den milchig-blauen Himmel. Nur am Ende des Tales erkenne ich eine hochwachsende Wolke. Diese sieht fast aus wie ein Atompilz.
„Meinst du?“ Ich denke, das Wetter hält.
„Glaub mir. Ich lebe nun schon seit vierundneunzig Jahren genau an diesem Ort. Das Wetter wird umschlagen.“
Meine Unruhe ist zurück und hat den Frieden verdrängt. Ich bedanke mich noch einmal und verspreche Amalie, bald wieder einmal herzukommen. Als ich in meinen Wagen steige, fegt schon ein frischer Wind durch das Tal. Fast denke ich, es ist der Atem des Bösen, der mich für meine Faulheit bestrafen will. Er will mir sagen, dass er mich gefunden hat und nun noch härter arbeiten lassen will. Und das werde ich tun müssen. Denn in der Ferne sehe ich stille Blitze zucken. Das Unwetter kommt auf mich zu, als möchte es mich von diesem Ort hinwegfegen. Als hätte ich nie hier sein sollen.
Doch ich war gerne hier.
Und ich werde wiederkommen.
Bald.
Doch jetzt muss ich meinen Ängsten folgen und die Arbeit erledigen. Denn sonst, denn sonst …
Die Blitze und die tiefschwarzen Wolken kommen immer schneller auf mich zu.
--------
Ich bin zurück an der Umspannstation. Die Luft riecht verbrannt, ja feindselig. Ich spüre den Groll. Doch von wem? Wem sollte meine Anwesenheit hier missfallen? Ich denke nicht weiter darüber nach, denn meine Ängste haben die Macht übernommen.
Ich parke direkt an der Station. Es ist eng. Unübersichtlich.
Doch ich denke nicht nach.
Bin zu oberflächlich. Überlasse meiner Furcht das Handeln.
Der Radweg kommt direkt an der Station vorbei. Jemand, der zu schnell fährt, könnte meinen kleinen Anhänger übersehen.
Doch ich denke nicht nach, denn ich spüre den ersten dicken Tropfen auf meiner Haut. Ich sehe nur noch mein Handeln.
Mein!
Ich denke nicht an die anderen.
Habe ich das je?
Denkt vielleicht deshalb niemand an mich?
Weil ich ein Egoist bin?
Ohne Sinn und Werte?
„Nein!“, rufe ich erneut hinaus und höre das erste dunkle bedrohliche Donnergrollen.
Ich mache mir Vorwürfe.
Vorwürfe, weil ich so lange untätig war. So lange den Tag und die Zeit habe verstreichen lassen. Nicht an das Geld gedacht habe, das ich doch brauche.
Ich!
Und wieder sehe ich den anderen nicht.
Doch gerade, als ich die Motorsense auspacke, sehe ich ihn.
Wie er auf mich zufährt.
Wie er den Hänger, den ich so leichtsinnig geparkt habe, nicht sieht.
Ich werfe die Motorsense auf den Boden und versuche den Radfahrer zu warnen.
„Achtung!“, rufe ich, doch es ist zu spät. Er weicht dem Hänger aus und kracht in mich hinein. Wir überschlagen uns und stürzen die Böschung hinunter. Ich falle auf den Rücken und spüre einen kurzen Schmerz.
Doch dieser ist nichts gegen den Schmerz in meiner Seele. Ich bin schuld, dass sich jemand verletzt hat. Nur weil ich meiner Angst nachgegeben habe. Ich versuche aufzustehen, doch es fällt mir schwer. Meine Augen suchen den anderen und sehen dann neben dem Fahrrad einen schlanken Jungen sitzen. Er hat einen blauen Helm und eine blau getönte Sonnenbrille auf. Ihm scheint zum Glück nicht viel passiert zu sein. Das erleichtert mich. Der Regen wird stärker und das Gewitter ist nun sehr nahe. Ich sehe die Blitze über den Baumwipfel zucken und höre den grässlichen Donner.
Endlich schaffe ich es, mich aufzurichten. Mein Nacken schmerzt.
„Ist Ihnen was passiert!“, rufe ich dem Jungen zu. Dann zieht dieser den Helm ab und lange brünette Haare fallen herunter. Jetzt erst sehe ich, dass es kein Junge ist.
Es ist eine junge Frau.
Sie kommt auf mich zu.
Sie nimmt die Sonnenbrille ab und ich sehe in die tiefblauen Augen einer wunderbaren Frau.
Einer sehr jungen Frau.
„Sind Sie verletzt?“, fragt diese und kniet sich zu mir. Ihre schlanken Finger und ihre weichen Hände stützen meinen Kopf.
„Nein, nicht schlimm! Aber was ist mit Ihnen? Wie geht es Ihnen denn? Es tut mir wirklich leid!“, sage ich und sehe eine Wunde an ihrem Bein.
Sie kneift ihren Mund zusammen und dann lacht sie.
So wunderbar, wie ich es noch nie gehört habe.
„Ja Sie sind mir ja einer. Entschuldigen sich bei mir. Dabei bin ich es doch, der in Sie hineingerauscht ist. Also wenn schon, dann müsste wohl ich mich entschuldigen.“ Sie legt ihren schlanken Arm um meine Schulter und versucht mich hochzuziehen.
„Geht es?“
„Ja, wirklich. Es geht. Aber was ist mit Ihnen? Ihrem Bein?“ Ich mache mir so große Vorwürfe. Sie stützt mich und wir humpeln gemeinsam die Böschung hinauf. Der Regen hat unsere Kleidung völlig durchgeweicht. Man kann erkennen, dass wir beide zu schlank sind.
Sie mehr als ich.
„Sie tun es schon wieder!“, sagt sie und zieht mich hoch auf die Straße. Ich schäme mich für meine Plumpheit. Und für mein Alter.
„Was? Was meinen Sie?“
„Sie fragen danach, wie es mir geht. Dabei sind Sie es doch, der verletzt ist.“
„Sie doch auch. Sehen Sie, Ihr Bein. Ich sorge mich um Sie!“, höre ich meine Worte und dann schlägt der Blitz ganz in unserer Nähe ein.
Plötzlich schaut die junge Frau mich völlig überrascht an. Als hätte ich etwas gesagt, das noch nie jemand zu ihr gesagt hat.
„Sie, … Sie … sorgen sich um mich. Um mich?“, stottert sie.
Ich nicke. „Ja“, antworte ich und schaue ihr in die unglaublich tiefen Augen. Noch nie habe ich jemandem so tief in die Augen gesehen. Noch nie habe ich so wunderschöne Augen gesehen. Wir sind uns nun so nahe, dass ich ihren Atem spüren kann. Der Regen läuft über unsere Gesichter. Das Unwetter tobt und doch ist es für einen Augenblick völlig still.
Für einen Augenblick gibt es nur uns beide.
Dann dreht sie sich um und geht zu ihrem Fahrrad. Sie hält inne und kommt zurück.
„Warum?“, fragt sie und ich sehe ein Flehen in ihren Augen, ein Flehen nach der richtigen Antwort auf ihre Frage. Ein Flehen nach Liebe, nach Nähe, danach, nicht die falsche Antwort zu hören.
Doch was ist die richtige Antwort?
Kann ich diese geben?
Jetzt oder je?
Eine Antwort, ja vielleicht schon ein einzelnes Wort kann so vieles.
So vieles verändern, zerstören, so vieles verletzen.
Doch die richtige Antwort kann so vieles verbessern. Kann Trost und Nähe spenden.
Liebe!
„Warum sorgen Sie sich um mich?“, fragt sie noch einmal und ihre Augen flehen noch stärker.
Und mein Herz hat die richtige Antwort. Doch traue ich mich nicht, diese auszusprechen.
Denn es könnte doch die falsche Antwort sein. Sie könnte verletzen.
Und vielleicht diesen Moment zerstören.
Doch ich muss antworten.
Ehrlich.
Und doch tue ich es heute nicht. Nicht jetzt, da ich mich fürchte und Furcht kann lähmend sein.
Lähmend und enttäuschend. Denn ich sehe und spüre ihre Enttäuschung, als ich mich wortlos dem Fahrrad zuwende.
„Damit können Sie aber nicht mehr fahren!“, stelle ich nüchtern fest und sehe die verbogene Felge des blauen Rades.
„Nicht schlimm. Da schiebe ich es einfach!“, sagt sie und nimmt das Rad aus meinen Händen.
„Soll ich nicht doch einen Arzt rufen, Sie sehen blass aus?“, sagt sie und streicht mir meine Haare aus dem Gesicht.
„Nein, nein, das ist nur der Regen und die Kälte“, sage ich und spüre, wie es beginnt, mich zu frösteln.
„Sicher!“, fragt sie erneut.
„Ja, sicher.“
„Gut, also dann …“
„Ich fahr Sie!“, rufe ich plötzlich. Wieder dreht sie sich verwundert um.
„Mich? Wohin?“
„Nach Hause! Das ist das Mindeste, was ich tun kann.“
„Sie wollen mich nach Hause fahren?“
Ich nicke und bin mir so sicher wie noch nie in einer Sache. Ich würde diese junge Frau nach Hause fahren und wenn es einmal um die ganze Welt gehen würde.
„Kommen Sie, ich lade das Bike auf den Hänger“, sage ich und tue es auch. Dann halte ich ihr die Tür auf und sie setzt sich unsicher auf den Beifahrersitz. Nachdem ich das Fahrrad festgebunden habe, steige ich auch ein. Wir sind beide pudelnass. Auf dem Rücksitz habe ich ein Handtuch liegen. Ich reiche es der jungen und wunderschönen Frau.
„Danke!“, flüstert sie.
Ich starte den Motor.
„Wie geht es Ihrem Bein?“
„Gut, da ist nichts!“, sagt sie sehr leise. Dann schaut sie mich wieder verwundert an, als würde ich etwas völlig Unerwartetes tun. Etwas, mit dem sie nie gerechnet hätte.
„Wo wohnen Sie denn?“
Sie nennt mir die Adresse.
„Ist dort nicht nur Wald? Wusste nicht, dass es dort auch Häuser gibt“, höre ich mich sagen und fahre behutsam los. Der Sturm ist auf seinem Höhepunkt und der Regen verbindet sich mit kleinen Hagelkörnern, welche einen ohrenbetäubenden Lärm verursachen.
Dann verlassen wir das kleine Tal.
Doch ich werde viel später immer wieder an genau diesem Tag im Jahr hierher zurückkommen.
Jedes Jahr.
--------
Die Scheiben sind beschlagen und der Regen prasselt unaufhörlich auf meinen Wagen nieder. Der Scheibenwischer gibt alles und doch kann ich nur sehr langsam fahren.
Und genau das möchte ich.
Langsam sein.
Die Zeit, welche ständig rennt und uns antreibt, zum Stillstand bringen.
Anhalten!
Und es fühlt sich so an, als ob es mir gelingen würde. Ich versuche auf die Straße zu sehen, doch immer wieder spicke ich auf den Beifahrersitz.
Sie ist schön.
Ich bin alt.
Alt und verheiratet.
Wie alt mag sie sein?
Halb so alt wie ich?
Vielleicht.
Was wäre, wenn …
Wie wäre es, wenn ich …
Gedankenspiele.
Träume.
Ich sehe ihre roten Wangen. Ob sie nervös ist? Ob sie doch Schmerzen hat und es mir nicht sagt.
Ich spüre ihren Atem. Ich höre ihren Herzschlag.
Ich möchte ihre Hand halten.
Doch bin ich alt, zu alt und vielleicht dumm.
Dumm, um mir Dinge vorzustellen.
Von Dingen zu träumen.
Von der Liebe zu träumen.
Ich habe noch nie so empfunden. Noch nie solche Gefühle gespürt. Noch nie habe ich so gerne neben jemandem gesessen. Jemandes Nähe gespürt.
Ich habe noch nie die Nähe und Liebe gespürt.
Und doch bin ich verheiratet.
--------
Wir haben nicht viel gesprochen und doch denke ich, zwischen uns braucht es nicht viele Worte.
„Es ist gleich da vorne!“, sagt sie und ihre Stimme wird brüchig. Fast denke ich, sie kommt nicht gerne nach Hause.
Auch ich komme nicht gerne nach Hause.
Das sollte so nicht sein.
Ein Zuhause sollte etwas Schönes sein. Etwas Behagliches. Ein Ort zum sich zurückziehen zu können. Ein Ort des Friedens.
All das ist mein Zuhause nicht.
War es nie, und wird es nun auch nie mehr sein. Doch es sorgt mich, dass es offensichtlich der jungen Frau auch so geht.
Das ist schlimm.
„Jetzt gleich rechts“, murmelt sie, doch ich kann es fast nicht hören, der Regen ist zu stark.
Ich fahre vorbei.
Und dann lacht sie laut und fröhlich.
„Sie sind mir ja einer. Jetzt sind Sie vorbeigefahren. Also wirklich, jetzt da rechts, da können Sie wenden.“ Sie ist fröhlich, unbekümmert. Sie lacht so wunderschön, wie ich es noch nie gehört habe. Sie gibt mir einen Klaps auf meine Schulter.
Das gefällt mir.
Und doch bin ich nun nervös. Weil ich vorbeigefahren bin. Meine Ängste sind zurück und beginnen wild zu tanzen.
Was denkt sie von dir?
Findet sie mich zu einfach?
Einfach und nicht wichtig?
Ich habe mir nie etwas daraus gemacht, was irgendjemand anders von mir denkt. Es war mir gleichgültig.
Doch nun ist es anders.
Denn hier ist es mir nicht gleichgültig.
Ich wende umständlich den Wagen und fahre sehr langsam ein Stück zurück. Noch einmal möchte ich nicht vorbeifahren.
Noch einmal möchte ich mich nicht blamieren.
Vor ihr.
Dann sehe ich die Einfahrt und biege ab. Nach einem kurzen Stück stehe ich vor einem vergitterten Tor. Links und rechts thronen auf einer steinernen Säule zwei Hirsche.
„Na also! Klappt doch!“ Wieder lacht sie fröhlich und unbekümmert. Sie steigt aus.
„Wohnen Sie hier?“ Ich zeige auf ein paar Häuser, die weiter hinten im Wald stehen. Es sind große und schöne Häuser.