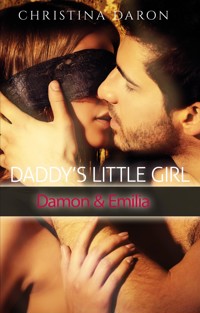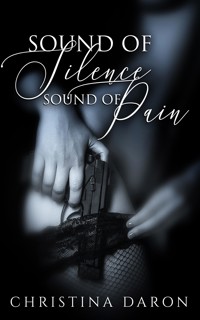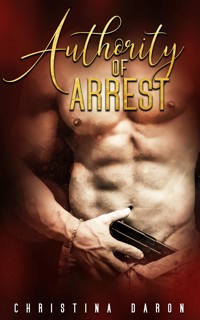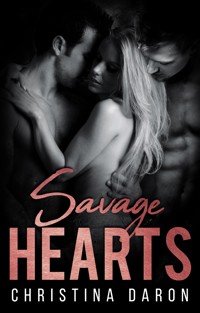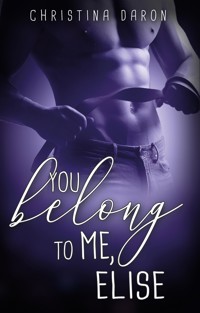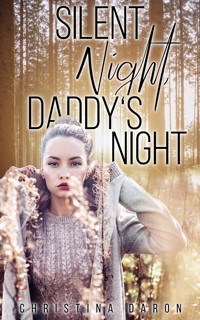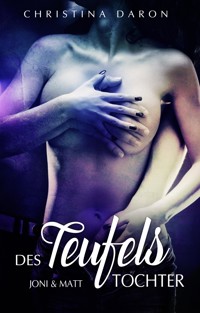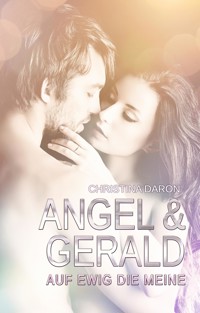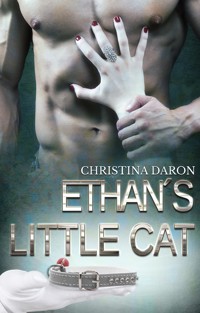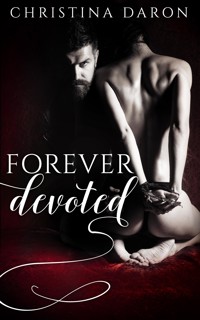2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Mason ist Tierarzt aus Leidenschaft. Eines Abends taucht eine unbekannte Frau in seiner Praxis auf, die über und über mit Blut besudelt ist. Sie will ihren verletzten Kater in seiner Praxis behandeln lassen. Doch als er mit dem Tier aus dem Röntgenzimmer kommt, liegt ein toter Mann in seiner Praxis- ab diesem Moment gibt es kein Zurück mehr. Lori stellt Masons Leben auf dem Kopf und ignoriert gerne seine Einwände. So wie ihr schwuler Freund und ihre außergewöhnlichen Freunde. Mason kann zwar nicht alles kontrollieren, was plötzlich in seinem Leben passiert, aber Loris Verhalten duldet er nicht, was sie bittersüß zu spüren bekommt. Turbulenter heißer Erotikroman mit expliziten Szenen, die für Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht geeigent sind. Ich weise darauf hin, dass die Protagonisten nicht auf Safer Sex achten- schließlich ist es nur ein Buch!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Please (don’t) torture me
Christina Daron
1. Auflage
Copyright: Christina Daron, 2018, Deutschland
Christina Daron
c/o Autorenservice Patchwork
Schlossweg 6
A-9020 Klagenfurt
Coverfoto: covermanufaktur.de - Sarah Buhr
Korrektorat: www.korrekt-ac.com – Kristina Krüger
Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck oder eine andere Verwertung ist nachdrücklich nur mit schriftlicher Genehmigung der Autorin gestattet.
Sämtliche Personen in diesem Text sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig.
.
Kapitel 1
Lori
„Hey, Mr. Lee … jaaaa, ich hab dich auch vermisst. Du hast bestimmt Hunger, mein Großer.“
Schnurrend umkreist mein riesiger Kater meine Beine und miaut, als sei er kurz vor dem Hungertod.
Ich hebe ihn hoch auf den Arm, und sofort hebt er den Kopf, um mich zu beschnuppern. Mich mit dem Kater unterhaltend, laufe ich in die Küche und schmuse mit ihm, ehe ich ihn auf dem Boden absetze.
Sein buschiger Schwanz ragt steil auf, als ich im Küchenschrank nach seinem Futter krame. Wieder tänzelt er um meine Beine. Sein Fell kitzelt mich an den nackten Beinen, und ich muss kichern.
„Bah … wie kannst du dein Futter nur lieben?“, rede ich weiter mit Mr. Lee, als ich die kleine Aluschale öffne und mir der unverkennbare Geruch von Nassfutter entgegenweht.
Lees Miauen wird stärker – natürlich riecht er sein Futter.
Ich hebe den Futternapf vom Boden, spüle ihn aus und fülle ihn mit neuem Futter.
Kaum habe ich den Napf in der Höhe seiner Schnauze, fängt er an, sein Futter zu fressen.
„Ach, tu doch nicht so … Lee, verdammt!“, fluche ich, weil er seine Krallen ausfährt, um den Napf schneller runterzudrücken. „Da hast du dein Fressen.“
Seufzend schüttle ich den Kopf und sehe ihm zu, wie er das Essen inhaliert. Dieses Vieh wird mir noch die Haare vom Kopf fressen, wenn es sein muss.
Ich erneuere das Wasser und stelle es neben seinen Fressnapf, dann erst ziehe ich meine Sandalen aus.
Es ist August, und dieses Jahr scheint die Sonne einen neuen Rekord aufstellen zu wollen, denn selbst die Autoreifen kleben auf dem Asphalt – zumindest habe ich das Leute auf der Straße sagen hören.
Ich selbst vermeide es, bei dieser Hitze mit dem Auto zu fahren. Da kann ich ja gleich mit einer mobilen Sauna unterwegs sein.
Auf dem Weg ins Badezimmer streife ich mein Top ab, den BH gleich hinterher und nehme das Bikini-Oberteil von der Duschstange, an der mein rosafarbener Duschvorhang befestigt ist.
Ich verziehe das Gesicht, weil mein Bikini noch klamm ist.
Egal, ich setze mich gleich auf dem Balkon in die Sonne, der trocknet schon. Meine Shorts ziehe ich auch aus, lasse sie da liegen, wo ich sie ausziehe, und mein Slip folgt, damit ich das Höschen vom Bikini anziehen kann. Anschließend schnappe ich mir ein Badetuch.
Als ich wieder aus dem Bad und am Spiegel vorbeikomme, der im winzigen Flur hängt, verziehe ich das Gesicht. – Wieso müssen Bikini-Höschen immer so eng anliegen?
Ich drehe mich vor dem Spiegel und frage mich zum x-ten Mal, wieso ich eigentlich den Spiegel ausgerechnet hier hinhängen musste.
Ach, scheiß drauf! – Die Hauptsache ist, ich fühle mich wohl. Aus dem Gefrierfach schnappe ich mir noch ein Eis und begebe mich auf den Mini-Balkon.
Es ist sechs Uhr am Abend. Obwohl die Sonne immer noch erbarmungslos brennt, ist es keineswegs stiller in New York. Man hat noch nicht einmal das Gefühl, dass der schnelllebige Lifestyle und der Alltag der New Yorker in irgendeiner Weise langsamer verlaufen, nur weil es heiß ist.
Ich ziehe meine Sonnenbrille runter, creme mich ordentlich ein und brutzle in der Sonne, ehe sie untergeht.
Mr. Lee kommt nicht auf den Balkon, sondern denkt gar nicht erst daran, bei dieser Hitze auch nur eine Kralle aus der Wohnung zu halten.
Ein bisschen Mitleid habe ich schon mit ihm und daher bereits überlegt, ihm das Fell abzurasieren. Also habe ich danach gegoogelt, wie eine rasierte Maine-Coon-Katze aussieht – mir wäre fast das Handy aus der Hand gefallen, als ich die Bilder durchgescrollt habe.
Nur über meine Leiche wird mein Kater rasiert!
Ich stöpsle die Kopfhörer ins Handy und wähle die Nummer meines Bruders, weil er mich heute schon ein paar Mal angerufen hat, während ich im Callcenter eines großen Möbelherstellers gesessen und Anrufe von sämtlichen Kunden entgegengenommen habe, die Fragen unter anderem zu ihrer Lieferung oder irgendwelche Beschwerden hatten. Ich habe null Bock verspürt, auch noch mit ihm zu telefonieren.
Und nachher muss ich noch Homeoffice für eine Softwarefirma betreiben. Die Firma schickt mir ein Memo per E-Mail, welche Aufgaben ich zu erledigen habe, aber meist sind es Geschäftsbriefe, die ich schreiben und verschicken soll.
„LORI!“ Erschrocken zucke ich zusammen, als mein Bruder meinen Namen brüllt. „Lori, verfluchte Scheiße, wieso gehst du nicht ans Handy, wenn ich dich anrufe?“
„Spinnst du? Ich war vielleicht arbeiten?!“, pampe ich ihn an. „Was willst du?“
„Bist du zu Hause?“
In diesem Moment klopft es laut an meiner Wohnungstür. Ich seufze genervt, weil ich einfach meine Ruhe haben will.
Ich ahne schon, dass es mein Bruder sein wird. Schließlich habe ich ihm gesagt, er solle seinen Besuch ankündigen. – Was er ja tut, wenn er anruft, ehe er anklopft. Blödmann!
„Ja, ich bin zu Hause und wollte eigentlich meine Ruhe haben“, murre ich, greife nach der Türklinke und drücke sie runter.
„MACH NICHT DIE TÜR AUF!“
Doch da ist es schon zu spät …
Kapitel 2
Mason
„Guten Abend, Dr. Glover“, trällert Marcy, eine meiner Tierarzthelferinnen.
„‘n Abend“, brumme ich. Ich gähne herzhaft und verfluche meinen Kollegen, der mich gestern zum Trinken animiert hat.
Da ich keine zwanzig mehr bin, hätte ich mir auch denken können, dass ich abends nicht fit sein werde, um körperlich und geistig zu hundert Prozent anwesend für heute Nacht die Notfallpraxis zu leiten.
Einmal im Monat hat die Praxis nachts geöffnet, weil es moralisch verwerflich wäre, nicht geöffnet zu haben.
Wie oft pfeife ich auf meine Moral? – Normalerweise zu oft.
Aber wenn es um Tiere geht, meldet sie sich doch.
„Wie geht’s den Tieren auf der Station?“
„Unverändert, Doctor. Alles im grünen Bereich, die Tiere erholen sich gut von ihren Operationen.“
Ich gehe nach hinten in den kleinen Umkleideraum, den ich extra habe einrichten lassen, und ziehe mir die typische Arztbekleidung an und darüber meinen Arztkittel.
Ich gähne erneut und reibe mir das Gesicht. Ich überlege, eine zweite Kopfschmerztablette einzunehmen, als es an der Tür klopft.
„Doctor?“
„Ich komme gleich.“
„Sie sollten sich das sofort ansehen.“
Ich reiße die Tür auf und sehe Marcys besorgten Gesichtsausdruck. „Da ist eine Frau mit ihrem Kater, der sich nicht rührt“, flüstert sie mir zu, als wir zum Behandlungszimmer gehen.
Ich nicke. „Sie sollten sich aber auch die Frau genauer anschauen. Wie soll ich sagen … sie sieht nicht ganz koscher aus.“
Fragend schaue ich sie an, aber Marcy macht eine Handbewegung, dass ich, wenn ich die Frau erst selbst sehe, verstehen würde, was sie mit nichtkoscher meine.
Als ich das Zimmer betrete, steht die Frau am Behandlungstisch, auf dem eine riesige Katze liegt, die sie unablässig streichelt und ihr beruhigende Worte zumurmelt.
Sie dreht sich nicht zu mir um, konzentriert sich voll und ganz auf ihr Tier. Daher habe ich einen freien Blick auf ihren schlanken Nacken.
Ihre Haare hat sie nach oben gebunden, einzelne Haarsträhnen haben sich aus ihrem Knoten befreit und ich staune nicht schlecht, als ich nähertrete und ihren ausrasierten Nacken sehe. „Interessante Frisur“, geht es mir durch den Kopf.
„Dr. Glover, das ist Lori mit ihrem Maine-Coon-Kater Mr. Lee.“
Ich umrunde den Behandlungstisch; Marcy beobachtet mich genau, damit ihr meine Reaktion nicht entgeht.
Ich blinzle ein paar Mal überrascht, als die Frau namens Lori ihr Gesicht hebt. Auch wenn sie versucht hat, ihr Gesicht zu säubern, sind dort blutverschmierte Schlieren zu sehen.
Ihre Lippen sind angeschwollen, eine beträchtliche Beule zeichnet sich auf ihrer Stirn ab.
„Kümmern Sie sich um meinen Kater, Doctor“, sagt sie bissig. Ihre dunklen Augen sehen mich scharf an, keine Träne schimmert in ihren Augen, keine rote Nase weist daraufhin, dass sie geweint hätte.
„Was ist passiert?“
„Mein Kater ist verprügelt worden.“
„Du offensichtlich auch.“ – Aber das behalte ich lieber für mich. Sie presst den Mund zusammen und zuckt, weil sie ihre geschwollenen und schmerzenden Lippen vergessen hat.
Aber anstatt sie danach auszufragen, untersuche ich den Kater routiniert und horche das Herz ab. Es schlägt stark und gleichmäßig.
„Hat er Tritte oder Schläge gegen den Kopf bekommen?“
„Kann schon sein.“
Ich kneife die Augen zusammen und halte mich zurück, auch wenn es mir unter den Fingernägeln brennt. „Wir müssen Ihren Kater röntgen, um weitere Verletzungen erkennen zu können. Sein hinterer, rechter Oberschenkel scheint verletzt zu sein.“
Sie nickt. Sie scheint von Minute zu Minute blasser um die Nase zu werden, macht aber keinerlei Anstalten, sich auf den Stuhl zu setzen, den Marcy ihr hingeschoben hat.
„Soll ich einen Arzt für Sie rufen, Ma’am?“ Besorgt schaut sie die Frau an. Ihr ist auch nicht entgangen, dass ihre Kräfte schwinden.
„Nein! Ich will nur, dass Sie sich um meinen Kater kümmern.“
Ich starre Lori grimmig an. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass sie mir noch Ärger bereiten wird.
Aber in erster Linie will ich ihrem Kater helfen. – Anschließend kann ich mich dann um sie kümmern.
„Hatten Sie keine Box dabei?“ Irritiert schaue ich mich um, weil ich nirgends etwas erkennen kann, in dem ihr Kater transportiert worden ist.
„Ich habe keine Zeit gehabt, ihn dort hinein zu stopfen“, lautet ihre knappe Antwort.
„Marcy, könnten Sie bitte eine Box holen?“
Sie nickt und verschwindet aus dem Raum. In den Minuten, in denen ich alleine mit Lori bin, baut sich eine Spannung auf, die mit den Händen zu greifen ist.
Sie starrt mich mit ihren dunklen Augen an, als würde sie Löcher in meinen Körper brennen wollen.
In diesem typischen kalten Licht, wie es auch in Krankenhäusern üblich ist, sieht sie düster aus. Durch ihr weißes Top scheint ihr roter BH durch – unheimlicher sind ihre blanken Arme, die blutbesprenkelt sind.
Ihre Lippen bewegen sich, als wolle sie was sagen, als die Tür aufgeht und Marcy mit der Box einmarschiert.
Ihre Lippen hören augenblicklich auf, sich zu bewegen.
„Wir bringen Ihren Kater jetzt in den Röntgenraum. Wenn Sie möchten, können Sie im Wartezimmer Platz nehmen.“
Sie spitzt die Lippen, als verkneife sie irgendwelche Einwände, nickt aber und verlässt den Raum.
„Sollen wir wirklich nicht die Polizei rufen?“ Marcy legt Mr. Lee behutsam in die Box.
„Das geht uns nichts an.“
Ihre Augen werden groß. „Diese Lori scheint verprügelt worden zu sein. Das Blut! Wir müssen …“
„Bringen Sie den Kater zum Röntgen!“, herrsche ich sie an. Ich habe null Bock, mich mit meiner Assistentin auseinanderzusetzen. Meine Kopfschmerzen pochen ununterbrochen an meiner Schläfe und eine leichte Übelkeit meldet sich.
Angesäuert über meine Reaktion schnappt sie sich die Box und verschwindet.
Ich warte kurz, sammle mich und gehe ihr hinterher.
Marcy hat sich schon den Mantel gegen mögliche Strahlen umgelegt und hält mir meinen hin. Mr. Lee liegt auf dem Tisch und gibt immer noch keinen Mucks von sich.
Offensichtlich hat er eine starke Gehirnerschütterung. Mal sehen, welche Verletzungen zum Vorschein kommen.
Plötzlich bricht ein Tumult aus.
Marcy und ich starren uns ungläubig an, als wir eine Frau schreien hören. Was zum Teufel …?
„Sie bleiben hier und schließen hinter mir ab.“
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass was Schlimmes im Empfangsbereich vor sich geht.
Ich zerre den schweren Mantel runter und trete auf den Flur.
Jetzt, da keine Tür die Geräusche verschluckt, nimmt der Lärm noch einmal eine ganz andere Dimension an. Ich höre mindestens eine Männerstimme brüllen und, wenn ich es richtig deute, meine andere Assistentin betteln.
Ein eisiger Schauer erfasst mich, als ich um die Ecke schaue.
Ein großer, untersetzter Mann hält ihr eine Waffe vor die Nase.
Ich fluche lautlos, weil mein Handy im Spind liegt. Und um zum Spind zu gelangen, müsste ich erst am Empfang vorbei.
Beinahe schlage ich mir mit der flachen Hand gegen die Stirn, unterdrücke gerade noch den Impuls, um nicht auf mich aufmerksam zu machen.
Ich kann in einen der Behandlungsräume – dort sind Telefone. Schnell husche ich zurück und hebe den Hörer ab.
Geschockt schaue ich den Hörer an, als kein Ton zu hören ist. Ich lege auf, wähle erneut die Nummer der Polizei, und wieder ist kein Ton zu hören.
Die Leitung ist tot.
Mit einem zentnerschweren Kloß im Bauch schnappe ich mir ein Skalpell aus dem Schrank und bewege mich langsam den Flur hinauf.
Eine Totenstille hat sich über die Praxis gelegt.
Erneut erfasst mich ein eisiger Schauer, als ich um die Ecke schaue und …
In diesem Augenblick sehe ich Lori dabei zu, wie sie dem Typen die Kehle aufschlitzt.
Kapitel 3
Lori
Als die Tür meine Stirn küsst, sehe ich schwarz und kippe um.
Ich höre noch, wie ich angeschrien werde, aber die Sprache kenne ich nicht. Außerdem hat mein Gehirn andere Sorgen, als sich Gedanken darum zu machen, welche Sprache das ist.
Am Rande höre ich ein fürchterliches Schreien. Mein Herz steht still, als meinem Unterbewusstsein klar wird, dass mein Kater so schrecklich schreit. Dann ist es still. Schrecklich still.
Das ist das Signal an meinen Körper, aus dem Beduseltsein zu erwachen und ein bestimmtes Dielenbrett aus dem Boden zu heben.
Ich hole eine Waffe heraus, auf der ein Schalldämpfer steckt, und schließe die Tür. Meine Nachbarn müssen nicht mitbekommen, wie ich diesen Scheißkerl umlegen werde.
Es hört sich ganz danach an, dass meine Schränke durchwühlt werden.
Da macht eine Faust Bekanntschaft mit meinem Gesicht, was ich nicht habe kommen sehen. Sternchen flimmern vor meinen Augen und ich lasse die Waffe fallen.
Rechtzeitig ducke ich mich, ehe mich ein weiterer Schlag ausknockt.
Plötzlich schlingt jemand seinen Arm um meinen Hals und hält mich im Würgegriff. Wo kommt denn der Typ her?!
Automatisch spult mein Körper Handgriffe ab, die ich in einem Verteidigungskurs gelernt hatte, ehe ich mit Krav Maga angefangen habe.
Ich greife nach hinten, halte seinen Kopf fest und schlage meinen Hinterkopf brutal auf seine Nase.
Das ist zwar nicht ladylike, aber Etiketten kennen diese Kerle ohnehin nicht.
Der Griff lockert sich, und ich kann mich befreien.
Ich rolle mich ab, ehe der andere mich zu packen bekommt, und greife nach meiner Waffe.
Auf dem Boden liegend mache ich eine Neunzig-Grad-Drehung nach links und erschieße den ersten Mann.
Erst da sehe ich, dass es Asiaten sind. Keine Ahnung, ob es Japaner, Chinesen oder Koreaner sind. Ich bin nicht rassistisch oder so, aber auf die Schnelle kann ich es nicht zu hundert Prozent sagen. Ein leiser Verdacht beschleicht mich trotzdem. Mein Stiefbruder ist tot, wenn ich das hier überlebe.
Ich höre ein Fluchen – wieder in dieser Sprache. Japanisch. Das muss Japanisch sein, wenn ich mit meiner Meinung recht behalte.
Ich entdecke meinen Kater auf dem Küchenboden – reglos, stumm.
„Lee“, flüstere ich erstickt.
Ich bin abgelenkt durch meinen Kater, und zu spät bemerke ich, dass der Kerl sich auf mich stürzt.
Seine Hand krallt sich in meine Haare und knallt meinen Kopf auf den Boden.
Ich stöhne auf. Das einzige, was mich noch bei Kräften hält, ist mein schwerverletzter Kater.
Da liegt eine Gabel unter dem Küchentisch, die mir vor zwei Tagen heruntergefallen ist. Meist ist meine Unordnung ein Fluch – heute ein echter Segen.
Mit den Fingerspitzen bekomme ich die Gabel zu schnappen und ramme sie blindlings nach hinten.
Ein unmenschlicher Schrei entfleucht seiner Kehle.
Ich krabble von ihm weg, ziehe mich mit aller Kraft am Tisch hoch.
Als ich mich zu ihm umdrehe, wird mir speiübel. Die Gabel steckt in seinem Hals, aber es kann keine tödliche Verletzung sein, so wie er da in meiner Küche steht.
Ich scanne meine Küche ab. Der kleine, vor Wut rasende Mann rennt auf mich zu, und in diesem Moment sprinte ich los und reiße ein Brotmesser aus der Schublade.
Ich knurre, als ich ihm das Messer mit voller Wucht in den Bauch ramme, um ihm endgültig den Rest zu geben.
Als ich von ihm aufstehe, ragt nur noch der Griff aus seinem Hals.
Die nächsten Minuten nehme ich wahr, als wäre ich in Watte gepackt. Gedämpft dringen Geräusche in die Wohnung. Als ich mich oberflächlich wasche, nehme ich die Temperatur des Wassers kaum wahr. Warm? Kalt? Keine Ahnung.
Anschließend schnappe ich mir Shorts und ein Top, die ich mir beide über meinen Bikini ziehe und schlüpfe in meine Sandalen.
Ich verspüre keine Emotionen, keine Trauer, keine Wut, einfach nichts. Ich hebe meine Kater vom Boden auf, lege ihn sanft auf mein Bett und rutsche auf die Knie, um eine Sporttasche unter dem Bett hervorzuziehen. Aus meiner Vergangenheit habe ich gelernt, immer eine für den Notfall parat zu haben. Tja, wenn diese toten Männer kein Notfall sind, dann weiß ich auch nicht.
Ich werfe mir die Tasche über die Schulter, schnappe mir mein Handy, welches in einer Ecke des Flurs gelandet ist, und hebe Mr. Lee sanft auf meine Arme. So schnell wie möglich husche ich durch den Hausflur und hinaus zum Auto.
Es ist immer noch hell genug draußen, um alle möglichen Spuren an meinem Körper zu sehen. Aber kein Mensch nimmt Notiz von mir. Womöglich sollte ich der Hitze dankbar sein, dass sich die New Yorker nur Gedanken drüber machen, wie sie sich als nächstes abkühlen können.
Im Auto ist es heiß wie in einem Brutkasten. Ich lege Mr. Lee vorsichtig auf dem Beifahrersitz ab, die Sporttasche schmeiße ich auf die Rückbank.
Als ich hinter dem Steuer sitze, zücke ich mein Handy – und tatsächlich: Es funktioniert noch.
Ein kleines Lämpchen leuchtet die ganze Zeit auf, welches mir zeigt, dass ich Anrufe in Abwesenheit habe. Mein Stiefbruder.
Vermutlich muss er verrückt vor Sorge und auf dem Weg zu mir sein. Aber dafür würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Vielleicht überlegt er sich auch einen Fluchtplan, um mir zu entkommen.
Ich google nach einer Tierarztpraxis, die abends bis in die Nacht geöffnet hat. Endlich finde ich eine Notfallpraxis.
Fahrtzeit: sechzig Minuten.
Da stehe ich nun im Behandlungszimmer. Dr. Glover ist groß, und unter seinem Kittel zeichnet sich eine breite Brust ab.
Seine Augenringe verraten mir, dass er nicht viel Schlaf bekommen hat. Sein ständig unterdrücktes Gähnen geht mir auf den Zeiger und bedeutet für mich, dass er völlig unprofessionell ist.
Aber leider habe ich keine Wahl und kann nicht zu einer anderen Praxis fahren. Die nächste ist mindestens weitere sechzig Minuten von hier entfernt.
Seine Augen fixieren mich, und als er registriert, dass Blut meine Haut ziert, scheinen seine grauen Augen hellwach zu werden.
Wenigstens reißt er sich am Riemen und konzentriert sich voll auf Mr. Lee.
Ich ignoriere den Stuhl, den mir seine Assistentin hinrollt.
Ich spüre selbst, wie meine Kräfte schwinden, dafür brauche ich keine mitleidigen Blicke seiner Assistentin.
Dr. Glovers Mitleid dagegen hält sich in Grenzen. Zumindest erscheint es mir so, als wir für einen Moment unter uns sind.
Ich will etwas sagen, doch die Angst um meinen Kater schnürt mir die Luft ab, sodass sich meine Lippen nur stumm bewegen.
Seine grauen Augen durchbohren mich, als wolle er mich so zum Reden bringen. Doch es bewirkt bei mir gar nichts, wenn ich angestarrt werde.
Ich erwidere seinen Blick und atme beinahe erleichtert auf, als die Tierarzthelferin zurückkommt und Mr. Lee behutsam in die Box legt.
Entgeistert sehe ich Dr. Glover an, als er meint, ich könne im Wartezimmer Platz nehmen. Sein Gesichtsausdruck spricht Bände.
Da ich sowieso kaum einen Ton herausbringe, kann ich dem nicht widersprechen, gehe zum besagten Wartezimmer und werfe einen Blick hinein.
Erleichtert atme ich auf, da sich im Moment niemand dort aufhält. Aber lange halte ich es nicht aus, tigere auf und ab, bis auch das Zimmer für mich zu viel wird.
Die andere Tierarzthelferin sieht mich erschrocken an, als ich am Empfang entlanggehe. „Kann ich irgendwas für Sie tun? Vielleicht eine Schmerztablette?“
Ich schaue sie finster an, und da erst bemerke ich den dumpfen Schmerz hinter meinen Schläfen.
Wenn ich nicht irgendwas einnehme, dann werde ich es in wenigen Stunden bitter bereuen.
„Wenn Sie was dahaben, gerne.“
„Wir sind in einer Tierarztpraxis, natürlich haben wir Medikamente da.“ Sie zwinkert mir verschwörerisch zu, und kurz darauf serviert sie mir ein Wasser und eine Tablette.
Das Glöckchen an der Tür bimmelt leise, als jemand die Praxis betritt.
Ich schlucke die Tablette hinunter und spüle mit Wasser nach.
Ich registriere den besorgten Gesichtsausdruck der Tierarzthelferin. Langsam drehe ich mich um, folge ihrem Blick und erstarre.
Für den Bruchteil einer Sekunde starrt der Japaner mich an, ich tue es ihm gleich.
Ich weiß nicht, woher er plötzlich kommt und woher er weiß, wo ich bin. Ich bin mir sicher, dass mir keiner gefolgt ist.
Aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Tatsache ist, dass er seine Waffe zückt: Er will mich umbringen
„RUNTER!“, schreie ich die Tierarzthelferin an. Ich habe keine Gelegenheit zu schauen, ob sie sich rechtzeitig hat in Sicherheit bringen können.
Ich sprinte in ein Behandlungszimmer, haarscharf saust eine Kugel an meinem Ohr vorbei.
Ich hechte zu den Schubladen, ziehe sie auf und schnappe mir das erstbeste Skalpell.
Im Augenwinkel sehe ich, wie er den Behandlungsraum betritt. Ich wirble herum und schleudere ihm das Skalpell entgegen.
Ein schmerzhaftes Stöhnen ist zu hören. Ich gebe ihm keine Zeit, mich zu erschießen, da ich schon das nächste Skalpell schnappe und auf ihn zu renne.
Er hebt die Waffe, zielt auf mich und drückt ab.
Ich lasse mich fallen und rolle über den Boden.
Wüste Beschimpfungen fliegen mir um die Ohren, als ich ihm das Skalpell ins Schienbein ramme.
Ich schmeiße mich mit Wucht auf ihn. Zusammen fliegen wir auf den kalten Fliesenboden der Praxis.
Verzweifelt versuche ich, ihm die Waffe aus der Hand zu schlagen. Von der Tierarzthelferin ist keine Hilfe zu erwarten.
Ich höre sie weinen und winseln und beten. Rühr bloß keinen Finger!
Stöhnend krümme ich mich zusammen, als seine Faust mir einen tiefen Schlag unterhalb meiner Rippen versetzt.
Ich rolle von ihm runter, aber Zeit, um mich zu erholen, habe ich nicht.
Ich springe auf, wirble herum, und ehe er aufsteht, verpasse ich ihm einen saftigen Tritt ins Gesicht. Ich verfluche meine Sandalen, mit denen ich nicht so zutreten kann, wie ich es mir in diesem Moment wünsche.
Trotzdem muss ich ihn ernsthaft verletzt haben, da er jaulend aufkreischt.
Vermutlich habe ich seine Nase gebrochen.
Ich nutze den Moment, um ihm die Waffe aus der Hand zu schlagen, doch der Penner ist ganz schön hartnäckig – und verdammt wütend.
Er schleudert mich von sich, als würde ich nichts wiegen. Mit dem Rücken knalle ich gegen den Empfangstresen. Sterne flimmern mir vor den Augen, als ich nach Luft ringe.
Auf keinen Fall will ich hier in dieser Tierarztpraxis verenden.
„Dein Bruder hat schon angekündigt, dass du ganz schön hartnäckig bist“, schnauzt der Typ.
„Stiefbruder, wenn ich bitten darf.“
„Das geht mir am Arsch vorbei, ob ihr eine scheiß Patchworkfamilie seid!“
„Da sind wir ja schon zu zweit.“ Ich lehne mich aufrecht an den Tresen. Eins der Skalpelle habe ich mir schnappen können, ehe er mich durch die Praxis geworfen hat.
Vorsichtig lasse ich es durch meine Finger gleiten. Solange er mit der Waffe vor meiner Nase rumfuchtelt, kann ich nichts ausrichten.
„VERSCHWINDE!“
Ich schrecke zusammen, als aus dem Nichts die Tierarzthelferin hinter dem Tresen vorspringt und ihm Sachen an den Kopf wirft. Zumindest versucht sie es, so wie die Gegenstände durch die Luft geschmissen werden.
Das ist mein Moment.
Ein letztes Mal meine Kräfte bündelnd, springe ich auf und hechte zu ihm.
Ein schwerer Wälzer trifft ihn am Kopf. Mit so einem Buch wäre es ein Witz gewesen, ihn nicht zu treffen.
Meine ganze Kraft setze ich in den Hieb und das Skalpell gleitet durch die Haut wie durch Butter.
Ein widerlicher Vergleich, aber so zutreffend.
Blut sprudelt aus seinem Hals, als ich die Halsschlagader treffe. Er sackt zusammen, gurgelnd und röchelnd versucht er, noch irgendwas zu sagen.
Meine Kraft verlässt mich, ich sacke auf ihm zusammen.
Eine plötzliche Übelkeit überrollt mich.
Würgend gehe ich von dem Toten runter.
„Atme! Ja, genau so.“
Als sich eine Hand auf meinen Rücken legt, erkenne ich erst jetzt, dass es die Tierarzthelferin ist, die sich vorgetraut hat.
Sie redet leise auf mich ein. Offenbar ist sie immun gegen Tote und Blut.
Die kann nicht normal im Kopf sein.
Und tatsächlich verschwindet die Übelkeit. Langsam, aber sie verschwindet.
„Geht schon wieder“, raune ich. „Ich könnte was zum Trinken gebrauchen.“
„Bring ich dir sofort.“ Sie springt auf und huscht in den hinteren Bereich – froh darüber, etwas zu tun zu haben.
Im Augenwinkel nehme ich eine Bewegung wahr.
Ich greife mir die Pistole, die neben dem Toten liegt, und ziele auf Dr. Glover.
„Ich rate Ihnen, meinem Kater zu helfen.“
Kapitel 4
Mason
Sprachlos sehe ich sie an. Das kann doch nicht ihr Ernst sein?!
Sie hat meine Praxis in eine blutige Kampfarena verwandelt und beharrt nun darauf, dass ihrem Kater geholfen werden soll.