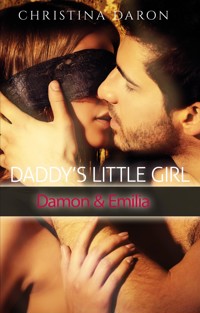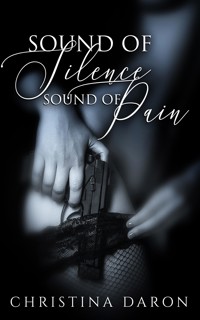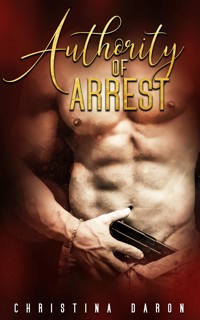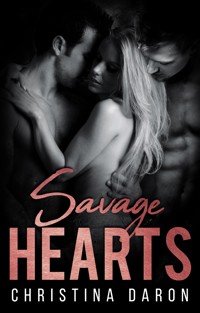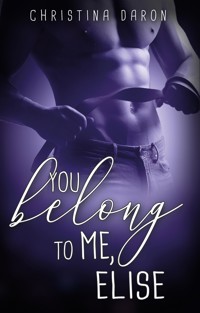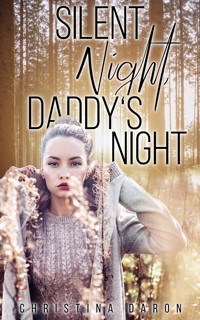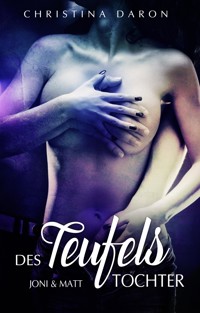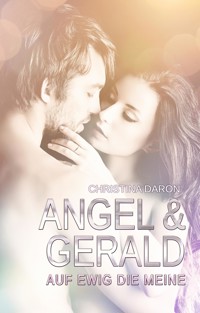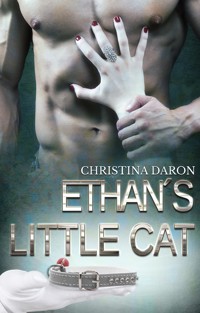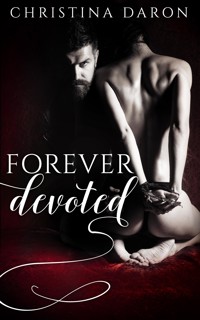2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
***Band 1*** ***Fortsetzung im Buch 'Silent Night, Daddy's Night'*** Seit mein Bruder tot ist, empfinde ich keine Freude mehr im Leben, und das weihnachtliche Drumherum hebt erst recht nicht meine Stimmung. Als wäre das nicht genug, bezahlen meine Schuldner ihr Geld nicht zurück, und ich hefte mich als pflichtbewusster Geldeintreiber an deren Fersen. Was dann an diesem einen Abend passiert, hätte ich mir nicht träumen lassen. Meine Männer und ich verhindern eine Entführung, und das einzige, was ich von dem süßen Kätzchen- ja, ihr lest richtig- verlange, ist, sie solle nicht die Polizei rufen. Ausdrücklich habe ich es ihr gesagt und sie davor gewarnt. Hält sie sich dran? - Nein! Schon gleich am nächsten Morgen unterhält sie sich mit zwei Detectives. Ich werde ihr zeigen, was es heißt, entführt zu werden und sich dankbar zu zeigen, selbst wenn sie die Krallen ausfahren wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Silent Night, f***ing Night
Christina Daron
Band 1
1. Auflage – 2019
2. Auflage – 2020
Copyright: Christina Daron, 2019, Deutschland
Christina Daron
c/o Autorenservice Patchwork
Schlossweg 6
A-9020 Klagenfurt
Coverfoto: covermanufaktur.de – Sarah Buhr
Korrektorat: www.korrekt-ac.com – Kristina Krüger
Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck oder eine andere Verwertung ist nachdrücklich nur mit schriftlicher Genehmigung der Autorin gestattet.
Sämtliche Personen in diesem Text sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig.
Kapitel 1
Cammy
„Warte doch noch, bis ich das Bier ausgetrunken habe, dann bringe ich dich nach Hause.“
Der Typ sabbert mir schon den ganzen Abend das Ohrläppchen voll, und wenn ich es zulassen würde, würde dieser Kerl meine Ohrmuschel bis zum Trommelfell nasslecken.
Angewidert schaue ich ihn an. Er ist der Meinung, dass er in ganzen Sätzen mit mir spricht, aber ich habe mir aus seinen gelallten Sätzen einen Reim machen müssen.
In der Bar ist es gerappelt voll, sie ist bekannt dafür, dass sich hier abends Studenten tummeln. Eine der Mitstudentinnen überredete mich dazu, mitzukommen.
Ich bereue es. Ich bereue es so sehr.
In der Bar ist es stickig und laut, während draußen ein Schneesturm tobt. Da wir einen Platz in der Nähe der Tür ergatterten, fegt regelmäßig eine Kälte über meinen Rücken in den Nacken, dass es mich schauert.
Ich will nach Hause. Meine innere Stimme hört sich wie ein knatschiges Kind an, und wenn ich nicht bald nach Hause komme, werde ich das knatschige Kind nach außen kehren.
Als das sabbernde Etwas mir wieder versucht, am Ohrläppchen zu knabbern, springe ich wie von der Tarantel gestochen auf und stoße dabei sein heißgeliebtes Bier um.
„Sorry“, murmle ich nicht ernst gemeint, schnappe mir meinen weißen Kaschmirmantel, dessen Kragen und der untere Bereich der Ärmel mit Fell besetzt sind, und verschwinde fluchtartig in die Kälte. Der Kommilitonin kann ich am Montag verklickern, warum ich einfach gegangen bin.
Ich setze mir meine plüschigen Ohrenwärmer auf, schlüpfe in meine dicken Fäustlinge und stakse mit meinen gefütterten Stiefeln von Prada durch den Schnee.
Ich liebe den Winter. Ich liebe die Kälte. Ich liebe es, in so viele Schichten Kleidung zu schlüpfen, dass ich mich kaum noch bewegen kann, während die Schneeflocken auf einen herabrieseln.
Winter. Es ist eine Zeit, in der die Welt stehen bleibt, weil alles gefriert und die Menschen sich langsamer bewegen.
Eine Zeit der Rücksichtnahme, der Nächstenliebe.
Mir wird schwer ums Herz, als ich mich an einen Kindheitsmoment erinnere, der mit einem Schneeanzug zu tun hat, in den meine Mutter mich gerne stopfte. Im Nachhinein frage ich mich, wieso Mom mich ausgerechnet in einen roten Anzug stecken musste, der mich wie einen wandelnden Seestern aussehen ließ. So muss ich auch gelaufen sein.
Sofort lächle ich wieder. Irgendwann werde auch ich Kinder haben und diese in solche Schneeanzüge stopfen.
Ich schlinge mir die Arme fest um den Oberkörper und ziehe den Kopf ein, als eine eisige Windböe an mir vorbeifegt.
Hinter mir höre ich schnelle Schritte. Fragend hebe ich den Kopf, wer da durch den Schnee rennt, und staune nicht schlecht, als nicht nur ein Mann an mir vorbeirennt, sondern zwei in Schwarz gekleidete Männer ihm folgen, dann verschwinden sie in die nächste Gasse. Einer von den Verfolgern hat rotblondes Haar, das zu einem wilden Knoten auf dem Kopf gebunden worden sind, seinem Bart könnte einer Rasur guttun.
Mit mulmigen Gefühl bleibe ich stehen und überlege, die Straßenseite zu wechseln oder einfach schnurstracks an dem Geschehen vorbeizugehen.
Ich hebe den Blick gen Himmel, rauf zu den Wohnungen in den Hochhäusern, aber offensichtlich schlafen die New Yorker nach Mitternacht.
Und die Straßen sind auch erstaunlich leer, selbst ein Taxi sehe ich nicht, in das ich hätte einsteigen können. Ich schnalze mit der Zunge.
Vermutlich ist es eine harmlose Geschichte zwischen den Männern … oder auch nicht.
Stocksteif und wie angewurzelt bleibe ich auf der Stelle stehen, in der Hoffnung, dass ich mich unsichtbar machen kann.
Oder blind werde. Als Augenzeugin werde ich dann nichts mehr taugen.
Bitte, Gott, lass mich erblinden und die Waffe in der Hand des Fremden nicht sehen, der langsam an mir vorbeischreitet.
Es ist ein großer Mann im schwarzen Wollmantel, mit schwarzer Stoffhose und schwarzen Lederschuhen.
Das alles registriere ich in nur wenige Sekunden, ehe ich bemerke, dass der Fremde stehen bleibt und sich langsam zu mir umdreht.
Das ist es jetzt, Cammy, geht es mir schlagartig durch den Kopf.
„Erschießen Sie mich bitte nicht“, presse ich hervor, in meiner Stimme schwingt lautstark die Angst mit, und ich hebe die Hände; dabei versuche ich, ihm in die Augen zu sehen.
Nur leider kann ich sein Gesicht nicht erkennen, er steht außerhalb des Lichtkegels der Straßenlaterne – und das vermutlich mit voller Absicht.
Es sieht aus, als verschmelze er mit der Dunkelheit, nur die herabfallenden Schneeflocken lassen eine große Silhouette erkennen.
„Du solltest die Straßenseite wechseln.“ In seiner Aufforderung schwingt eine dunkle Warnung mit, die mir einen Schauer über den Rücken jagt.
Dann wendet er sich ab und geht weiter, als wenn nichts wäre.
Erleichtert atme ich die Luft ein, meine Unterlippe zittert, aber ich lebe.
Ich spüre die Kälte, die durch die Stiefel dringt und meine Beine hochkriecht, Wölkchen bilden sich vor meinem Mund, die vom warmen Atem herrühren.
Nur widerwillig bewege ich mich weiter, aber wenn ich nicht erfrieren will, muss ich mich fortbewegen, in diesem Fall so weit wie möglich weg von der Gasse. Weg von den Männern, weg von dem Mann mit der Pistole.
Ich schaue schnell nach rechts und links, aber die Straßen sind wie ausgestorben. Die Autos, die am Straßenrand parken, sind vom weißen Schnee bedeckt, genau wie der dreckige Asphalt der Straße.
Ich überquere die breite Straße ohne auszurutschen und atme erleichtert auf, als ich den Gehweg erreiche. Ich schlinge meinen Kaschmirschal ein weiteres Mal um den Hals, obwohl ich ihn mir am liebsten um den Kopf wickeln würde, nur um mich zu verstecken und klein zu machen.
Ich werfe einen Blick auf meine Rolex und seufze. Es ist halb eins in der Nacht, der Schneefall wird stärker, und ich werde wohl zehn Minuten länger als sonst brauchen – bei dem Wetter.
Ein weißer Lieferwagen biegt langsam um die Kurve auf meine Straße ab, die Scheibenwischer arbeiten konstant daran, die Frontscheibe freizuhalten.
Erstaunlich, dass jemand freiwillig mit dem Wagen unterwegs ist. Ich gähne, die Kälte verstärkt meine Müdigkeit, und ich beschleunige meinen Gang.
Ich will ins Warme.
Im Augenwinkel bemerke ich, dass der Lieferwagen langsamer wird. Ob er ein Problem hat?
Ich drehe neugierig den Kopf, um zu sehen, was da los ist …
Oh nein! „O mein Gott“, flüstere ich erstickt. „Hilfe.“ Erst leise, dann lauter, panischer: „HILFE!“
Zwei vermummte Gestalten springen aus dem Lieferwagen, ein dritter Mann schiebt im selben Moment die hintere Schiebetür auf.
„HILFE! HILFEEEE! NEIN, NEEEIIIN!“ Ich schlage die Arme um mich, kann mich aus den Griffen befreien und stolpere durch den Schnee. Adrenalin puscht meine Kräfte, ich spüre, wie Hitze in mir aufwallt, wie mein Herz donnert und das Blut durch meine Körper pumpt.
Ich pfeffere meine Fäustlinge weg, die nicht nur meine Schläge, sondern auch mein Kratzen stark beeinträchtigen würden.
Ich höre Flüche und ein unterdrücktes Knurren, als ich einem der Kidnapper meinen Ellenbogen in die Magengegend ramme.
„Verfluchtes Miststück“, presst er zwischen den Zähnen hervor und zieht mir brutal an den Haaren. Tränen schießen mir in die Augen, dann sehe ich Sternchen, als mich ein Schlag mit der flachen Hand ins Gesicht trifft.
Ich sinke in den Schnee, fühle mich vom Schlag benebelt, doch der Flucht- und Lebensinstinkt sind stärker, als ich es je für möglich gehalten habe. Ich robbe durch den Schnee, ziehe mich an einer Straßenlaterne hoch und stoße mich von ihr ab, als wäre ich ein Profischwimmer, der sich am Ende einer Bahn im Schwimmbecken von der Wand abstößt, um die nächste Bahn zu beginnen.
Die Prada-Stiefel habe ich extra für den Winter gekauft, wenn es schneit und bereits knöchelhoher Schnee liegt, weil deren Sohlen nicht nur dick sind, sondern auch tiefe Rillen haben, um eine Art Grip zu haben, damit ich nicht wegrutsche.
Und doch rutsche ich, blind vor Panik, mit den Stiefeln weg. Zwar falle ich nicht hin, aber es beeinträchtigt enorm meine Flucht nach vorn.
Die Kidnapper sind schneller. Ich sollte sie fragen, welche Schuhe sie tragen, schießt es mir unpassender Weise durch den Kopf, als mir jemand einen Jutebeutel über eben diesen stülpt.
Erneut versuche ich zu schreien, zapple wie ein Fisch auf dem Trocknen, als die Schnur, die an der Öffnung des Beutels vom Hersteller eingefädelt worden ist, zugezogen wird.
Ich schluchze, ersticke an meinen Schreien, die der Sack absorbiert, atme den Geruch von Gemüse ein, das einst darin transportiert worden ist. Ich werde von den Füßen gerissen, während einer seine Unterarme um meinen Brustkorb schlingt.
Es kann sich nur noch um Sekunden handeln, bis ich den kalten Boden des Lieferwagens unter mir spüren werde und die Schiebetür zugezogen wird, was mich endgültig von der Außenwelt abschotten wird.
Einer Ohnmacht nahe, versuche ich mich freizustrampeln, aber die Kidnapper haben keine Geduld mehr, ihre Griffe werden härter, brutaler.
„Rein mit ihr“, bellt einer mit Aggression in der Stimme – für den Bruchteil einer Sekunde fühlt es sich an, als würde ich fliegen, ehe ich hart auf dem Boden aufknalle. Ich stöhne und würge, greife hoch zu dem Sack, doch im selben Moment werden meine Arme nach hinten gerissen, als sie genauso schnell wieder losgelassen werden und ich ein dumpfes Aufschlagen neben mir wahrnehme.
Stocksteif verharre ich in der unbequemen Haltung, so als hätte ich bei der geringsten Bewegung Angst, wieder die ungestörte Aufmerksamkeit der Kidnapper zu erhaschen.
Es ist still, so ohrenbetäubend still, dass ich mir unsicher bin, den Jutesack wirklich vom Kopf ziehen zu wollen, aber ich riskiere es. Wenn ich weiter so verharre, werde ich an der Kälte zugrunde gehen.
Ich blinzle, als würde mich ein Licht blenden, weil ich nicht glauben kann, was meine Augen da vor sich liegen sehen.
Ich beuge mich über den Mann und versuche zu verstehen, was passiert ist. Mit zittrigen Fingern greife ich am Bund der Skimaske und keuche, als ich die kalte Haut seines Gesichtes unweigerlich berühre.
Mein Herz pocht in meiner Brust, als ich die Maske immer weiter hochziehe, sodass auch schon die Nasenspitze freiliegt, als ich mich wundere, dass meine Finger etwas Warmes und Feuchtes ertasten.
In Zeitlupe nehme ich die Hand weg und hebe sie hoch zu meinem Gesicht, spüre, wie mir das Blut in den Adern gefriert, als ich es urplötzlich hinter mir rascheln höre.
„Du hattest Glück, dass ich in der Nähe war“, knurrt ein Mann hinter mir.
Der Fremde.
Es ist der Fremde von wenigen Minuten zuvor, dem ich auf der anderen Straßenseite begegnet bin, der eine Pistole in der Hand gehalten hat. Er hat sie getragen wie andere Einkaufstüten tragen. So selbstverständlich.
„Ja“, hauche ich. Soll ich Angst verspüren? Vor dem Mann, der mich gerettet hat? Immer noch knie ich auf dem Boden, vor einem der Kidnapper, der ein Loch in seiner Schläfe hat. Er hat ein Loch im Kopf. Im Kopf, da ist ein Loch.
Ich würge. Mir wird soeben bewusst, dass ich vor einer Leiche knie, der ich versucht habe, die Skimaske abzunehmen. Ich würge erneut.
„Das darf nicht wahr sein“, höre ich den Fremden knurren, und dann springt er in den Wagen.
Ich schlage nach ihm, eher ein schwacher Versuch, weil das Würgen nicht aufhören will, und dann bekommt er doch meinen Arm zu packen und bugsiert mich unsanft aus dem Lieferwagen.
„Atme, ja, genau so, tief ein- und ausatmen … gutes Mädchen“, höre ich ihn sagen, während ich mich an die Straßenlaterne klammere und seinen Anweisungen Folge leiste.
Er streichelt mir über den Rücken, sanft und behutsam, während dicke Schneeflocken auf uns herabrieseln. Erst als ich wieder normal atmen kann, spüre ich die eiskalte Stange der Laterne unter meinen Fingern und reiße meine Hände weg, ehe sie noch anfrieren.
„Geht’s wieder?“ Seine Frage klingt aufrichtig.
Ich nicke. „Denke schon.“ Ich werfe ihm einen Blick über die Schulter zu und zucke zusammen, weil er näher steht, als ich es angenommen habe.
Langsam drehe ich mich zu ihm, studiere dabei sein Gesicht, das ich im Schein der Laterne besser sehen kann, aber es ist nicht hell genug, um seine Augenfarbe erkennen zu können. Es reicht schon, dass er mich auch studiert und meine Bewegungen in sich aufnimmt, als wäre er ein Raubtier.
Die dicken Schneeflocken sammeln sich auf seinem schwarzen Wollmantel, was seine breiten Schultern unterstreicht, sie legen sich auf seine dunklen Haare, die sie noch dunkler erscheinen lassen, sie wirbeln um ihn herum, sodass sie seine eh schon dunkle Aura noch dunkler erscheinen lassen.
Was so ein einfacher Schneefall bewirken kann, schießt es mir durch den Kopf.
Ich stecke meine Hände in den Mantel, die sich wie Eisklumpen anfühlen. Verstohlen sehe ich mich nach meinen heißgeliebten Fäustlingen um, die innen mit Lammfell ausgestattet sind. Doch nirgends kann ich sie entdecken, zumal der Fremde mich nervös macht, da er sich nicht rührt und mich ununterbrochen anschaut.
Wo zum Teufel sind meine Fäustlinge?
Der Fremde macht einen Schritt, dann noch einen ... und noch einen.
„Boss, keine Ausweise, gar nichts. Die haben nichts dabei.“ Erschrocken reiße ich den Kopf hoch.
Dunkle Gestalten kommen um den Wagen herum und treten aus dem Schatten, dabei fixieren sie mich mit ihren Augen. Es sind abschätzige Blicke.
„Ich werde jetzt nach Hause gehen … ich brauche eine heiße Dusche, weil es ziemlich kalt ist. Es schneit ja … wie Sie selbst sehen können“, stottere ich und gebe mir eine imaginäre Ohrfeige. „Ich danke Ihnen, dass Sie mir geholfen haben. Ich sollte vermutlich die Polizei rufen …“ Ich verstumme abrupt, als er langsam den Kopf schüttelt.
„Keine Polizei.“ Seine Stimme ist leise, aber warnend.
„Nicht?“ Im Grunde habe ich es schon geahnt, dass Polizei nicht besonders gut bei dieser Art von Männern ankommen wird.
Wieder macht er einen Schritt und bleibt ganz dicht vor mir stehen. Ich erhasche einen Blick auf seinen Hals, den der hochgekrempelte Kragen nicht verdeckt, erkenne vereinzelte Bartstoppeln, die dichter werden, je weiter ich hochschaue bis ich an seinen Lippen hängen bleibe. Ich blinzle, um mich von seinem Mund loszureißen.
Ich schlucke trocken und versteife mich, als er seinen Kopf beugt. „Wie wäre es denn mit einem Dankeschön?“, flüstert er mit einem trockenen Unterton.
„Danke“, hauche ich und ziehe eine Braue hoch, als mir sein Lächeln eine Spur zu dreckig erscheint.
Ich hebe instinktiv die Hände, um ihn abzuwehren, und doch kommt sein Kuss unerwartet. Er überrumpelt mich, seine Hand in meinem Nacken fühlt sich erstaunlich warm an. Und sie verhindert, dass ich meinen Kopf wegdrehen kann.
Ohne auf eine Einwilligung zu warten, drängt er seine Zunge in meinen Mund und erobert ihn, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt, einer Frau die Zunge in den Hals zu rammen.
Und doch muss ich zugeben, dass er ein verdammt guter Küsser ist. Anstatt ihn von mir zu stoßen, kralle ich mich an seinem Mantel fest. Meine Gefühle fahren Achterbahn, mir ist zum Weinen und zum Schreien zumute, ich spüre, wie Adrenalin erneut meinen Körper durchflutet und ich heiße Lust verspüre. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich den Kidnappern habe entkommen können und mein Retter in der Not dagewesen ist.
Ich dränge mich an seinen Körper, schlinge die Arme um seinen Hals, während Schneeflocken um uns umherwirbeln, als würden wir ein romantisches Fotoshooting für den Winter machen wollen.
Erst da bemerke ich, dass ich auch irgendwo meine Ohrenschützer verloren habe, als seine andere Hand sich in mein Haar vergräbt, das mittlerweile vom Schnee durchnässt ist.
Ich atme seinen Duft ein, der vom Herrenparfum behangen ist und meine Sinne beflügelt. Ich keuche, als er sich von meinen Lippen löst und ich nach Luft schnappe.
Nur langsam löst er sich von mir, umrahmt mein Gesicht mit seinen Händen und streichelt meine Wangen mit seinen Daumen, die sich rau anfühlen.
„Braves Mädchen“, höre ich ihn murmeln, und er küsst meine Stirn, bevor er sich endgültig von mir löst.
„Meine Männer begleiten dich nach Hause. Ich muss leider weiter.“
Ich fühle mich urplötzlich müde, und meine Beine fühlen sich an, als würden sie keinen Meter mehr laufen wollen.
Meine Unterlippe zittert, weil die letzten Minuten auf mich einprasseln, als hätte ich sie vorhin wie in einem Film erlebt. Weit weg von mir und nicht real.
„Okay“, sage ich und schlinge die Arme um meinen Körper. Ich friere nur noch.
Ich schlucke den Kloß in meinem Hals runter, als der Fremde mich noch einen Moment intensiv studiert, ehe er sich umdreht und verschwindet.
Auch ich drehe mich um, versuche zu ignorieren, dass fremde, breitgebaute Gestalten mich im geringen Abstand begleiten.
Ich stakse am Lieferwagen vorbei und halte abrupt inne, als ich im weißen Schnee blutgetränkte Stellen entdecke, und meine verdammten Ohrenschützer.
„Du solltest dir das nicht weiter ansehen“, warnt mich einer, ohne auch nur einen Hauch von Fürsorge herausklingen zu lassen.
„Ich muss wissen, ob ich die anderen Männer erkenne, die mich entführen wollten“, sage ich grimmig und entschlossen wate ich durch den Schnee, sammle meine Ohrenschützer ein, die mit Blutspritzern besprenkelt sind, wobei auch dieser Anblick Übelkeit in mir hervorruft, und ich umrunde den Lieferwagen, sodass ich auf der Straße zum Halten komme.
Zwei Gestalten liegen neben dem Wagen auf dem Boden, um ihre Köpfe haben sich Blutpfützen gebildet, die der Schnee aufgesogen hat.
Ihnen sind die Masken hochgezogen worden, doch ich erkenne sie nicht. Ich traue mich nicht, noch näher ranzugehen. Ich will nicht nochmal einer Leiche zu nah sein.
„Und? Erkennst du die?“, fragt einer kalt.
„Nein.“ Ich werfe den Kerlen einen eisigen Blick zu. „Ihr braucht mich nicht nach Hause zu begleiten.“
„Der Boss will es so.“ Im Ton höre ich heraus, dass Widerspruch nicht geduldet ist, also halte ich den Mund und mache mich auf den Weg nach Hause.
Obwohl ich Studentin bin, wohne ich nicht in einer klassischen Studenten-WG oder auf dem Campus. Ich habe das Glück in einem eigenen Haus zu wohnen, welches sich auf der Waverly Place befindet. Daddys Liebling muss doch nicht arbeiten.
Ich seufze. Ich habe nie drum gebeten, als Tochter eines reichen Moguls aufzuwachsen, der nicht immer auf legalem Wege Geschäfte macht.
Vor einigen Monaten hat das Schlagzeilen gemacht, und Dank des Internets bin ich recht schnell auf Artikel gestoßen, die über meinen Dad wetterten.
Angestellte haben sich zusammengetan, weil er sie ohne Abfindung entlassen hat. Selbst die, die über Jahre hinweg für ihn gearbeitet haben, haben nicht einen Cent gesehen. Sie verklagen ihn auf Entschädigung – und das in Milliardenhöhe.
Tatsächlich glaube ich den Angestellten sofort.
Aber mein Dad wäre nicht mein Dad, wenn er das nicht zu verhindern wüsste.
Ich seufze.
„Alles gut da vorne?“
„Alles bestens“, brumme ich. In der Tasche krame ich nach meinem Haustürschlüssel und bleibe vor der Pforte stehen.
Beide pfeifen durch die Zähne. „Hier wohnst du?!“
„Du musst ganz schön Kohle haben.“
„Die Kleine wird doch kein Geld haben …“
„Also glaubst du, sie hat eine reiche Mummy und einen reichen Daddy?“
„Würden Sie bitte still sein?!“, fauche ich. „Und danke, dass Sie mich nach Hause gebracht haben.“
Ich schließe das aus Eisen bestehende Törchen auf, das ich vor der Haustür habe aufstellen lassen, und knalle es mit Wucht zu. Der Aufprall ins Schloss ist zu hoch, sodass es wieder herausspringt und wieder aufschwingt. Ich seufze entnervt, schließe es mit einer Engelsgeduld und stürze fast auf den drei Stufen, die sich vor meiner Haustür befinden.
Die Männer kommentieren es nicht, wofür ich insgeheim dankbar bin; ich schließe mit fahriger Bewegung die Tür auf.
Ohne durch den Spion schauen zu müssen, weiß ich, dass sie sich auf den Weg gemacht haben. Irgendwie fühlt sich die Atmosphäre nicht mehr angespannt an. Merkwürdig, wie sehr sich die Balance einer sonst angenehmen Atmosphäre ändern kann, wenn darin plötzlich zwei Gorillas auftauchen.
Erleichtert, dass sie weg sind und ich im Schutz meines Hauses bin, sinke ich von innen gegen die Tür, rutsche sie mit dem Rücken hinab und fange an zu weinen.
Kapitel 2
DeVito
Wie sehr ich den Winter liebe.
Er spielt mir genau in die Hände, kommt mir entgegen, so als würde er mir einen Gefallen tun, indem er es schneien lässt und meine Schritte dämpft, wenn ich mich einem Opfer nähere.
Der Schnee auf den Straßen, auf dem Gehweg, auf den Wiesen im Park, überall da, wo ich langgehe, verschluckt die Geräusche.
Menschen bleiben lieber zu Hause, verhüllen sich in Schichten warmer Kleidung, so wie ich auch. Das kleine Schneegestöber kommt mir sehr gelegen, um mich unbemerkt in der Masse zu bewegen.
So wie in dieser Nacht.
Ich ziehe den Wollmantel über den Anzug, schlüpfe in meine gefütterten Slipper, überprüfe sorgfältig das Magazin, das ich in die Pistole stecke, und verlasse mein Schlafzimmer.
Ich liebe dieses Haus.
Ehrfürchtig lege ich die Hand auf das Treppengeländer mit den unzähligen Macken und dem abgesplitterten Lack, der schon seine besten Jahre hinter sich hat.
Genauso die Wendeltreppe, die nach oben zu mittlerweile Axls Zimmer führt. Es liegt direkt unter dem Dach und war einst mein Jugendzimmer, später nutzte ich es als Abstellkammer.
Wenn ich das Schlafzimmer verlasse und nach links schaue, ist am Ende des Flurs die Wendeltreppe zu sehen, die ich in- und auswendig kenne. Ich kenne die Tücken von einer Wendeltreppe, kenne es, auszurutschen und diese schmerzhaft herunterzudonnern.
Ich muss schmunzeln. Als Kind bin ich ständig durch das Haus gerannt, um mit meinem jüngeren Bruder Verstecken zu spielen.
Ich kenne jeden Winkel dieses prachtvollen Hauses, welches so groß ist, dass es mir als Kind wie ein Schloss vorkam.
Es sind hohe Decken, die man nur noch selten in New York finden wird, umso begehrter ist dieses Haus. Sämtliche Angebote schlug ich in den Jahren aus, und wir wissen alle, dass die Preise in den Jahren explodiert sind.
Der Stuck an den Wänden löst eine Ruhe in mir aus, keinen inneren Frieden – den verspüre ich nicht mehr, seit ich meinen toten Bruder nach einem Afghanistaneinsatz beerdigen musste.
Die Briefe, die ich von ihm über die Monate hinweg bekam, kann ich immer noch nicht in die Hand nehmen und lesen, ohne dass sich ein Kloß im Hals bildet.
Diese Briefe, die von einer Liebe herrühren, die ich nicht nachvollziehen kann. Und doch hat mein Bruder einen Mann geliebt, dem er überall hin gefolgt wäre.
Eines Tages werde ich diesen Mann finden und ihn töten.
Ich werde ihm eine Bombe um den Hals schlingen und ihn in die Luft sprengen, genauso wie mein Bruder sterben musste.
Meine Finger schmerzen, als ich das Treppengeländer zu fest umklammere, und ich lasse los. Meine Nasenflügel blähen sich auf, meine Ader auf der Stirn pocht, und das wiederum verursacht Kopfschmerzen.
Es gibt viele Ursachen für meine Kopfschmerzen, und unnötigerweise verursachen sie auch Menschen, die den geliehenen Kredit nicht zurückzahlen können oder wollen.
Eher zufällig bin ich in diese Branche gerutscht, aber ich habe das Beste draus gemacht, und im Grunde kann ich mich mit meinen dreiunddreißig Jahren zur Ruhe setzen.
Aber was dann?
Ich habe keine Frau, keine Kinder, keine Familie. Wozu mich zur Ruhe setzen, wenn ich all das nicht habe?
Seit dem Tod meines Bruders ist das Gefühl von Einsamkeit besonders schlimm. Die Brustschmerzen begleiten mich dumpf wie die Kopfschmerzen. Eher unbewusst reibe ich mir über die Brust, atme tief durch, und ich betrete die letzte Stufe, die direkt in den Eingangsbereich endet.
Ich seufze, als ich die nassen Fußspuren im Eingangsbereich sehe, die meine Männer mit ihren vom Schnee bedeckten Schuhsohlen verursachen, ohne diese richtig abzutreten.
Ich schüttle den Kopf. Wie gut, dass ich den Läufer schon vor langer Zeit entfernt habe.
„Hey, Boss“, grummeln die Jungs, als ich die Küche betrete, während sie sich Sandwiches machen und überall Mayonnaise verteilen. Ich seufze erneut.
„Auch ein Sandwich?“, fragt mich Axl, dessen rote Haare zu einem Knoten gebunden sind und in dessen bauschigem Bart sich schon Krümel verfangen haben.
Seine hellbraunen Augen schauen mich scharf an, als ich nur grimmig den Kopf schüttle. „Alles gut?“
„Ja.“
„Deine Kopfschmerzen?“
Jetzt hält auch Wulf inne, der vom Sandwich aufblickt und die Stirn krauszieht. „Sollen wir das für heute abblasen?“
„Esst auf, und dann gehen wir“, presse ich hervor, mogle mich an ihnen vorbei und husche durch die gläserne Schiebetür, die von der Küche in den beschneiten Garten führt. Ein eisiger Wind pfeift mir um die Ohren, und doch ist es allemal besser als in der überheizten Küche.
Ich weiß, dass Axl und Wulf mich beobachten, aber klug genug sind, mich in Ruhe zu lassen, besonders dann, wenn ich immer noch die Waffe in meiner Hand habe.
Man weiß nie, wann sich so eine Waffe entleert, und dann möchte man auch nicht in Schussweite sein, wenn der Boss so drauf ist wie jetzt.
Ich drehe mich um, als jemand von innen gegen die Scheibe klopft. Es ist Axl, der mir signalisiert, dass sie abfahrbereit sind.
Stumm stakse ich ums Haus, an den einst schönen Rosenbeeten vorbei, zur Haustür, die soeben aufgerissen wird, als ich die vier Stufen hoch zur Tür laufe und kräftig die Schuhe auf der harten Fußmatte abtrete. Auf keinen Fall will ich unnötig viel Schnee ins Haus tragen.
Im Eingangsbereich steht eine alte Kommode, die durchaus dem heutigen Chic entspricht, obwohl es von mir nicht gewollt ist. Ich habe dieser Kommode nie einen neuen Anstrich verpasst, dadurch wird sie oft als shabby bezeichnet, und man hat mich des Öfteren gefragt, wo ich diese Kommode denn herhabe.
Sie muss einst blütenweiß gewesen sein, aber meine Großeltern hatten sie über Jahre in der Garage gelagert, wo sie den Witterungsverhältnissen ausgesetzt war. An manchen Stellen ist das Holz aufgequollen und gesplittert, an den Ecken ist der Farbüberzug schon lange ab, so wie auch an den Füßen.
Ich ziehe eine kleine Schublade auf, in der sich ein schmuddeliges schwarzes Notizbuch befindet. Ein Kugelschreiber mit schwarzer Tinte haftet am Büchlein, den ich nur abnehme, um Namen von der Liste zu streichen.
Ich nehme es aus der Schublade heraus und stecke es in die Innentasche meines Mantels, dann breche ich mit meinen Männern auf.
„Schaut, da ist er“, macht uns Wulf auf den Mann aufmerksam, der besonders klein und dicklich durch seinen viel zu langen Mantel wirkt.
James Cameron.
Nein, natürlich nicht der namenhafte Regisseur, der unter anderem für Titanic verantwortlich ist. Er ist lediglich ein Namensvetter, der nicht mal annähernd so erfolgreich ist wie der weltweit bekannte Regisseur.
Er ist ein einfacher Mann und fristet sein Leben als Büroangestellter, der gerne sein Geld für Glücksspiele ausgibt. Nicht nur, dass er Schulden bei Freunden hat, weil er ständig beim Pokern verlor, nein, das Pokern im Freundeskreis hat ihm nicht mehr ausgereicht, und es kam, wie es hat kommen müssen.
Er ist in eine meiner Pokerrunden gerutscht – und hat auch da verloren.
Nach mehreren – nennen wir es – Abmahnungen haben wir einen Teil des Geldes, aber eben nicht alles. Zwar nützt er mir nichts, wenn er tot ist, aber er ist überall so hoch verschuldet, dass ich nie wieder mein Geld sehen werde, obwohl er sein Haus schon verkauft hat.
Ich muss die Augen schließen, meine Kopfschmerzen bleiben hartnäckig, und ich beschließe, dass die beiden schon mal vorausgehen sollen, nachdem Wulf den Wagen etwas abseits geparkt hat.
Wie auf Kommando springen sie aus dem Wagen und verfolgen den armen Versager, kurz darauf stoße auch ich die Wagentür auf und stapfe durch den Schnee.
Es ist recht still, was mir durchaus entgegenkommt, wenn man bedenkt, dass in der Nähe einige Bars sind, die gerne von Studenten aufgesucht werden. Umso überraschter bin ich, als ich nicht einer betrunkenen Gruppe über den Weg laufe, sondern nur einer einzelnen Person: eine junge Frau, die einen Schritt nach dem anderen macht, um nicht auszurutschen.
Ihr weißer Mantel mit dem dicken Pelzkragen sieht sehr edel aus, er wird teils von ihren dunklen Haaren bedeckt.
Ich schüttle innerlich den Kopf angesichts ihrer flauschigen, weißen Ohrenschützer. Na, wenigstens hat sie keine weißen Stiefel an, sondern dezent schwarze, die mit ihrer schwarzen Hose verschmelzen und bis zu den Knien reichen.
Der dunkle Riemen ihrer Handtasche hebt sich deutlich von ihrem Mantel ab, die Tasche selbst trägt sie vorne, und sie klatscht ihr gegen den Oberschenkel.
Axl und Wulf sind schon an ihr vorbeigerannt, vermute ich, weil ihre Schritte sich deutlich verlangsamt haben, beinahe unsicher wirken.
Ich sehe, wie es in ihrem Kopf rattert und sie die möglichen Gefahren abwägt, unterdessen nähere ich mich ihr, mir durchaus bewusst, dass ich die Waffe in meiner Hand halte und wenige Zentimeter an ihr vorbeigehe.
Ich muss lächeln, weil ich oft in Menschen eine ängstliche Reaktion hervorrufe, so wie bei der jungen Frau, die mich mit großen Rehaugen anstarrt, als wäre ich die Lichtkegel eines herannahenden Autos.
Sie hebt die Hände, fleht mit zitternder Stimme, ich solle sie bitte nicht erschießen.
Es hat kein Zweck, wenn ich ihr sage, dass ich das nicht vorhabe und sie keine Angst vor mir haben braucht. Wenn Menschen in diesem Zustand sind, rauscht es in ihren Ohren, und sie verstehen nicht, was ich sage.
Ihre Augen huschen über mein Gesicht, versuchen instinktiv Augenkontakt mit mir aufzunehmen, doch der Schein der Laterne geht mir nur bis zur Brust.
„Du solltest die Straßenseite wechseln“, warne ich sie aus einem Impuls heraus, drehe mich um und gehe zur Gasse, dabei grinse ich wieder, weil es mir irgendwie Spaß bereitet, ihre Angst auszukosten.
Ich schraube den Schalldämpfer auf meine Waffe, rolle den Kopf von links nach rechts, sodass meine Wirbel knacken, und ich betrete die Gasse, in der schon Wulf und Axl den armen James in die Mangel genommen haben.
„Und, hat er das Geld?“, frage ich, obwohl ich die Antwort schon längst weiß.
„Nein … bitte … ich mache alles, nur erschieß mich nicht! Bitte! Nicht …“ Die Kugel in seinen Kopf lässt ihn verstummen und er sackt zusammen.
Wulf und Axl schauen hoch zu den Wohnungen, vergewissern sich, ob wir nicht doch beobachtet worden sind und sich eine Gardine bewegt oder der Spalt zwischen den Lamellen eines Rollos von Daumen und Zeigefinger auseinandergehalten wird.
Dann hören wir Schreie.
Wir reißen ruckartig unsere Köpfe rum, schauen zur Straße, als könnten wir durch die Schneeflocken hindurchsehen.
Wir wechseln Blicke und nicken. Dann wollen wir uns das mal näher ansehen.
In diesem Moment sehe ich, wie die junge Frau brutal gepackt wird und um den Lieferwagen gezerrt wird. Zeitgleich steigt einer in die Fahrerkabine.
Wir wissen, dass wir keine Zeit verlieren dürfen. Axl ist der erste, der den Wagen erreicht und den Mistkerl mit der Maske herauszerrt, Wulf gibt ihm Rückendeckung, als ein zweiter herbeieilt.
Die kommen zurecht, sodass ich mich um die Unbekannte kümmern kann.
Ich halte die Waffe, an die immer noch der Schalldämpfer geschraubt ist, in beiden Händen und rücke vor. Dabei halte ich mich eng an der Rückseite des Wagens.
Aus dem Innern des Wagens rumpelt es, ein erstickter Laut ist zu hören, den ich ihr zuordnen kann, während der Kidnapper laut flucht.
Ich presche vor. In nur wenigen Sekunden muss ich die Situation erfassen und eine Entscheidung treffen, die mir recht schnell und leicht fällt.
Ich sehe sie mit einem Sack über dem Kopf auf dem Boden knien, während der Mistkerl versucht, sie zu fesseln.
Es ist der Bruchteil einer Sekunde, in der er mir in die Augen schaut und weiß, dass er hier und jetzt sterben wird.
Er krümmt sich zusammen, der Schmerzensschrei bleibt ihm im Hals stecken, als ich ihm erst in den Bauch schieße und dann in den Kopf.
Er prallt wie ein schwerer Sack auf dem Boden auf, zum Glück direkt neben und nicht auf ihr.
Es kehrt Ruhe ein, auch auf der anderen Seite ist es still geworden.
Bevor ich in den Wagen steige, schraube ich den Schalldämpfer ab, und zusammen mit der Pistole verschwindet sie an meinem Rücken in den Hosenbund.
Bei kleineren Einsätzen habe ich selten den Pistolenhalfter dabei, doch jetzt wünsche ich ihn mir herbei.
Ich spüre, wie die eisige Kälte des Winters sich an den Stahl geheftet hat und nun am unteren Rücken durchs Hemd ausgestrahlt wird.
Ich will in den Wagen steigen, doch es ist dieser Augenblick, den sie braucht, als sie sich den Sack vom Kopf zerrt. Ihre Haare sind statisch aufgeladen, ihr weißer Mantel ist dreckig. Doch all das nimmt sie nicht wahr, weil sie den Toten entdeckt hat.
Ihre Finger zittern. Kälte und Adrenalin brodeln durch ihre Venen.
Vorsichtig nähert sie sich ihrem Kidnapper und zieht die Maske Stück für Stück hoch. Und in der ganzen Zeit bemerkt sie mich nicht, worüber ich nur den Kopf schütteln kann, und ich werde ungeduldig.
„Du hattest Glück, dass ich in der Nähe war“, brumme ich, und jetzt habe ich ihre ungeteilte Aufmerksamkeit.
„Ja“, bestätigt sie meine Aussage, aber sie steht völlig neben sich. Sie schaut wieder den Toten an und dann ihre Hand. Ihre Finger glänzen rot vom Blut des Toten. Dann würgt sie. Urplötzlich. Sie kniet immer noch auf dem Boden, ihre Hände stützt sie auf ihren Oberschenkel ab, ihr Mantel färbt sich rot, weil es sich von ihren Fingern auf den Stoff überträgt.
„Das darf nicht wahr sein!“ Ich springe in den Wagen, packe ihre Oberarme und ziehe sie hoch. Sie macht keinerlei Anstalten, sich zu wehren, stattdessen würgt sie weiter, während ich sie herausbugsiere.