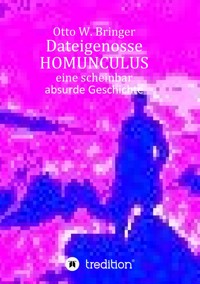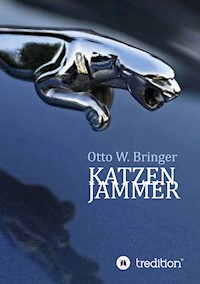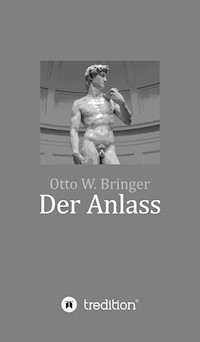Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kein Ereignis, kein Gedanke in diesem Buch, der nicht fesselt, erkennen lässt: Enis Rôm ist einer, der anders ist, als Sohn von Zigeunern, die die Gesellschaft verachtet und diskriminiert. Anders, weil er nicht darunter leidet. Als Sechsjähriger spielt er perfekt die Geige. Mit achtzehn ist er überzeugt, dass Musik die Menschen toleranter macht. Das Studium am Mozarteum in Salzburg besteht er mit Summa cum Laude. Immer schon reizte ihn Neues, machte er sich Gedanken; über alles, was er täglich erlebte, in Büchern las. Zweifel an Gott und Religion, Liebe und Eifersucht treiben ihn um. Er schreibt alles auf, um sich selbst zu vergewissern: die Grundlage dieses Buches. Leser die Musik lieben. vom hilosophischen, religiösen Fragen bewegt werden, von Gewissenkonflikten gequält sind, kommen voll auf ihre Kosten. Es geht um die Beziehung zwischen Mann und Frau, Sehnsucht, endlich ein Zuhause zu haben. Und um die Angst eingesperrt und getötet zu werden - von den Nazis. Weil Anderssein für sie ein Grund ist, ganze Völker umzubringen. Er hat den Vater im KZ sterben sehen und weiß, er kann der Nächste sein. Wer kann, rette sich selber.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 603
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Otto W. Bringer
Weil wir anders sind
Tagebuchnotizen eines hoch
begabten und ehrgeizigen
Zigeunerjungen nacherzählt
Imprint
Otto W. Bringer
Weil wir anders sind
Copyright: © 2019 Otto W. Bringer
Umschlag u. Fotobearbeitung: Otto W. Bringer
Konvertierung: Sabine Abels – www.e-book-erstellung.de
Ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung, die über den Rahmen des Zitatrechtes bei korrekter vollständiger Quellenangabe hinausgeht, ist honorarpflichtig und bedarf der schriftlichen Genehmigung des Autors.
Wer bin ich? Wie sehen mich andere?
Laut Melderegister in Österreich heiße ich Enis Badžo. So steht es tintenblau auf Weiß in den Akten. Und auf dem Papier, das wir immer bei uns haben müssen. Abgestempelt und bestätigt von einem gewissen Herrn Myrhff, wenn ich es richtig entziffert habe. Ja, diese Art Unterschriften sind wichtig in einem Beamtenstaat. Unleserlich, mit so viel Schnörkeln, als wollten sie einen Schreibkunstpreis gewinnen. Aber unleserliche Hieroglyphen. Woher ich dieses Wort habe? In Wien besuchte ich vor kurzem eine Ausstellung über Ägypten. An einem Tag der offenen Tür, der Eintritt gratis. Auf großen Tafeln stand, was eine Mumie ist und die Schrift darunter bedeutet. Diese für uns unlesbaren Schriftzeichen nennt man Hieroglyphen.
Meine Eltern sind Roma. Bin ihr einziges Kind. Einer von denen, die man hier Zigeuner nennt. Weil sie anders aussehen. Nicht in Häusern wohnen. Von Land zu Land ziehen, von Ort zu Ort, eine Heimat zu finden. Blicke ich in den Spiegel, erkenne ich den typischen Roma. Meine Haut nicht weiß, sondern dunkel. Nicht wie die von Afrikanern, die man Schwarze nennt. Heller wie gebrannte Siena auf der Künstlerpalette. Oder gegerbtes Leder von Tierhäuten. Meine Augen sind Dunkel. Von einem Schwarz, das leuchtet von innen her. Die Haare schwarz, mal lang wie sie wachsen. Mal kürzer geschnitten. Rasiert habe ich mich noch nicht wie mein Papa. Unsere Sprache ist anders. So anders, dass wir uns nur untereinander verständigen können. Deshalb lernen wir die Sprache des Landes, in dem wir ankommen auf unserer Pilgerfahrt.
Ja, unterwegs sein ist unser Leben. Nur vage ein Ziel vor Augen: Ankommen, wo auch immer es sei. Ankommen und bleiben dürfen. Pilgern jedes Jahr nach «Saintes-Maries-de-la-Mer» an der Rhone-Mündung. Ein symbolträchtiger Ort. Denn unsere Schutzheilige, die «Schwarze Sara», wie wir dunkelhäutig, liegt dort begraben. Floh aus Äthiopien, fand Arbeit in Jerusalem. Diente zwei Jüngerinnen Jesu als Magd. Begleitete sie nach dessen Himmelfahrt auf ihrer Reise bis in dieses Fischerdorf am Mittelmeer. Um von da aus die Franzosen zum Christentum zu bekehren.
Aus vielen Ländern Europas reisen Roma und Sinti einmal im Jahr dort hin. Versammeln sich am 24. Mai vor der Kirche. Beten in der Krypta und schmücken die Statue ihrer Sara mit neuen, selbst geschneiderten Kleidern. Tragen sie in einer langen Prozession* auf den Schultern. Singen «vive la Sara» und «vive les Saintes Maries.» Bis Meereswellen ihre Knie umspülen. Das Meer ist Weg und Ziel im Irgendwo.
Als ich Vierzehn war, begann ich das Schicksal der Roma, das auch meines ist, aufzuschreiben. Es war etwa Mitte Februar 1926, als sich Unerwartetes, Eindrucksvolles ereignete. Beim Herumstromern im Wald entdeckte ich eine Hütte aus Reisig. Kaum erkennbar im dichten Unterholz. Vorsichtig sah ich hinein und entdecke im Schein einer Kerze einen alten Mann. Älter noch als mein Großvater. Schlohweiß sein langes Haar, das bis auf die Schulter fiel. Erfahrung eines langen Lebens in den Falten seines Gesichts. Ein Buch vor sich, in dem er zu lesen schien. Blickte kurz auf und sagte:
„Setze Dich zu mir. Ich werde Dir aus diesem Buch vorlesen, was Du wissen musst. Wenn Du die Welt begreifen willst. Gott hat das Universum erschaffen, den Himmel und die Erde. Der Himmel aber ist weit weg. Wir Menschen können nur glauben, dass es ihn gibt – oder nicht. Die Erde aber müssen wir verstehen und gestalten nach unseren Vorstellungen. Damit wir auf ihr und von ihr leben können. Voraussetzung dafür ist, alles zu studieren, was auf der Erde, in der Luft und im Wasser lebt. Sich ständig verändert und doch immer dasselbe bleibt. Apfel ein Apfel. Meise eine Meise. Forelle eine Forelle. Mensch ein Mensch. Übrigens das einzige Lebewesen, das gut mit schlecht verwechselt. Und umgekehrt. Wenn es für ihn von Vorteil ist.
Von allem gibt es Bücher, die weise Männer geschrieben. Ich lese gerade eines von Nostradamus, der im Frankreich des 16. Jahrhunderts lebte. Zahllose Gedichte schrieb, das Evangelium deutete, die Gleichnisse. Unwetter vorhergesagt und den Untergang der Welt im Jahre 1999. Das zweite Jahrtausend wird nicht zu Ende gehen, wenn dies geschieht. Ein Menschenleben noch bis dahin. Du kannst es glauben oder leugnen. Dich darauf vorbereiten oder nicht. Du wirst es vielleicht erleben. Ich nicht. Bis dahin habe ich längst das Zeitliche gesegnet.
Lehrreich auch Nostradamusʼ Erkenntnisse als Arzt und Apotheker. Kurzum, es gibt genug Möglichkeiten, sich klüger zu machen als die meisten Menschen. Obwohl sie, Gott sei ʼs geklagt, sich für die klügsten aller Lebewesen halten. Ohne je ein Buch gelesen zu haben.
Mein Rat an Dich: besorge Dir so viele Bücher wie Du kannst. Auch Du kannst nie genug wissen. Um am Ende zu begreifen: der Mensch ist das, was er weiß. Und aus diesem Wissen das Beste macht. Schreib auf den Sinn dessen, was Du gelesen hast. Erst mit deiner Hand geschrieben wird es zum Gesetz, dem du folgen musst. Willst Du Dich selbst nicht verraten. Vergiss nicht, Dir eigene Gedanken dazu zu machen. Ein jeder hat seine eigene Auffassung von der Welt. Vergleiche und überprüfe Deine jeden Tag, den Du lebst. «Erkenne Dich selbst» galt schon vor fast dreitausend Jahren im antiken Griechenland. Am Fries des Tempels von Delphi in Stein gemeißelt. Nur dann kannst Du anderen gerecht werden.“
Taumelte nachhause, verwirrt und glücklich. Ich werde in Buchhandlungen nach ausrangierten Büchern suchen, weil sie fast nichts kosten. Den Verkäufer nach den interessantesten fragen. Über das Weltall, die Gestirne, Menschen, Völker und ihre Geschichte, das Leben der Tiere. Und alles, was es über Musik gibt. Ich werde sparen wo ich kann. Taschengeld nur noch für Bücher ausgeben. Meine Eltern bitten, mir Geld zu schenken statt neue Stiefel. Nachbar Schabo kann die alten flicken und ich mir ein, zwei Bücher kaufen. Und tausend Blatt weißes Papier, Bleistifte jede Menge. Nie werde ich diesen Satz vergessen: kaufe Bücher so viel du kannst und schreibe auf, was du gelesen und daraus gemacht hast.
Jetzt ist mein Blick für Gedrucktes wach. Unbekanntes wird bekannt werden. Geträumtes wirklich. Die Chance, Neues kennenzulernen, fasziniert mich. Sie wird mich zu den verrücktesten Ideen inspirieren. Visionen, die mein Leben erst lebenswert machen. Ob sie jemals Wirklichkeit werden, weiß ich nicht. Aber träumen von Möglichkeiten ist schöner als alles, was wirklich ist. Mögen andere mich auch für einen Spinner halten, einen Tagträumer. Oder einen, der sich einbildet, etwas Besonderes zu sein. Nur weil ich die Geige perfekt spiele, seit ich sechs bin?
Ob sie Recht haben oder nicht: Ich ahne, alles ist möglich, wenn ich es mir wünsche: Eines Tages werde ich der beste Geiger der Welt sein.
Bevor ich mit dem Aufschreiben beginne, erinnere ich mich an das, was ich als Kind erlebte. Lernte auf der Geige zu spielen. Spiele sie perfekt seit ich Sechs bin. Sehr gut sogar, wie mir sagen, die mich schon mal gehört. Könnte ein zweiter Niccolò Paganini werden, oder Pablo de Sarasate. Mein Vater konnte das Instrument auf einem Flohmarkt billig erwerben. Schenkte es mir zum meinem sechsten Geburtstag. „Nun übe mal fleißig“, sagte er und sah mich ernst an. „Wir müssen besser sein als die anderen“. Erinnere mich noch genau: Besser muss ich sein.
„Freund Djamel wird dich unterrichten. Er spielt die Geige wie Paganini. Habe ihn zwei Mal pro Woche für zwei Stunden engagiert. Eine Dose Tabak kriegt er dafür.“ Meistergeiger wie Paganini kannte ich nur vom Hörensagen, woher sonst? Bei uns wird nur musiziert und nicht nach Namen von Komponisten oder Solisten gefragt. Die meisten Stücke und Lieder spielen wir schon seit Jahrhunderten. Noten brauchen wir keine, kennen alle unsere Lieder und Tänze auswendig.
Beim ersten Unterricht brachte Djamel ein Notenheft mit. Übungen für Anfänger, sagte er mir. Schrift konnte ich erst ein Jahr später lesen. Meine Mama brachte es mir bei. Aber die Punkte auf dünnen, fünf parallelen Notenlinien fand ich sofort lustig, als ich sie sah. Wie Ostereier am Stiel. Weiße mit und ohne Stiel und schwarze. Tanzten mal rauf, mal runter. Immer im Takt zwischen zwei senkrechten Linien. Allein, zu zweit, zu dritt miteinander verbunden. Lustig fand ich es und lernte, die Finger meiner linken Hand zu bewegen. „Nur die Finger, nicht die Hand“, sagte Djamel. Er spielte es mir vor, bückte sich, damit ich seine Finger von oben sehen konnte. Die Stelle der Saite, auf die er drückte.
In rascher Folge auf eine der vier Saiten. So dass ich jedes Mal einen anderen Ton hörte, strich er mit dem Bogen darüber. Habe sofort herausgehört, dass die dickste G-Saite dunkel klingt, die dünnste E-Saite hell. Dazwischen abgestuft die D- und A-Saite. GDAE wird abgestimmt vor jedem Spiel. Lernte, der Abstand zwischen den Saiten muss exakt fünf Töne der Tonleiter betragen. Quinte sagt man dazu. Muss vor jedem Spiel gestimmt werden. Ohne ein gutes Gehör gelingt es nicht. In der dritten Woche schon konnte ich kurze Stücke in C-Dur und G-Dur sauber spielen. Nach der sechsten kam Djamel nicht wieder. Mein Vater sagte zu mir: „Jetzt gehen wir beide musizieren. Ich auf meinem Akkordeon und Du auf Deiner Geige.“
Mit der Zeit wurde ich besser. Meine Eltern lobten mich, die Freunde. Sogar der Oberlehrer, der ein- oder zweimal in der Woche nach Schulschluss kam. Uns Kinder in Deutsch und Mathematik zu unterrichten. Die deutsche Grammatik zu lehren und den Dreisatz. Zwischendurch ließ er mich ein Lied auf der Geige spielen. Es lockere den Geist, sagte er, macht Spaß zu lernen. Wir lebten damals schon in Österreich nahe Wien.
„I bin der Kränzler Josef“, stellte er sich meinen Eltern vor. „Komme zu Ihnen, alldieweil eure Kinder nicht in die öffentliche Schule dürfen. Gott würde es mir nicht verzeihen, ginge ich nicht zu den Kindern. Umkehrt wie ʼs in der Bibel steht“. Lachte „ha, ha“ und setzt sich auf den einzigen Sessel in unserem Wagen. Hob die rechte Hand wie Jesus im Tempel von Jerusalem, bevor er zu sprechen begann.
Wir hockten zu seinen Füßen, neugierig wie Kinder sind. Bei warmem Sommerwetter fand der Unterricht draußen statt. Saßen im Halbkreis um den Lehrer auf der gemähten Wiese. Er zog Stiefel und Socken aus. Warf sie in hohem Bogen hinter sich. Hielt den rechten Fuß hoch und bewegte seine Zehen, als tippten sie auf Tasten: „Wieviel Zehen hat der Fuß? Ein, zwei, drei, vier und?“ „Fünf!“ Schrien wir.
„Und zwei Füße?“ „Zehn!!!!“
So führte er sich bei uns sechs- bis zwölfjährigen Jungen und Mädchen ein. Wir fanden es lustig und dachten, es ginge so weiter. Noch keine Ahnung, dass lernen arbeiten heißt. Formeln auswendig lernen, den Dreisatz. Korrekt wie nach Noten zu spielen. Gelernt, wann groß oder klein geschrieben. Wo Zeichen gesetzt, wann Zeiten geändert. In Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft. Deutsche Sprache schwere Sprache.
Buchstaben lesen, Wörter, Sätze und ganze Geschichten brachte mir meine Mama bei, als ich Fünf war. So, wie ihre Mutter es bei ihr getan. Sie kaufte ein Heft mit Geschichten von Wilhelm Busch, einen Schreibblock und einen Bleistift. Die Bilder hatte ich sofort verstanden und mich fast tot gelacht. Die Verse musste ich Buchstabe nach Buchstaben lesen. Meine Mama las mir immer zuerst das ganze Gedicht von Wilhelm Busch vor. „Damit Du weißt, um was es geht“.
Mietze eine schlaue Katze – Molly ein begabter Hund – wohnhaft an demselben Platze – hassten sich aus Herzensgrund.
Schon der Ausdruck ihrer Mienen – bei gesträubter Haarfrisur – zeigt es deutlich: zwischen ihnen – ist von Liebe keine Spur.
Wir hatten beide und kannten ihre Art sich zu mögen. „Jetzt lesen wir die Wörter, einen Buchstaben nach dem anderen“. Mama zeigte dann mit der Bleistiftspitze darauf: „Das ist ein em, das ein i, ein e, ein te, ein zet, ein e. Zusammen heißt ʼs Mietze. Dann ließ sie es mich wiederholen, indem ich mit dem Finger darauf zeigte. Zuerst die einzelnen Buchstaben, dann das ganze Wort. Anschließend sollte ich es auf meinen Block schreiben. So konnte ich dem Bleistift folgen und lesen, was ich schrieb. Und endlich wissen, wie die Geschichte in der achten Strophe zu Ende ging. War mächtig stolz, den Inhalt auswendig nachzuerzählen, als Mama meinte, ich solle es mal versuchen.
Viel, viel später dann folgten Balladen von Schiller und Goethe. Vorher bereits, etwa nach einem Vierteljahr, konnte ich schon die Wochenzeitung lesen, Wort für Wort. Auch wenn ich das meiste nicht verstand. Mein Vater kaufte sie für zwei Groschen jeden Samstag am Stadtrand-Kiosk. Auch wenn wir vom Leben der anderen ausgeschlossen waren. Er wollte wissen, was in der Welt geschieht. Vielleicht findet sich sogar ein Artikel über die Roma.
Zurück zum Anfang. Schon bei den ersten Notizen wurde mir klar: Alles ist viel komplizierter als es mir als Kind bewusst war. Nie gespürt, dass wir Fremde sind. Mama und Papa und andere Eltern schützten uns Kinder vor der Außenwelt. Geliebt, umsorgt, unterrichtet. Und schon früh angehalten, ein Instrument zu spielen. Gut zu spielen, um später Geld damit zu verdienen. Erinnere, ich fand es spannend, im Wagen gefahren zu werden. Durch ständig sich ändernde Landschaften. Blieben wir an einem Ort, lief ich über blühende Wiesen. Barfuß, um den Kitzel zu spüren, die Nachtfeuchte am Morgen. Kletterte auf Bäume, um die Welt von oben zu betrachten. Schlösser durften wir nicht betreten. Aber ich bewunderte ihre interessante Architektur. Mit Türmen und Wehrgängen. Wüsste gerne, warum sie rundum Wassergräben angelegt. Sich vor Überfällen zu schützen? Oder züchten sie Fische und Frösche, um den Speisezettel zu bereichern? Den Mann im Häuschen neben dem Tor hielt ich für eine Puppe.
Jetzt erinnere ich auch, dass wir nirgends lange bleiben durften. Einheimische sahen uns scheel an, fuhren wir auf die Märkte in Dörfern, Städten. Um zu musizieren und ein paar Groschen zu verdienen. Sie hörten uns zu, aber niemand wechselte ein Wort mit uns. Warfen uns ein paar Groschen hin, als wären wir Bettler. Fühlten uns praktisch ausgestoßen aus der menschlichen Gesellschaft. Von denen, die ein Herz und eine Seele haben wie wir. Spüren müssten, wie wir uns fühlen.
Frage mich jetzt warum man uns nicht mag? Es muss daran liegen, dass Menschen grundsätzlich fürchten, was ihnen fremd erscheint. Menschen, die über die Grenze zu ihnen kommen, besonders. Könnten ihnen Schaden zufügen. Wegnehmen, was ihnen gehört. Anstecken mit unbekannten Krankheiten oder fremder Weltanschauung. Deshalb verachtet man sie, verjagt sie. Sodass sie gezwungen sind, ständig weiterzuziehen wie Roma, die sie Zigeuner nennen. Einer von ihnen bin ich.
Frage mich jetzt: Wer bin ich eigentlich? Ein Niemand, den keiner akzeptiert, so wie er ist? Weil er anders aussieht. Wie meine Eltern und alle, die mit uns von Land zu Land, von Ort zu Ort ziehen. Eine Heimat zu finden. Wir gehören zum Volk der Roma. Meine Haut nicht weiß, sondern dunkel. Dunkler die Augen. Von einem Schwarz, das leuchtet von innen her. Die Haare schwarz, mal lang wie sie wachsen. Mal kürzer geschnitten. Rasiert habe ich mich noch nicht wie mein Papa. Unsere Sprache ist anders. So anders, dass wir uns nur untereinander verständigen können. Deshalb lernen wir die Sprache des Landes, in dem wir ankommen auf unserer Pilgerfahrt. Ja, unterwegs sein ist unser Leben. Nur vage ein Ziel vor Augen: Ankommen. Wo auch immer es sein wird. Ankommen und bleiben dürfen.
Roma sind musisch begabt. Tanzen und singen, spielen schon früh ein Instrument. Mit Musik zu sagen, was keine Worte braucht. Sich selbst zur Freude und um Geld zu verdienen für den Lebensunterhalt. Ich spielte die Geige auch für mich, in jeder freien Minute. Wusste schon bald, Musik ist mein Leben. Träumte schon als Kind, ein berühmter Geiger zu werden. In aller Welt bekannt und geliebt. Überall da, wo wir waren und noch sein werden. Andere handwerklich begabt, versiert im Schmieden und Reparieren von Kupfergeschirr. Frauen im Nähen neuer und Flicken zerrissener Kleider. Aus Karten und Handlinien die Zukunft zu lesen. Versiert im Fach alle und trotzdem verachtet.
In katholischen Ländern besuchen wir die Messe jeden Sonntag. Seit ich denken kann, ist meine Familie katholisch. Und trotzdem mögen uns Katholiken nicht. Weil wir anders sind. Fremde, die man meiden muss. Sie könnten Krankheiten übertragen, Babys stehlen. Den Teufel beschwören und Unglück bringen. So wie wir aussehen mit unserer dunklen Haut, den schwarzen Augen.
Roma existieren praktisch nur in Melderegistern. Mit blauer Tinte eingetragene Namen. Die wir buchstabieren müssen, damit sie sie schreiben können. Beamte sind vom Staat bezahlte Maschinen, kommt mir vor. Eingestellt, zu fragen nach Namen und Daten aller Bürger, die sich melden. In einer Liste registriert, im Stahlschrank sicher verschlossen. Denn Ordnung muss sein im Staat. Wir aber sind und bleiben lediglich Buchstaben in diesen Registern.
In der Gesellschaft als Menschen aus Fleisch und Blut mit Geist und Charakter nicht anerkannt. Weil wir anders sind. Anders aussehen und nicht in Häusern wohnen. Insgeheim aber wünschen, als Menschen wahrgenommen und behandelt zu werden. Jeder einzelne von uns akzeptiert, als Bürger einer Dorf- oder Stadtgemeinschaft. Da es nicht so ist, sind wir gezwungen, von Land zu Land, von Ort zu Ort zu wandern oder in Wagen zu fahren. In der stillen Hoffnung, irgendwo auf der Welt ein Mensch unter Menschen zu sein.
Bunt sind unsere Kleider, aus verschiedenen Stoffen genäht, fantasievoll bestickt, nicht nur aus Not. Denn wir lieben die Improvisation, das Fantastische. Wenn uns andere schon nicht mögen, lieben wir uns selber umso farbenprächtiger. In einigen Ländern Europas nennt man uns deshalb Zigeuner, obwohl wir Roma sind. Zigeuner mag niemand leiden, vielleicht, weil sie sich fürchten. Wie vor allen, die umherziehen. Nicht wie sie in Häusern wohnen. Mit Mauern, Zäunen oder Hecken ringsum abgegrenzte Festungen. Wir Roma hoffen, eines Tages anzukommen, wo man uns bleiben lässt. Häuser bauen, die sich nicht abkapseln. Kein Zaun, keine Hecke. Offen für Jedermann. Österreich scheint uns willkommen zu heißen.
Bei den Habsburgern wird alles geregelt und schriftlich bestätigt. Unterschrieben und gestempelt. In deutschen Landen sollt es noch genauer gewesen sein vor dem Krieg. Bis auf das Tüpfelchen auf dem i. Preußisch korrekt heißt es im anderen Europa und rümpft die Nase. «Leben und leben lassen» die Devise südlich der Alpen.
Immer noch hängen Kaiserfotos an den Wänden der Amtsstuben. Wie vor 1918 hinter jedem Schreibtisch in Büros öffentlicher Verwaltung und Privatunternehmen. Zuhause bei Beamten und Militärs. Sogar in einer Backstube hatte ich eines entdeckt. Als ich mich für eine Lehrstelle bewarb. Aber rausgeworfen wurde vom Gesellen. Preußen waren viel gründlicher als Österreicher. Revoltierten schon vor Kriegsende, sodass ihr Kaiser Hals über Kopf nach Holland floh. Die Bilder seiner Majestät auf der Müllkippe landeten. Bald nach Friedensschluss gründeten sie eine Demokratie nach westlichem Vorbild. Mit Parteien, die verschiedene Interessen vertraten. Für eine Roma-Partei fanden sich nicht genug Mitglieder. Hätten sich genug zusammengetan, wäre sie nicht zugelassen worden. Man hätte uns vorher Wohnung und Pass geben müssen.
Das österreichische Kaiserreich endete ähnlich. Obwohl Kaiser Karl I. sich weigerte, abzudanken. Führte den Titel «Kaiser von Österreich» bis zu seinem Tod 1922. Die neue Republik verwies ihn Ende November 1918 des Landes auf Lebenszeit. Auf den Straßen Österreichs abertausend Menschen. Protestierten gegen Maßnahmen der neuen Regierung. Unzureichend sei die Versorgung von Kriegerwitwen. Aber auch solche, die ihren Kaiser nicht vergessen konnten. In ihren alten Uniformen marschierten. Auf der Brust alle Orden der letzten Kriege. Mein Großvater befürchtete Schlimmes für uns. Militaristen kennten nur befehlen und gehorchen. Ihr Argument: Persönliche Freiheit provoziere nur Ungehorsam.
Vor dem Weltkrieg ging es uns sogar gut. Man ließ uns in Ruhe ziehen, wohin wir wollten. Hauptsache, wir waren friedlich und machten Musik, reparierten Geschirr und anderes. Mag sein, es lag am Erbherzog, der liebte Kultur und Kunst. Veranstaltete Konzerte mit Künstlern aus aller Welt in einem seiner berühmten Palais. Ganz Österreich schien Musik zu sein. Johann Straussʼ Operette «Der Zigeunerbaron» 1885 im Theater an der Wien uraufgeführt. Immer noch ein Kassenschlager. Es schien, als wollten alle Männer eine Zigeunerin zur Frau. Jeder Vorstadtsänger schmetterte die Arie«Mein idealer Lebenszweck ist Borstenvieh und Schweinespeck». Aber auch klassische Musik aktuell. Als ich lesen konnte, erfuhr ich aus der «Kronen-Zeitung» zum ersten Mal von «Jascha Heifetz», dem weltberühmten Geiger aus Amerika. Er kam nach Wien, um Mozart und Alban Berg zu spielen. Klassiker und Neutöner also. Kind jüdischer Eltern, in Russland geboren. Begabter noch als ich. Schon mit sechs Jahren spielte er das Violinkonzert von Felix Mendelssohn Bartoldy. 1917 wanderte er mit den Eltern nach Amerika aus. Bei ihm möchte ich gerne studieren.
Nicht lange und ich bin volljährig
Wie ich es mache, weiß ich nicht. Bald achtzehn und noch kein Mädchen umarmt. Schon gar nicht geküsst. Möchte es aber gern. Neugierig, wie sie schmecken, Lippen von Mädchen. Sehe ich Papa meine Mama küssen. Mädchen sind anders als wir Jungen. Tragen lange Kleider, keine Hosen und Hemden. Ihre Stimmen klingen heller. Kichern und lachen über alles und jedes. Reden unentwegt. Ob sie auch über mich reden? Noch aber hat mich keine angesprochen. Ich selber sah bisher keinen Anlass, eine zu fragen: wie heißt du? Einmal wollte ich es, ließ es aber, als ich sah, wie sehr sie mit sich selbst beschäftigt war.
Löste die Zöpfe, schüttelte ihren Kopf, dass die Haare flogen. Kämmte sie und flocht sie wieder zu einem Zopf. Dachte mir, warum lässt sie sie nicht locker herunter hängen. Dann gefiel sie mir viel besser. Aber deshalb heiraten muss ich sie nicht. Eine Frau muss doch mehr können als Haare flechten. Musik ihr ein und alles sein, wie Musik mein ein und alles ist. Erst, wenn ich eine solche Frau kennenlerne, kann ich sie lieben und heiraten. Ein Rôm eine Rômni. So heißen Mann und Frau in unserer Sprache.
Großvater muss viel gelesen, gehört und behalten haben. Wusste über fast alles Bescheid, auch über uns Roma. Erzählte mir eines Tages, woher wir kommen:
„Du bist einer von Millionen Roma und Sinti, die vor mehr als 600 Jahren von Indien aufbrachen. In Richtung Westen, wo das Leben leichter, das Wetter besser sei. Die Menschen gebildet und neugierig auf Unbekanntes, um es sich anzueignen. Wie die Kunst der Renaissance im 16.Jahrhundert sich die Antike zu Eigen machte. Erinnere Dich an Florenz, wo wir den David Michelangelos bewunderten. Über fünf Meter hoch die Statue. Gemeißelt aus einem einzigen Block Carrara-Marmor. Nach den Regeln antiker Bildhauer in Rom und Athen: Alles, Kopf, Arme, Schulter und Beinstellung, müssen in der Balance sein. Die Statue quasi in sich ruhen.
In Persien blieben die Roma nicht. Ihre Könige sperrten Fremde ein, machten sie zu Sklaven. Oder steckten sie in eine Uniform und schickten sie, ihre Feinde zu töten, Griechen vor allem. Afghanistan schien nur Berge, Täler und Wüste zu sein, leergefegt von Menschen. In Ägypten blieben einige. In der heutigen Türkei ließ «Suleiman der Prächtige» sie sich niederlassen. Ihre Berufe und religiösen Bräuche ausüben. Der Sultan tolerant wie kein anderer zu seiner Zeit. Drei Volksgruppen teilten sich auf dem Weg nach Europa.
In Deutschland, Österreich und Tirol blieben die meisten Roma und Sinti. Beide Zigeuner genannt. In Frankreich nennt man sie Gitan, Gitano in Spanien und Italien. Bezeichnungen, die sich im Laufe der Jahrhunderte herausgebildet. Aus Indisch und anderen europäischen Sprachen.
Anfangs erhielten sie von Papst, Bischöfen, Herzögen und Grafen einen Schutzbrief. Der erlaubte ihnen, in deren Staatsgebiet umherzuziehen. Sich betätigen, mit was auch immer. Als Kaufmann, Handwerker oder Musikant. Nach dem 30jährigen Krieg im 17. Jahrhundert blühten Land und Städte langsam wieder auf. Häuser modernisiert und neue gebaut, Felder beackert. Neue Straßen angelegt. Verwaltungen modernisiert. Herzöge und Könige erließen Gesetze, die allen gerecht würden, hieß es. Kirchen mit eigenen Spitälern pflegten auch kostenlos. Europa ein Paradies, das auch für uns Roma Heimat werden könnte.“
„Dann plötzlich alles anders als erwartet. Auf dem Reichstag in Freiburg 1698 wurden Roma und Sinti für vogelfrei erklärt. Unsere Vorvorfahren hofften, in Deutschland eine endgültige Bleibe zu finden. Jetzt wollte sie niemand mehr haben. Fremde seien sie und so anders. Mit ihrer dunklen Haut, den schwarzen Haaren, Sprache und seltsamen Gebräuchen, dass sie um den Frieden fürchteten. Einen Frieden, den sie endlich wieder hatten. Nach einem Krieg, der Jahrzehnte dauerte und kein Ende zu nehmen schien. In dem Millionen Menschen ums Leben kamen. Ermordet, verhungert oder Opfer von Pest und Cholera.
Roma und jeder, der anders aussah, sich anders benahm, war unerwünscht. Man wollte unter sich bleiben. Keine fremde Sprache lernen, um zu verstehen. Fremden nicht erlauben, ein Haus zu bauen. Mit ihnen Fußball zu spielen oder im Kirchenchor zu singen. Im selben Unternehmen arbeiten zu lassen, wie alle anderen gegen Lohn. Damit sie sich die neueste Mode kaufen können oder eine Kiste mit Wein. Nicht gesellschaftsfähig erschienen wir ihnen. Niemals wird es für uns eine Heimat geben.“
Großpapa schweigt. Ich neugierig geworden. Hätte ihn noch so vieles fragen können. Er aber stopft sich die Pfeife, pafft und es qualmt mächtig. Als könnte Tabakrauch die Welt verbessern. Aus Egoisten Menschen machen, die ihren Nächsten tolerieren. Meine Eltern hatten mir nie so viel erzählt. Als schämten sie sich, Roma zu sein. Großvater jetzt auch zum ersten Mal. Vielleicht, weil ich bald volljährig bin und wissen sollte, wer wir Roma sind, woher wir kommen. Wie andere uns sehen. Seit ich denken kann, ziehen wir weiter, wenn wir nicht bleiben dürfen. Für mich war das normal. Kein Grund, darüber zu klagen. Jetzt aber will ich wenigstens noch wissen, worin sich die Gruppen unseres Volkes unterscheiden.
„Roma sind die kleinste Gruppe in Europa,“ sagte er. „Ziehen wie immer schon von Ort zu Ort. In der Hoffnung, irgendwo das ideale Zuhause zu finden. Das ihnen Sicherheit verspricht. Raum und die Freiheit lässt, zu sein, die sie sind. Als Menschen nicht nur geduldet, sondern als Mitbürger akzeptiert. Die Mehrheit der Sinti aber war mit der Zeit das ständige Umherziehen leid. Ließen sich in verschiedenen Ländern Europas nieder. Vorwiegend im Balkan. Auch nur außerhalb der Stadtzentren. Auf Brachland in selbst zusammen gezimmerten Unterkünften. Aus dem, was sie in der Umgebung fanden. Bäume mit starken Ästen, die sie zu Balken sägten fürs Fachwerk. Lehm zum Füllen der Zwischenräume. Stroh für ʼs Dach von liegen geblieben Getreidegarben oder Wellblech vom Schrottplatz. Häuser kann man sie nicht nennen. In Italien heißen solche Siedlungen «Campi nomadi». Nomaden sind sie nach wie vor. Also Zigeuner, die irgendwann wieder weiterziehen.
Seltsame Vorstellung von Nächstenliebe, fällt mir ein. Die Welt ist doch groß genug. Habe ich in meinen fast achtzehn Jahren erfahren. In Kroatien und Italien gelebt und jetzt in Österreich angekommen. Im Umkreis von Städten wild wuchernde Wiesen, Brachland gesehen. Platz genug für mehr als das Volk der Roma, dem ich angehöre. Ich liebe dieses Volk, seit ich denken kann. Liebe wie die meisten Roma diese Art zu leben. Von der Gesellschaft zwar abgelehnt. Aber selbstbewusst und optimistisch.
Stets unterwegs zu neuen Zielen. Alles Neue, jedes Erlebnis vergrößert unser Wissen. Erkennen Chancen, uns anzupassen und trotzdem Roma zu bleiben. Wir pflegen die Gemeinschaft, lieben Sprache und Kultur. Feiern unsere Tradition auf fröhlichen Festen. Wallfahren, wenn irgend möglich, einmal im Jahr zu unserer Heiligen Sara nach «Saintes-Maries-de-la-Mer» in Südfrankreich. Ein Ort, der uns als Gemeinschaft stärkt. Die Vision wach hält, es kommt der Tag, an dem wir Teil einer weltumspannenden Gemeinschaft sind. Ein Volk unter vielen und anerkannt.
Bis dahin sprechen wir darüber, die Sehnsucht wach zu halten. Spielen und singen unsere alten Lieder. Variieren sie auf neue Art, um beweglich zu bleiben. Angeregt von dem, was wir sehen und erleben. In Ländern, die uns bleiben lassen eine Zeit.
Tanzen bei jeder Gelegenheit, die sich bietet. Von Gitarre und Kastagnetten befeuert. Auch auf Veranstaltungen, zu denen uns Einheimische einladen. Sie lieben den Kontrast, das Exotische. Die aufs Minimum reduzierten Bewegungen des Mannes. Der sich biegende Körper der tanzenden Frau. Kastagnette in einer Hand, in der anderen den äußersten Zipfel ihres weit schwingenden Rockes.
Selbst geschneidert aus Resten von Stoffen. Mit farbigen Garnen und Pailletten bestickt. Immer wieder neue Muster erfunden. Um Einheimische daran zu gewöhnen, dass wir etwas mit ihnen gemeinsam haben: Wir lieben die Abwechslung wie sie. Sie folgen einer stets wechselnden Mode. Wir wechseln den Zierrat ebenso oft, nicht aber den Schnitt, weil wir die Tradition lieben.
Reiten in freien Stunden auf unseren Pferden im Galopp. Um sie nach Stunden im Geschirr Freiheit spüren zu lassen. Füttern sie mit frisch gemähtem Gras. Ein süßer Apfel zwischendurch. Damit sie gestärkt sind und gut gelaunt die schweren Wagen ziehen ohne zu mucken. Mit Mensch und Gepäck. Ohne unsere Vierbeiner wären wir verloren.
Da fällt mir ein, in einem Buch über die Pferdezucht las ich, was mich sehr beeindruckte. Diese Vierbeiner kamen vor ca. 8000 Jahren nach Europa. Mit Reiterheeren aus den Steppen Ostasiens. Bis dahin kannte man nur Hunde mit vier Beinen, das Haus zu bewachen. Kühe und Ziegen, gemolken und geschlachtet zu werden. Von Schafen und Kaninchen das Fleisch zum Braten und Grillen. Ihr Fell als Ganzes für Wintermäntel. Oder die Wolle zu Garn versponnen, um Stoffe zu weben. Keines von diesen Tieren kam dem Menschen so nahe wie später das Pferd. Vom Hund mal abgesehen.
Es ist schon große Kunst, wilde Pferde zu zähmen, weil sie Fluchttiere sind. Davon stieben, sobald sich ein Fremder nähert. Ein Wolf z. B., der es fressen will. Auf seinen Rücken springen und ihm mit seinen scharfen Zähnen das Fleisch von den Knochen reißen.
Alles Fremde ist für Pferde zunächst ein Feind. Männer, die Pferde zähmen, gewöhnen sie langsam an das, was ihnen Angst macht. Werfen ein Tuch, das sie nicht kennen, über ihren Rücken. Wiederholen es so oft, bis sie sich daran gewöhnt haben. Nicht mehr wegrennen, sondern stehen bleiben. Den Mann ansehen mit ihren großen Augen. Als sähen sie mehr als wir. Freundschaften, echte Beziehungen entstanden. Und bleiben, solange sie leben.
Wie meine zwischen mir und dem Wallach, der unseren Wagen zieht. Jakob habe ich ihn getauft. Streichle seine Nüstern, seine Kruppe, das Hinterteil. Kämme seine Mähne, den Schweif. Bürste das Fell. Lasse ihn Zucker von meiner Hand schlecken. Jakob bedankt sich und wiehert. Galoppiert davon, sobald ich auf seinem Rücken sitze. Mein Leichtgewicht erlaubt ihm große Sprünge. Kein Geschirr an Hals und Brust, wenn er den schweren Wagen ziehen muss. Habe mich rasch ans Reiten gewöhnt, auch ohne Zügel in den Händen. Jakob läuft, wohin es ihn treibt. Und ich finde es richtig toll so. Kann von oben herab die Gegend erkunden. Stundenlang das Gefühl haben, zwischen Wolken und Erde zu schweben. Zu träumen von einem Himmel voller Geigen.
Einige Pferderassen sind besonders trittsicher im Gebirge. Hier wie auch in Kriegen rettete ein Pferd nicht selten dem Reiter das Leben. Ach, wären alle Menschen doch Pferdezüchter geworden. Sie hätten gelernt, mit anderen anders umzugehen.
Stolz bin ich, einer der Roma zu sein. Trotz Ablehnung und Diffamierung. Oder gerade deswegen. Es reizt mich zu sagen oder tun, was Widerspruch herausfordert. Eines Tages hatte ich eine Idee. Weiß nicht, wer sie mir eingegeben. In Gedanken mit mir beschäftigt. Bin doch ein Mann der Roma. Fragte mich: Warum soll ich mich dann nicht Enis Rôm nennen statt Enis Badžo? Setze, wie bei Fremdsprachen üblich, einen Akzent über das o, damit man es betont. Spricht man es aus, klingt es wie Rômm, mit zwei m. Mich kann also niemand mit Rom verwechseln, der Hauptstadt Italiens.
Es ist der erste Tag im Monat Mai 1929. Auf Wiesen blühen Klee und Löwenzahn. Die Sonne scheint. Gelb ist die Farbe der Optimisten. Ab heute ist Enis Badžo Vergangenheit. Die Zukunft gehört einem, der Enis Rôm heißt. Einem Mann des Volkes der Roma. Obwohl ich noch nicht volljährig bin. Lese viel, auch Zeitungen, um meine Deutschkenntnisse zu verbessern. Damit ich richtig verstehe, was andere über uns sagen. Und ich ihnen Paroli bieten kann, reden sie schlecht über uns. Vor allem aber kann ich ein Rôm bleiben. Erst am Gegensatz zu anderen fühle ich mich stark und auserwählt. Die Welt wird Augen machen, lege ich erst mal richtig los. Mit meiner Geige will ich ein berühmter Künstler werden.
Für alle, die nichts über Roma wissen und solche, die uns noch kennenlernen wollen: «Rôm», mein neuer Familienname ist unserer Sprache entnommen. Bedeutet der einzelne Mann. Roma sind mehrere, der Clan, das Volk. Eine Frau ist eine Rômni, mehrere Romnîja. Meine Eltern haben nichts dagegen, dass ich mich Rôm nenne. Obwohl in der Meldeliste Badžo steht.
Roma sind unterwegs in ihren Wagen. Überwinden hohe Berge und reißende Flüsse. Schneller auf gepflasterten Straßen. Langsamer auf lehmigen Wegen und im Gebirge. Von ständigem Aufenthalt in Städten und Dörfern konnte keine Rede sein. Von Gleichberechtigung schon gar nicht. Zogen zuletzt weiter durch Österreichs Provinzen. Am Rande lebende, wie immer schon. Hofften, irgendwo Menschen zu treffen, mit denen wir ganz normal bei Bier oder Wein zusammensitzen können. Reden und streiten über dies und das. Um wenigstens das Gefühl zu haben, wir sind Menschen wie sie. Freuen uns und leiden wie sie. Wir sind freundlich zu jedermann. Hoffen, sie lächeln, wenn sie schon nicht antworten. Ein Beamter auf der Meldestelle uns nicht anders behandelt als die Bürger seiner Stadt. Er muss uns ja keine Tasse Kaffee anbieten wie Einheimischen, wenn ʼs länger dauert. Ein paar Worte reden: wie geht ʼs oder so was.
Niemand aber redete mit uns, nicht einmal, wenn wir bleiben dürfen. Und damit quasi Bürger eines Dorfes, einer Stadt sind. Außerhalb zwar und befristet, aber Bürger wie alle anderen. Es sieht aus, als herrsche ein Schweigekartell wie das der Mafia auf Sizilien. Nicht einmal Katholiken nach dem sonntäglichen Gottesdienst sprechen uns an. Obwohl wir getauft sind. Neben ihnen auf derselben Bank in der Kirche knien. Wie Sie zur Kommunion gehen.
Ich aber bin Enis Rôm, der anders ist und anders denkt. Distanziere mich von ihnen, weiter noch als sie es tun. Nur auf eine andere Art. Ich blicke nicht verächtlich auf sie herab. Hole keine Polizei. Klage sie nicht an, weil sie uns verachten und neige nicht dazu, sie zu vertreiben. Ich bleibe der, der ich bin. Einer der Roma. Rôm ist König über ein Reich, das ihm niemand nehmen kann. Groß wie seine Fußsohlen. Weit wie die Schritte, die sie gehen. Erlaubt oder nicht. Immer da, wo der Wagen seinen Schatten wirft.
Überall gebe ich Rôm an, werde ich gefragt. Auch dem Polizisten. Riskiere es einfach. Und keiner hat bisher gefragt, ob es stimmt. Ausweise hatten wir Jugendlichen keine. Die Aufenthaltsgenehmigung mit dem Familiennamen gut aufgehoben in der Hosentasche unserer Papas. Die Kinder immer in ihrer Nähe, bis sie volljährig sind. Man weiß ja nie, wo und wann uns einer dieser dreimalschlauen Polizisten begegnet.
Unterwegs waren wir, soweit ich zurückdenken kann. Sodass dieser ständige Ortswechsel im Laufe der Jahrhunderte unseren Charakter verändert hat. Lieben es, unterwegs zu sein, einerseits. Sehnen uns danach, zuhause zu sein, andererseits. Ob im Wagen oder zu Fuß. Lernen ständig Neues kennen, das wir zu unserem machen. Körper und Geist bewegt, der Charakter gefestigt und weiter gekommen. Eine Art Weltanschauung kann man es nennen. Sehen den endlosen Horizont vor uns als Aufforderung, das Dahinter zu erkunden.
Es könnte der Himmel sein. Hoffen, zu finden, was noch niemand gefunden hat. Irgendetwas Unbestimmtes, Herrliches, Unvorstellbares. Geahnt mehr als gewusst. In Köpfen und Herzen lebendig. Der Motor, der uns antreibt. Unterwegs sein heißt für uns leben. Alle Nerven spüren es, alle Gedanken denken nur noch: weiter, weiter. Seit vielen Generationen haben es Roma quasi im Blut. Das ihr Herz durchpulst, die Beine antreibt und den Willen.
Deshalb finden wir es ganz normal, unterwegs zu sein. Einverstanden mit dem, was uns ausmacht und Identität geworden ist. Wer sein Leben lang auf Tour ist, will es nicht mehr missen. Ein Gefühl der Freiheit stellt sich ein, von Unabhängigkeit. Obwohl wir abhängig sind von den Behörden. Abgelehnt und verachtet von Menschen, denen wir zwangsläufig begegnen.
Wir nehmen es hin. Wie wir das Wetter hinnehmen. Nur würden wir uns freuen, wären die Leute nett zu uns. Lieben müssen sie uns ja nicht, wie Roma sich lieben. Umarmen, wie sie sich umarmen. Wären sie freundlich wie zu ihresgleichen, meine Eltern würden sich freuen. Und hoffen auf Anerkennung. Sie gehören zu der wachsenden Zahl von Roma, die sesshaft sein möchten. In den Herzen vergraben die Sehnsucht anzukommen. Irgendwo zuhause zu sein. In unruhigen Zeiten einen Ort haben, der ihre Heimat ist. Zu denen gehören, die selber entscheiden, wo und wie sie leben. Ihre eigene Kultur pflegen. Wir möchten wie andere die gleichen Rechte haben. Nicht mehr als Menschen zweiter Klasse gezwungen werden, zu fliehen. Um endlich anzukommen und zu bleiben. Irgend, wo ein Himmel ist.
Ich bin, der ich bin
Mir ist es momentan egal, ob Hinz und Kunz nett zu mir ist. Ich genieße es, unterwegs zu sein. Liebe es geradezu. Denn ich lerne kennen, was ich als Ortsansässiger nie zu Gesicht bekäme. Von Schule, Elternhaus und deren Gesetzen und Regeln gezwungen, Pflichten zu erfüllen. Erlebe beim Umherstreunen eine ganz andere Welt. Und fühle mich sofort besser. Alles Interessante, für mich Neue befriedigt mich, als wäre es ein Teil von mir. Ein wunderbares Gefühl, mich selbst zu spüren, bin ich unterwegs. Bin dann bei mir selbst zuhause. Anders als in einem festen Gebäude zu wohnen. Wechsel ist meine Natur, könnte ich sonst auf meiner Geige einzelne Töne variieren, auf dass sie Melodie werden? Kämen mir sonst ganz neue Gedanken, wenn ich unterwegs bin?
Ziehe mir ein Hemd an wie andere meines Alters, die langen Haare unter einer Mütze versteckt. Damit man mich nicht gleich als Fremden erkennt und verjagt. Schlendere durch die Straßen einer fremden Stadt. Durch Alleen mit Platanen, beschnitten aussehen, als hätte ein Barbier sie gestutzt. Parkanlagen mit weißen Bänken, Enten und Schwänen auf einem Teich. Von Kindern und alten Leuten mit Brotresten gefüttert. Hier und da ein Liebespaar, das sich umarmt und küsst, wenn keiner hinsieht.
Interessante Fassaden, Dächer mit Fenstern, die wie Ochsenaugen aussehen. Erker an Hausecken angeklebte Türme mit spitzen Hüten. Schmalhohe Fenster mit Gardinen. Balkone mit Geländern aus gebogenen Eisenstäben. An denen Kästen mit roten und weißen Geranien hängen. Frage mich, wie sie wohl wohnen hinter dieser Pracht? Ob drinnen alles auch so schön und ausgewogen ist? Höre öfter als einmal Geschrei aus einem offenen Fenster. Richtige Schimpfkanonaden sogar. Sie streiten sich, ärgern einander und schlagen sich, wie ich sehe. Kein Wunder, dass sie uns und andere Fremde so schlecht behandeln. Menschen, die sich ständig streiten und ohrfeigen, können keine Friedensengel sein.
Zum Glück ist der Himmel über ihnen und uns derselbe. Sonne und Mond ziehen ihre Bahn, wie wir. Man sieht nicht, wohin sie verschwinden. Und doch sind sie da. Sonst sähen wir sie nicht wieder. Die Sonne jeden Morgen. Den vollen Mond einmal im Monat. Ob man die vier Wochen deshalb Monat genannt hat? Wüsste es gern. Die Sterne in der Nacht leuchten. Glühen die großen, glitzern die kleinen. Immer an derselben Stelle, wie es scheint. So wie auch hier auf der Erde vieles auf der Stelle bleibt.
Hunde bellen hinter Toren. Katzen überqueren die Straße, buckeln an unseren Beinen und miauen. Brombeeren an Sträuchern und Pflaumen an Bäumen an vielen Stellen. Fordern uns auf zu pflücken und zu essen. Nur wir sind unterwegs wie Sonne und Mond. Den Menschen nicht willkommen. Verachtet, verjagt. Dürfen nicht wiederkommen wie Sonne und Mond. Könnten sie Himmelsgestirne aus- und einschalten, täten sie es. Passte es ihnen in den Kram. Wir passen ihnen nie. Finden immer einen Anlass, uns Schwierigkeiten zu machen. Dulden uns lediglich eine begrenzte Zeit außerhalb ihres Dorfes, ihrer Stadt. Jagen uns davon, protestieren aufgebrachte Bewohner ihrer Gemeinde. Irgendwer muss sie aufgehetzt haben. Oder ist es die Angst?
Seltsam, dass sie uns dennoch gerne zusehen und zuhören. Wenn wir auf Märkten musizieren oder tanzen. Freuen sie sich oder tun sie nur so? Einmal verachten und verjagen sie uns. Ein andermal holen sie uns zu ihrem Vergnügen. Immer dann, wenn sie Spaß haben wollen, den Alltag vergessen. Führen uns vor wie Clowns auf ihren Festen, Hochzeiten und Jubiläen. Als Fremdlinge in traditionellen Trachten dürfen wir auftreten, tanzen, zaubern, Tricks zeigen und Geld dafür nehmen. Das sie am liebsten zuhause ließen oder auf der Bank deponierten. Aus Angst, wir könnten ihr Portemonnaie stehlen, ohne dass sie es merken.
Man holt uns, weil Roma gute Kesselflicker sind. Frauen nähen und stricken aus dem ff. Männer musikalisch begabt. Oft mehr als ein Instrument beherrschen. Perfekt Geige spielen, Akkordeon, Gitarre oder Kontrabass. Zu Tänzen spielen wir auf, dass die Röcke fliegen. Attraktiv sind wir für sie nur, weil wir ihnen bieten, was sie nicht kennen. Auch sehen wir anders aus. Mit unserer dunkleren Hautfarbe, den schwarzen Haaren. Augen, die mal blitzen, mal dunkel verschattet sind, singen wir von Liebe oder Tod.
Verstehen muss man es nicht. Musik sagt alles. Fast alles. Unsere Kleider zeigen, dass wir Farben lieben. Die Fantasie nicht ausgeht, immer Neues erfindet. Jacken und Hosen schmücken vielfarbige Biesen. Schwarze oder weiße Spitze das Hemd an Brust und Manschetten. Pailletten an den Kleidern der Frauen. Als solche engagieren sie uns, solange wir am Ort sind. Ein paarmal im Jahr vielleicht. Das war ʼs dann. Nur Männer und Jungen dürfen öffentlich auftreten. Großväter achten darauf, dass die Töchter zuhause bleiben. Um ihre Unschuld besorgt. Mütter und Omas haben das Haus zu hüten. Auch wenn ʼs nur ein Karren ist, ein Zelt. Kürzlich las ich, in Berlin treten Frauen sogar nackt in sogenannten Kabaretts auf. Hier in Österreich sah ich noch kein Schild, auf dem Kabarett steht. Es würde mich interessieren.
Bis kurz nach meinem Achtzehnten wohnte ich bei meinen Eltern. Geschwister habe ich keine, bin der einzige Sohn. Habe alles erlebt, was sie erlebten, durchmachen mussten, Enttäuscht jedes Mal, wenn man uns die Türe wies. Die Genehmigung entzog mit läppischen Argumenten. Bäcker uns altes Brot andrehten. Frisches sei ausverkauft. Im Fleischerladen uns aus der Abfallkiste bedient, hätten wir nicht bares Geld auf die Theke gelegt. Mich aber traf es nicht ins Mark.
Erlebte es mit einer gewissen Distanz. Ich war nicht enttäuscht, wenn man uns nicht in ihrem Dorf, ihrer Stadt wohnen ließ. Weil unsere Haut dunkler ist als ihre. Unsere Haare schwarz und nicht geföhnt. Zu Zöpfen geflochten bei Frauen und um den Kopf gelegt seit Generationen schon. Schön, sie anzusehen, finde ich. Madonnen sind alle Romnîja unter achtzehn. Die blasse Haut einheimischer Frauen finde ich überhaupt nicht attraktiv. Jetzt ist Bubikopf Mode, wie ich sehe. Jede Frau trägt ihn wie eine Monstranz durch die Straßen: Seht her, bin ich nicht schön? Eingebildete Frauenzimmer.
Seit Frühjahr 1929 leben wir, meine Familie und sechs andere in Österreich. Der ganze Clan mit Kindern, Omas und Opas. Gerade jetzt zwei Wochen in Kirchschlag, einem Dorf oberhalb von Linz an der Donau. Haben außerhalb auf einer nicht gemähten Wiese unsere Wagen abgestellt. Auch in Österreich lässt man es nicht innerhalb von Ortschaften zu. Wie in anderen deutschsprachigen Ländern. Nur die Ärmsten der Armen, selber am Rande von Dörfern, gewähren uns Unterkunft. Bis wir einen Platz gefunden haben. Ein paar Tage in ihren bescheidenen Hütten. Wenn ihre Männer abends nicht nachhause kommen. Auf weit entfernten Feldern oder in Fabriken die Woche über arbeiten.
Hier also die Pferde abgespannt, sie grasen zu lassen. Den zweirädrigen Anhänger schräg gestellt. Hühner und Enten tummeln sich schon bald in sattem Grün oder fließendem Wasser. Selbstversorger sind wir seit eh und je. Ein Ei jeden Morgen, Fleisch einmal die Woche. Holz gesammelt und Feuerstellen eingerichtet, zu kochen im Freien. Bei schlechtem Wetter auf dem Ofen im Wagen. Zum Glück ein Bach in der Nähe. Fließendes Wasser ist klar und sauber. Frisch wie aus einer Quelle und löscht den Durst. Am künstlich gebauten Wehr Forellen. Praktisch das Essen vor der Tür. Auch praktisch, die Wäsche zu waschen. Immer fließt sauberes Wasser nach. Meine Mama den ganzen Vormittag damit beschäftigt.
Mein Papa und andere Männer gehen durchs Dorf. Zu musizieren und Geld dafür zu bekommen. Ich bin dabei, meine Geige in der Hand. Den Kasten zuhause gelassen. Das Akkordeon hat mein Vater schon umgeschnallt vor der Brust. Lässt hin und wieder ein Glissando erklingen. Leute bleiben stehen und gehen weiter. Öffnen das Fenster, schließen es sofort wieder, erkennen sie uns. Es ist nicht leicht Geld zu verdienen. Um Brot und Wurst zu kaufen, ein Paar neue Schuhe.
Heute aber ist Markt. Und wir sind Teil des allgemeinen Trubels. Denn ein Markt ohne Musik ist kein Markt. Rund muss es gehen, die Kasse klingeln, da sind wir recht. Vater und ich spielen Stücke, die schon unsere Vorväter spielten. Leute lächeln, als kennten sie sie. Freuten sich, uns wieder zu hören. Träumen von Irgendwas im Irgendwo? Selten fragt einer, woher wir kommen, wohin wir gehen. Ob es uns gut geht, das Geld reicht für eine Woche, fragt niemand.
Oft reicht es gerade mal für ein Brot und eine Wurst. Mama muss helfen. Sie kann gut Tischdecken häkeln und Pullover stricken. Eng gewordene Kleider weiter machen oder umgekehrt. Aber auch aus Tarock-Karten die Zukunft lesen. Richtig gut aus den Linien der Hände. In der rechten Hand andere als in der linken. Beide sollen sich entsprechen, auf irgendeine geheimnisvolle Weise. Weiß meine Mama.
Auch dass es schon Jahrhunderte Tradition sei bei den Roma und Sinti, wie sie uns manchmal nennen. Menschen wollen in bestimmten Situationen im Voraus wissen, was ihnen bevorsteht. Der richtige Mann, die richtige Frau. Reich werden oder arm bleiben. Freude oder Kummer. Ein gutes Geschäft oder viele Söhne. Und zahlen dafür einen Silberling.
Besonders Frauen wollen es wissen. Kommen spät am Abend zu meiner Mama. Weil dann kaum ein Risiko besteht, einem Bekannten zu begegnen. Kopf und Gesicht mit einem Schal verhüllt. Zahlen im Voraus und verschwinden nach einer Stunde wieder. So läppern sich Groschen und Taler zusammen und wir kommen über die Runden.
Liebe Deinen Nächsten wie dich selbst?
Sonntagmorgen. Zum ersten Mal gehen wir in die Kirche von Kirchschlag. Klingt lustig, Kirche von Kirchschlag. Aber das Dorf heißt so, weil dort als erstes eine Filialkirche von Helmondsödt errichtet wurde. Praktisch für die Bauern der Umgebung. So wie der Schlag am Haus praktisch für Brennholz ist. Wir wollen mit anderen die Messe feiern. Gott danken und bitten, dass wir bleiben dürfen. Vielleicht akzeptieren sie uns, wenn sie feststellen, wir sind wie sie katholisch. Christen, die ihre Sonntagspflicht erfüllen. Haben in den hinteren Bänken der linken Seite Platz genommen. Auch unsere Männer, obwohl links für Frauen reserviert. Wir wollen zeigen, dass Mann und Frau zusammengehören. Bloß nicht so weit vorne, wo andere Frauen schon knien oder sitzen. In ihren Gebetbüchern hin und her blättern, als suchten sie, was sie nicht wissen.
Wir hatten nie Gebetbücher, nur eine Bibel. Lieder, «Vaterunser» und «Gegrüßt seist du Maria» kennen wir auswendig. Auch in Deutsch. Bleiben wir länger an einem Ort, lernen wir als erstes die Sprache der anderen. Irgendein Bettler findet sich immer, der sie uns beibringt. Wir bedanken uns bei ihnen und laden sie zum täglichen Essen ein. Bis wir die neue Sprache verstehen und uns verständigen können. So ist allen geholfen.
Die Pfarrer am Ort waren froh, wenn wir regelmäßig in die Sonntags-Messe kamen und kommunizierten. Erinnere mich, als eines Tages meine Mama zu mir sagte: „Du darfst hier nicht in die Schule gehen, also auch nichts lernen von Gott und seiner Kirche. Deshalb lese ich Dir aus der Bibel die Geschichte vom Abendmahl vor. Das wichtigste bei uns Katholiken. Es war Jesus letztes Essen mit seinen Jüngern, bevor er gekreuzigt wurde.“
Eine Geschichte, die mich anfangs faszinierte. Aber nicht lange danach rätselhaft vorkam. Brot der Leib Christi? Wein sein Blut? Gott ein Mensch, einer von uns? Und wir sollen diesen Jesus essen? Schon komisch. Mama las damals unbeirrt weiter: „Jesus gab beides seinen Jüngern und sagte: „Das ist mein Leib und mein Blut. Esset und trinket, damit ich in Euch bin“.
Ich weiß, in jeder Messe wird dieses Abendmahl wiederholt, uns zu erinnern, dass dieser Jesus gegenwärtig ist. Mama damals: „Du wirst es später richtig verstehen.“ Ließ mich taufen, als ich zehn war. Kurz danach zur ersten Heiligen Kommunion gehen. Glaubte damals an alles, was mit Orgel und Weihrauch gefeiert wurde.
Heute ist die Wandlung in der Messe für mich weder Wirklichkeit noch Zauberei, sondern Symbol für die Gemeinschaft aller, die es glauben. Ich bin zur Kommunion gegangen, sagen sie, schluckten sie in der Messe eine Hostie. Und fühlten Gott in sich. Las in einem Lexikon, Kommunion ist abgeleitet aus dem lateinischen «Communio». Bedeutet Gemeinschaft. Mit wem? Gott? Sind es nicht Menschen, die mit anderen Gemeinschaft haben? Oder sogar beide? Glauben ist eine komplizierte Sache.
Sehe mich um, erkenne Leute, denen ich schon im Dorf begegnete. Da, die Frau vom Obststand auf dem Wochenmarkt. In der zweiten Bank links außen sitzt sie, sieht sich um. Wie Frauen sich umdrehen, um festzustellen, wer hinter ihnen sitzt. Rasch, damit es nicht so auffällt. Erkennt mich, stößt ihre Nachbarin an. Auch die wirft einen raschen Blick zu uns herüber und flüstert irgendwas. Alle scheinen zu flüstern. Wie an einer Strippe gezogen schauen alle Frauen auf dieser Bank zu uns herüber. Freundlich sind ihre Blicke nicht.
Ehe ich mir einen Reim darauf mache, stolzieren drei Männer im Mittelgang an uns vorbei. Nebeneinander, Schulter an Schulter, sodass sie die Breite des Ganges einnehmen. Als wollten sie niemanden durchlassen. Wie die vereinten Truppen General Fochs im letzten Krieg. Den Blick starr geradeaus gerichtet. Würdigen uns keines Blickes, als wären wir Luft. Alle anderen grüßen sie, nicken mit dem Kopf, lächeln. Man kennt sich. Die erste Bank auf der rechten Seite reserviert für sie. Ihr Name auf Emaille-Schildern.
Die Frauen der zweiten Bank links blättern wieder in ihren Büchern, viele mit goldenem Schnitt. Drehen sich hin und wieder um zu uns. Scheinen es nicht fassen zu können, dass wir in ihrer Kirche sind. Was ist das bloß für ein Pfarrer, der Zigeunern die Türe zum Himmelreich öffnet?
Bing bing, einer der beiden Messdiener zieht am Seil neben der Tür. Das Glöckchen läutet. Messe beginnt. Der Pfarrer im grünen Messgewand schreitet. Seine Hände halten den Kelch, den ein Tuch verhüllt. Heute ist es grün, wie das Messgewand. In der Fastenzeit sind beide violett, Pfingsten und Karfreitag rot. Wie bei uns zuletzt noch in Wien. Schwarz bei Trauergottesdiensten. Es ist ein älterer Herr, der Pfarrer der Gemeinde Sankt Bonifatius. Scheint gut genährt zu sein. Sein Bauch bauscht das Gewand auf, als blies es einer von unten auf. Zögert, bevor er die erste Stufe zum Altar hinauf riskiert. Drei sind es, jede bestimmt zwanzig Zentimeter hoch. Hoffentlich stolpere ich nicht, scheint er zu denken.
Die beiden Knäblein in schwarzem Talar und weißem Spitzenrock sind an ihre Plätze gegangen. Rechts einer und links einer. Zu ebener Erde. Kein Risiko zu stolpern und zu stürzen. Wie in der Politik fällt mir ein: Die Oben können stürzen oder gestürzt werden. Die Unten allenfalls im Schlamm stecken bleiben.
Orgel ertönt. Das Größte im Gottesdienst. Musik, die klingt, als hätte der Himmel alles, was Töne von sich gibt, in aberhundert Pfeifen gesteckt. Um es wie ein Füllhorn über uns auszuschütten. Die Gemeinde zu bewegen, in das Lob Gottes einzustimmen. Der jeden Menschen liebt, ob seine Haut hell, dunkel, rot oder gelb ist. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, heißt es in den Evangelien. Duldeten sie uns nach dem Gottesdienst am Nebentisch im Café, wäre ein Anfang gemacht und Mama glücklich.
Doch hier kommt keine Freude auf. Einzelne Frauen beginnen mit ihren hohen Stimmen. „Großer Gott wir loben dich“ müsste anders klingen. Zögernd, als müssten sie sich erst einsingen. Nacheinander stimmen andere ein. Wir kennen die Texte nicht, nur die Melodie gehört, behalten und mitgesummt. Noch aber fehlen die kräftigen Stimmen der Männer. Gehen als letzte hinein und verlassen als erste das Haus Gottes. Lassen ihre Stimmen erst hören, als die Frauen bereits auf der Höhe ihrer Gesangskunst angelangt sind. Und es schon ganz schön geklungen hat.
Nicht anders am Schluss der Messe. Tenöre schmettern, Bässe brummen die letzte Strophe des Liedes vom Lob Gottes. Froh, alles hinter sich zu haben. Als gleichzeitig die Glocken über uns die Mauern zittern lassen: Schluss, aus, raus mit euch. Heute scheint etwas schief zu gehen. Noch nicht aus der Portalhalle heraus, geifern uns Frauen an:
„Was fällt euch Zigeunerpack ein, in unsere Kirche zu gehen? Und auch noch zur Kommunion. Verschwindet dahin, wo ihr hergekommen.“ Fuchteln mit den Händen, als wollten sie uns schlagen. Ihre Männer mischen sich ein, zwei, drei werden handgreiflich. Drücken alles, was dunkle Haut hat. Roma, Männer und Frauen, vor sich her. Sogar einen Jungen, der braun gebrannt aus den Ferien zurück. Keiner von uns. Packen meinen Vater an der Schulter. Schubsen ihn, dass er bald hingefallen wäre. Schieben meine Mutter hinterher und mich. Da packt mich der Zorn, regelrechte Wut. Noch nie hatte ich Roma verteidigen wollen, aber jetzt platzt mir der Kragen:
„Sie wollen Christen sein? Sehe es Ihren Gesichtern an, am liebsten verprügelten Sie uns, jagten uns aus dem Dorf auf der Stelle. Vom Kirchplatz direkt in die Hölle. Ja, in die Hölle wünschen Sie uns.“
„Was ist hier los?“ Der Pfarrer eilt herbei, vom Geschrei angelockt. Blickt die Männer an. Dann zu uns herüber. Verstehen huscht über sein Gesicht. Und ein Minimum vom Minimum eines Lächelns. So hatte ich ihn nicht gesehen an diesem Sonntagmorgen. Sein weites Gewand vom schnellen Gehen aufgewirbelt. Weiter noch als am Altar. Flügeln eines Erzengels gleich, als er die Hände hebt wie zu segnen. Sankt Michael persönlich. Was wird er jetzt sagen?
„Diese Männer und Frauen sind Christen, römisch- katholisch wie Ihr. Eure Schwestern und Brüder, auch wenn sie Roma sind. Eine dunklere Haut haben als wir, unsere Sprache nicht perfekt sprechen. Liebet einander, sagt der Herr. Und spottet nicht, weil sie anders aussehen. Wollt sie um Gottes Willen nicht verjagen, wie Ihr Füchse verjagt, die eure Hühner stehlen. Denn sie glauben an Jesus Christus, Gottes Sohn, wie Ihr.“ Nach einer winzigen Pause: „hoffe ich jedenfalls.“
Kommt auf uns zu, das Gewand wieder ordentlich von der Schulter heruntergefallen. Umarmt meine Mama. meinen Papa, mich, die Freunde. Lauter, dass alle es hören: „Ich lade Euch ein zu einem Glas Wein in meinen Garten. Jetzt auf der Stelle.“ Kirchschlager und Kirchschlagerinnen betroffen, schweigen, verdrücken sich. Männer, wie ich sehe, ins Wirtshaus nebenan, ihren Ärger hinunter zu spülen. Frauen, wie es ihre Art ist, tuscheln noch miteinander allerlei über Fremde und Nächstenliebe. Ob ʼs positive Folgen hat für uns? Keine Ahnung.
Am folgenden Sonntag scheint alles ruhig zu bleiben. Alle Frauen setzen sich auf ihren angestammten Platz. Die Männer bleiben diesmal hinter uns stehen, direkt neben dem Eingang. Die Beinmuskeln zu stählen für den Sprung ins Wirtshaus. Die Messe soll kurz sein, die Predigt ausfallen. Wir wie immer in den hinteren drei Bänken. Eine Frau sieht ständig zu uns herüber. Den Hals verdreht, dass es weh tun muss. Zornig blitzen ihre Augen. Die kenne ich doch. Vor wenigen Tagen noch war sie bei meiner Mama. Ließ sich die Handlinien deuten. Irgendwas muss sie vorhaben.
Heiraten? Verloben? Oder eine Erbschaft erwarten? Wie es ausging, weiß ich natürlich nicht. Mama schweigt wie ein katholischer Beichtvater. Oder ein Arzt. Würde sie es anderen erzählen, verstieße es gegen eine Regel. Auch wenn sie in keinem Gesetzbuch steht. Es spräche sich rasch herum. Nie mehr könnte sie an diesem Ort, in der ganzen Gegend Geld verdienen mit Wahrsagerei. Vertreiben würde man uns, die Familie und alle unsere Freunde.
Diese Frau aber, die zu uns herüberblickt, muss es ihrem Mann erzählt haben. Der, wütend wohl über entgangene Erbschaft. Kaum aus der Kirche, zischt er meine Mama an: „Du Zigeunerhure, verschwinde von hier! Und lasst euch nicht mehr blicken.“ Und alle gleicher Meinung, rotten sich zusammen, uns vom Platz vor der Kirche zu verjagen. Als wären wir des Teufels. Einer der Männer verteidigte uns. Da verprügeln sie auch ihn, als wäre er ein Roma. Sie streiten um Sachen, die keinen Streit wert sind. Nur weil wir Roma sind? Die Mahnung des Pfarrers missachtet, verdrängt.
Gleiches am letzten Samstag auf dem Wochenmarkt. Als wir das letzte Stück beendet hatten, klatschte einer lange und ausdauernd Beifall. Ein anderer protestierte. Gerieten in Streit. Der eine fand unser Spiel großartig, der andere miserabel und keinen Heller wert. Schreien sich an und schlagen zu. Rasch bilden sich Parteien. Die bald schimpfen und handgreiflich werden wie die beiden, die den Streit begannen. Als gäbe es keine Worte, Streit zu schlichten. Sie bräuchten einen Friedensrichter, um miteinander auszukommen.
Streit gibt es auch bei uns. Auch verjagte einer schon mal im Zorn einen Nachbarn von seinem Platz, aus seinem Wagen. Aber der Tag noch nicht zu Ende, vertragen sie sich wieder. Neid und Ausschluss kennen wir nicht. Ein gewisses Urvertrauen schweißt uns zusammen. Vielleicht hat uns das Schicksal zusammen geschmiedet. Wie Glied an Glied einer Kette. Und niemand kann sich losreißen, um andere Wege zu gehen. An die Kette gelegt nichts anderes als miteinander auszukommen. Und sich zu lieben im Falle des Falles: Glied ist ein Mann, das andere eine Frau. Unterwegs im Land kennen und lieben gelernt. Oder auf der gemeinsamen Wallfahrt nach «Saintes Maries-de-la-Mer». Kirchlich verbunden, bis der Tod sie scheidet.
Mit den Jahren wurde mir immer mehr bewusst, dass unterwegs sein unser Schicksal ist. Aber viele Roma, die ich kenne, leiden nicht unausgesetzt darunter. Wie Außenstehende vermuten könnten. Sie haben sich arrangiert. Die Sehnsucht nach Bleibe in der hintersten Herzkammer vergraben wie einen Schatz. Aufbewahrt für den Tag, der kommen wird. In unserem Leben oder dem einer künftigen Generation.
Bis dahin aber ziehen sie weiter. Führen ein ganz normales Familienleben. Temperamentvoll, wie sie sind, lieben, streiten und versöhnen sie sich. Lagern unterwegs auf Wiesen, in Waldlichtungen. Oder auf freien oder günstig gepachteten Plätzen nahe einer Stadt. Die sie verachten, sind für sie Fremde mit schlechten Manieren. Nicht wert, sich aufzuregen. Das eigene Glück zu gefährden. Es reicht, sie bezahlen uns, wenn wir musizieren. Kessel flicken oder Kleider. Prophezeien, was sie wissen wollen.
Ich versuche, genauer zu denken. Ist es nicht auch so, dass wir doch eine Beziehung zu ihnen haben? In einem gewissen Sinne abhängig sind? Wir werden vertrieben von Menschen. Abhängig also von deren Moral und ihren Gesetzen. Fliehen vor ihnen aus Furcht vor Ächtung und Schlimmerem. Abhängig von unseren Gefühlen. Glauben aber, wir sind frei, zu bleiben oder zu gehen. Reden es uns vielleicht nur ein, um einen Rest von Selbstachtung zu bewahren.
Oder ist es in Wahrheit doch die jahrhundertealte Sehnsucht, anerkannt zu werden? Egal wo wir leben. Gleich wertvoll als Mensch, wie jeder andere auf dem Globus. Im Mittelalter hat man uns pauschal wie Diebe und Räuber behandelt, wenn einzelne gegen das Gesetz verstießen. Sodass wir flohen, bevor sie uns vor Gericht zerren konnten. Noch 1726 hat man Zigeunerbanden, so nannten sie uns, in Gießen öffentlich hingerichtet. Von Bürgern der Stadt bejubeltes Spektakel. Wer sind die besseren Menschen? Die oder wir?
Die mit weißer Haut oder die mit einer dunkleren? Die einen gelernten Beruf ausüben, Geld verdienen und eine vielköpfige Familie unterhalten können? Ein eigenes Haus ihr Eigen nennen, aus Steinen gebaute Sicherheit? Mit einem Dach aus roten Ziegeln und einen Garten, in dem Rosen blühen und Bäume Früchte tragen, die einen.
Oder die musizieren, Kupfergeschirr reparieren müssen, um zu überleben, Kleider flicken, wahrsagen oder gar betteln? Mit einem umgebauten Bauernkarren unterwegs, von einem alten Gaul gezogen, der bald sterben könnte, die anderen. Nichts anderes haben als sich selbst. Nichts anderes dürfen als weiterziehen.
Andere Mitglied in einem Verein, in dem sie sich profilieren können. Ratsherr werden oder gar Bürgermeister. Sind all diese Leute die besseren Menschen, weil sie eine Mehrheit darstellen? Und wir eine Minderheit? Dazu noch dunkelhäutig und ohne festen Wohnsitz. Ohne jede Chance dazu zu gehören. Auf sich selbst angewiesen und die Hilfe Gottes. Und unserer Schutzpatronin, der schwarzen Sara.
Warum mögen sie uns nicht?