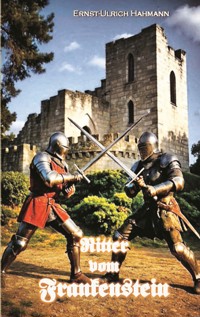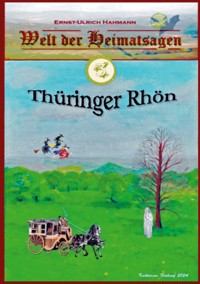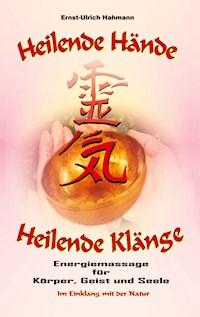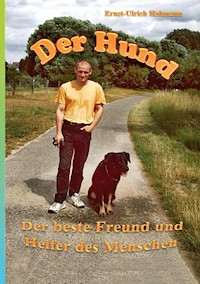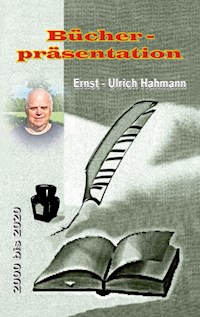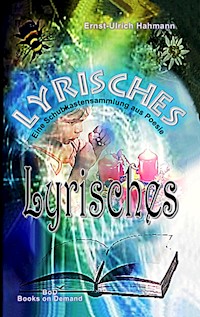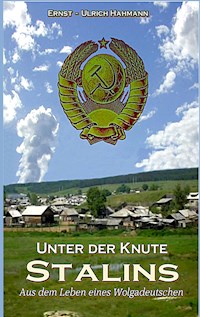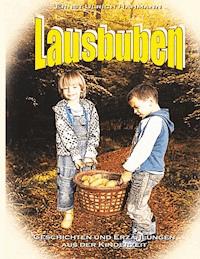Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Welt der Heimatsagen
- Sprache: Deutsch
Die Heimatsagen sind ein Bestandteil der nationalen Poesie und legen Zeugnis ab von der künstlerischen Kraft des Volkes. In Volkssagen sind immer bestimmte Landschaften, Städte, Dörfer oder Häuser Schauplatz der Handlungen. Die in diesen Band vorgestellten Heimatsagen beziehen sich auf Orttschaften, die im Werratal liegen, von Breitungen über Bad Salzungen bis nach Vacha. Doch beschreiben uns die Sagen nicht nur den Ort genau. Sie entwirft auch ein knappes, aber charakteristisches Bild von Menschen, über die sie berichten. Sagen sind nicht frei erfunden, ihnen liegt etwas tatsächlich Geschehenes zugrunde. Sie gehen von wahren Begebenheiten aus, die sich im Laufe der Jahre verändert haben und werden häufig mit Wunderbarem und Abenteuerlichem durchflochten. Die phantasievollen Erklärungen verleihen unseren Sagen den romantischen, geheimnisvollen Schimmer, die man heute noch mit großem Vergrnügen lesen kann. Aus den Sagen spricht die Sehnsucht des Volkes nach einem Leben, das frei sein soll von Hunger und Fron, von Habsucht und jeglicher Unterdrückung. In den Sagen träumten die Menschen von gesellschaftlichen Verhälnissen, die ihren Wünschen entsprachen. Ein großer Teil der Sagen stimmt ernst und nachdenklich, andere schildern lustige Streiche und Einfälle, hinter denen ein gut Teil Mutterwitz und Ironie steckt. Die Welt der Heimatsagen will unterhalten, erfreuen und die Phantasie beflügeln. Sie will aber auch ein tiefes Interesse wecken, sie möchte ein lebendiges Bild der Vergangenheit entstehen lassen, denn nur, wer die Vergangenheit seines Volkes wirklich begreift, wird auch die Zukunft meistern können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alte Geschichten und Sagen
Der schwarze Mann auf dem Heckenwege am Mühlberg bei Salzungen
Das verwunschene Schloß im Buchensee
Die weiße Jungfer im Gartenhaus der kleinen Stete
Die Teufelskutte
Von dem Wahrzeichen der Stadt Salzungen
Die Schlacht um die „Heiligen Quellen!
Die heilsame Quelle
Die Pest in Salzungen
Raubgesindel
Die Warnung des schwarzen Vogels
Ein Tag des Schreckens
Die Sage von der Geistermette
Vom langen Fähnrich
Das Hexenbild
Von der gläsernen Kutsche in Husen
Die Braut in der Husenkirche
Wie in Salzungen eine Mutter ihrem Kinde die Ruhe im Grabe raubte
Wie ein Salzunger Beutler den Teufel prellt
Die Christmette in der Husenkirche
Das Besprechen des Feuers
Der heillose Ratsmeister von Salzungen
Der Hexenzug am Husenbrückchen bei Salzungen
Die zwä Löngebaim am Saalzinger See
Der Hempferlingsmüller zu Nenchendorf
Der Blitzstrahl als Strafe Gottes
Die Nixe des Salzunger Sees
Der tolle Fuhrmann
Der Teufel als Kartenspieler
Der weise Mann und der Erdspiegel in Salzungen
Vom Otternkönig im Grundhof
Die unüberwindliche Schnepfenburg
Das Hockeldeink
Vom spukenden Bauer am Frankenstein
Die Raubritter vom Frankenstein
Der Schatz am Frankenstein
Die Jungfrau vom Frankenstein
Die Tulipan von Frankenstein
Eine trügerische Hoffnung
Der Jungfernstein
Die schwebende Jungfrau
Der schwarze Ritter
Belagerung der Burg Frankenstein
Vom Aap (Alp) in Möhra
Der gebannte Geist auf dem Sorghof bei Salzungen
Der Liethebaum
Der feurige Mann an der Silge
Wie ein Zweifler wieder zum Glauben geführt wird
Die Wasserfrau und das Kind
Der Fleischer und die verliebte Wasserjungfer
Weshalb die Diakonen der Stadt Salzungen, wenn sie in Langenfeld zu predigen haben, fünf Batzen Wegegeld erhielten
Von der Ettmarshäuser Gartentür
Die alte Gänseliesel
Die Geschichte vom Silberglöckchen des Salzunger Rathauses
Die Geisterkutsche am Buchensee
Wie roter Dost den Teufel vertreibt
Der Pariser Karl
Von dem gespenstischen Nachtwandler des ehemaligen Friedhofes
Der Wassermann im Salzunger See
Die drei Seejungfrauen
Des Löwenwirts Magd und die Nixe aus dem Buchensee
Vom Schafhof zu Dorf Allendorf
Die kreißende Nixe im Salzunger See
Woher der
Moscheweg
seinen Namen hat
Von der weißen Frau auf dem Krayenberg
Boten des Fegefeuers
Die Kniebrechspalten
Der durstige Klosterer
Die alte Burg Liebenstein
Von den Hunden von Wenkheim auf Altenstein
Die Coeur-Sechs über den Eingang der Apotheke in Tiefenort
Vom verwünschten tollen Fuhrmann
Von der Burg Kraienberg (Krayenberg)
Die Männer am Flußberg
Der Schatz auf dem Schneidersberge bei Wildprechtroda
Der Steinbacher Bieresel
Der Pummpälz
Die weiße Frau vom Möhra
Der Umgänger von Leimbach
Der feurige Mann und die alte Schwarz von Leimbach
Die Sage vom Gespenst beim Gottesacker zu Breitungen
Von der Hexe und ihrem Balge
Vom roten Dost gegen Hexen und Teufel
Sage vom winkenden Feuermann
Sagen von den Kroaten in Frauenbreitungen
Sage vom Glitt- oder Kroatenstein
Von den Knoten beim Hauenhof
Die drei Mönche zu Frauenbreitungen
Vom feurigen Reiter
Der Popposaal im Schloss zu Burg- und Herrenbreitungen
Vom Hexenbiss bei Herrenbreitungen
Von der Dornhecke oberhalb Herrenbreitungens
Von den beiden Herrenbreitunger Mönchen und der Herrenbreitunger Nonne
Vom Tränenkrüglein in Unterrohn
Vom Geldbirnenbaum bei Unterrohn
Vom Wichtelmännchen am Haspelsgraben bei Unterrohn
Wie einem der Sparpfennig die Ruhe im Grab raubt
Das „Narren“ am alten Schloss Krayenberg
Von der weißen Frau auf dem Krayenberg
Der Kieselbacher Schneider und die weiße Frau vom Krayenberg
Die Verwunschenen auf dem Krayenberg
Von der Geisterhand auf dem Krayenberg
Das „Minnichsloch“ an Krayenberg
Vom weißen Hirsch am Krayenberg
Der feurige Mann bei Kieselbach
Die Geschworenen - Eiche
Vom Siechenhund bei Vacha
Von der Brücke zu Vacha
Das Spukhaus in Kaltenborn
Vom Scherstieg
Von Barchfeld und der Barchfelder Brücke
„Vietche im Töpfche“ zu Vacha
Wie das Dorf Merkers zu seinem Namen kam
Vom Arnsberger Schlösschen oberhalb Merkers
Der feurige Mann bei Merkers
Vom sitzen gebliebenen Fuhrmann bei Merkers
Ortsverzeichnis
Abkürzungen
Genutzte und weiterführende Literatur
Alte Geschichten und Sagen
Wer behauptet, dass die alten Geschichten und Sagen,
das überlieferte Erzählgut aus vergangenen Tagen,
nicht mehr leben würde in der heutigen Zeit,
der hat sich nie beschäftigt mit der Vergangenheit.
Heute lauscht man keinem Erzähler mehr, wie gewesen,
jedoch als Kulturgut kann man sie in Büchern lesen.
Ja, sie leben immer noch, die alten Geschichten und Sagen,
die Unerklärliches, Gutes und Böses, zum Inhalt haben.
Auf unterhaltsame Weise geben sie Einblick in das Leben,
mit all dem Sehnen, dass es einst die bessere Welt wird geben.
Unsere Vorfahren schufen sie, die alten Geschichten und Sagen,
die in sich die Sehnsüchte und Hoffnungen der Menschen tragen.
Lehren, aus ihnen zu ziehen, für die Gegenwart es gilt,
damit die Zukunft bekommt ein gerechtes Bild.
Denn die Vergangenheit in den alten Geschichten und Sagen,
sie kehrt niemals wieder mit all ihren Fragen.
Jedoch aus ihnen die Kraftquelle für die Zukunft entspringt,
die die Einheit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bedingt.
Deshalb hört auf die Lehren der alten Geschichten und Sagen,
die in vielen Dingen in sich den Sinn des Lebens tragen.
(EUH)
Der schwarze Mann auf dem Heckenwege am Mühlberg bei Salzungen
Im Walde auf dem Mühlberg, da wo der aus dem Bohnengrund heraufführende Weg den nach der Hecke kreuzt, soll einst zu Nachtzeiten der Spuk umhergegangen sein. Ein schwarzer Mann so heißt es, hätte hier an diesem Ort jeden Vorbeikommenden in Angst und Schrecken versetzt. Zitternd am ganzen Körper und ohne Orientierung wären die Gefoppten durch den finsteren Wald gestolpert. Manch einer von ihnen habe erst im Morgengrauen den Weg aus ihm herausgefunden.
Über den schwarzen Mann auf dem Heckenweg am Mühlberg wurde viel gemunkelt. Ein arger Sünder soll er zu Lebzeiten gewesen sein. Schlau und gewitzt habe er die Gerichtsbarkeit übertölpelt, sodass ihm die weltlichen Richter nicht beikommen konnten.
Eines Tages, als die Sonne bereits hinter den Rhönbergen verschwand und es zu dämmern begann, traf ein Bote in Salzungen ein. Dieser bat den Fallmeister, doch schnell nach Möhra zu kommen, um dort ein gefallenes Schwein abzuholen.
Der Fallmeister machte sich auch sofort auf den Weg. In Möhra angekommen hatte er bis in die späte Nacht hinein zu tun. Da die Möhrarer Bürger die Spukgeschichten vom schwarzen Mann auch kannten, boten sie dem Fallmeister eine Bleibe für die Nacht an.
Doch vergeblich, denn der Fallmeister lehnte dankend ab. Da dieser kein Hasenfuß war, begab er sich noch in der gleichen Nacht auf den Heimweg. Der Mann schwang sich auf sein Pferd und jagte im Galopp über die im hellen Mondschein liegenden Felder. Erst als ihn das Waldesdickicht des Mühlbergs umfing, zügelte er das Pferd zum leichten Trab.
Der Fallmeister näherte sich dem bewussten Kreuzweg.
Plötzlich scheute das Pferd und blieb wie angewurzelt stehen.
Vergeblich bemühte er sich, es von der Stelle zu bringen.
Als der Mann sich nach der Ursache für das ungewöhnliche Verhalten, seines an sonst so braven Pferdes umschaute, sah er etwas Dunkles quer über dem Weg liegen.
Der schwarze Mann war es.
Der Fallmeister schwang sich vom Pferd, zog sein langes Messer aus dem Gürtel und ging beherzten Schrittes auf den Spuk zu.
Der Schwarze rührte und regte sich nicht. Ein Hauch eisiger Kälte schien von ihm auszugehen.
Schon hatte der Fallmeister die am Boden liegende Gestalt erreicht. Ohne zu zögern gab er ihr einen kräftigen Fußtritt mitten in den Leib.
Rotglühende Funken sprühten auf und flogen weit umher, aber der schwarze Mann bewegte sich nicht.
Erschrocken sprang der Fallmeister zurück, hielt den Atem an und schloss die Augen bis auf einen kleinen Spalt.
Aus sicherer Entfernung beobachtete er die Gestalt.
Reglos wie zuvor lag der schwarze Mann auf dem Weg und versperrte ihn.
Obwohl den Fallmeister das Herz bis zum Halse schlug, besann er sich nicht lange. Er schloss für einen Moment die Augen ganz, atmete tief und langsam durch, um dann mit einem Satz zu der am Boden liegenden Gestalt zuspringen.
Die blanke Klinge des langen Messers blinkte im hellen Mondlicht.
Mit einem kräftigen Schnitt trennte der Fallmeister den Kopf vom Rumpf.
Die am Boden liegende Gestalt wurde durchsichtig und löste sich in Luft auf.
Der Spuk war plötzlich verschwunden, als hätte es ihn nie gegeben.
Vergeblich schaute sich der Fallmeister um, aber weit und breit war vom schwarzen Mann nichts zu sehen, der Erdboden schien ihn verschluckt zu haben.
Seit jener Nacht ward der schwarze Mann nie wieder gesehen, geschweige hat er je noch einen Menschen geängstigt.
Für das frevelhafte Tun hatte den schwarzen Mann die gerechte Strafe ereilt, durch den Scharfrichter Gottes in Gestalt des Fallmeisters.
Gottes Mühlen mahlen langsam, aber gerecht!
Das verwunschene Schloß im Buchensee
Nicht weit von Salzungen, nach Wildprechtroda zu, auf dem Gebiet des Übungsplatzes, ehemals der NVA und jetzt der Bundeswehr gehörend, liegt der Büchensee. In der gegenwärtigen Zeit wird dieser See schlechthin der Buchensee genannt und dient besonders den Jugendlichen aus der näheren Umgebung als illegaler Badesee.
In dem dunklen, kalten Wasser, des etwa hundert Schritte im Geviert großen tiefen Kessels, spiegeln sich die Kronen der Buchen, die prächtig am Ufer wachsen.
Wo jedoch das Wasser dort herkommt, auf diese Frage konnte bis zum heutigen Tage noch keiner eine befriedigende Antwort geben. Man munkelte zwar von einer unterirdischen Verbindung zum Salzunger See, aber der Beweis hierfür fehlt bis zum heutige Tag. Klar ist jedoch, dass der See weder einen Ab- noch einen Zufluss besitzt und beim Volke als geheimnisvoll und unergründlich gilt.
Vor vielen Hundert Jahren habe hier ein prächtiges Schloß gestanden, erzählt der Volksmund, in dem es immer hoch herging. Nicht Gottesfürchtigkeit soll an der Tagesordnung gewesen sein, sondern ein Leben in Saus und Braus.
Der alte Kantor Röder von Wildprechtroda berichtete von einem heillosen, schändlichen Leben des alten Schloßherrn. Auch die übrigen Bewohner des Schloßes sollen ebenso ruchlos und schlecht wie ihr Herr gewesen sein. Durch allerlei Teufelskünste hätten sie die schönsten Burschen und Mädchen der Umgegend ins Schloß gelockt, und dann, war’s um diese geschehen. Nie wurde wieder einer von ihnen gesehen.
Lange Zeit ging so das lasterhafte Leben.
An einem heißen Sommertag schmauste, trank und tanzte wieder einmal eine große Festgesellschaft im Schloß.
Weithin hörte man ihren Lärm.
Da kam ein kleines graues Männchen in ärmlichem Gewande des Weges. Die Beinchen taten ihm vom vielen Laufen weh und der Hunger knurrte ganz fürchterlich in seinem Magen. Er schritt durch das Schlosstor, ging über den beengten Hof und betrat ungesehen das Schloss.
Selbst die Knechte und Mägde hatten es nicht bemerkt, denn auch die zechten und tanzten im Schloßhof, wie ihre Herren oben im Festsaal.
Bescheiden blieb das graue Männchen an der Saaltür stehen und beobachtete mit lebhaften Augen das zügellose Treiben der übermütigen Gesellschaft.
Niemanden beachtete die verhärmte Gestalt.
Schließlich bat das Männchen mit leiser Stimme um ein wenig Brot und Wasser sowie um ein karges Nachtlager für sein müdes Haupt.
Zornentbrannt ging der Schloßherr auf den ungebetenen Gast los, ergriff ihn an seinem zerschlissenen Rock und warf ihn kurzerhand aus dem Fenster hinab in den Hof.
Kaum war dies geschehen, da zogen Fern über den Rhönbergen dunkel und drohend Gewitterwolken auf. Grelle Blitze zuckten über den schwarzen Himmel und dumpf grollte der Donner.
Johlend hatte die Menge, bis auf drei Damen, die zu Gast waren, zu geschaut. Sie waren die Einzigen, die den Schloßherrn beschwichtigen wollten und ihn baten, dem armen Mann doch ein Stückchen Brot und ein Nachtlager zu geben.
Alles Bitten war vergeblich.
Der Hausherr hetzte obendrein noch die Hunde auf den Armen. Hohn und üble Scheltworte klangen dem in panischer Angst fliehenden Männchen hinterher.
Kaum hatte sich das kleine graue Männchen vor den blutrünstigen Hunden in Sicherheit gebracht, da verzog sich sein faltiges Gesicht in maßloser Wut. Es drohte mit geballter Faust zum Schloß hinüber und rief mit lauter Stimme: „Verflucht sei dieses Haus und jeder Stein von ihm! Verflucht seien der Herr und all sein Gesinde, verflucht auch die Gäste auf alle Zeit! Versinken soll die frevle Brut in ewiger Finsternis!“
Kaum hatte das graue Männchen diese Worte ausgesprochen, zuckte ein greller Blitz hernieder, gefolgt von einem krachenden Donnerschlag. Erste Regentropfen prasselten nieder. Blasen bildeten sich dort auf dem lehmigen Boden, wo sie auftrafen. Kleine Fontänen spritzten hoch.
Auf der Stelle versank das Schloß mit seinem übermütigen Herrn und den johlenden Gästen donnernd und krachend in den Schoß der Erde. Dort, wo das Schloß gestanden hatte, spiegelte sich am anderen Tage das Licht der aufgehenden Sonne in einem kleinen, unergründlichen See, der in einem tiefen Kessel lag. Die Wasseroberfläche glitzert im hellen Schein der Morgensonne wie flüssiges Silber.
Blick auf den Buchensee.
Den drei Damen, die den Armen gern eingeladen und keinen Anteil an der Härte und dem Hohn hatten, womit jener abgewiesen wurde, erging es nicht viel besser. Gleichwohl versanken auch sie mit dem Schloß. Aber es wurde ihnen vergönnt, alle Jahre zur Wildprechtrodaer Kirmeszeit als Nixen den Tanzsaal zu besuchen. Sie wurden hier ständig von den Burschen des Dorfes umworben und in einem fort zum Tanzen aufgefordert. Ihre liebliche und zarte Schönheit, ihr offenes Wesen und ihre Anmut ließen viele der Burschenherzen höher schlagen.
Pünktlich, mit dem Glockenschlag zwölf rüsteten sie zum Aufbruch und ließen sich auch durch kein Bitten, einen Augenblick länger zu bleiben, aufhalten.
Man wusste nicht, woher sie kamen noch, wohin sie gingen, man nannte sie nur die drei Jungfern aus dem Büchensee.
Ein Jäger aus Wildprechtroda, auf dem Heimweg von der Schnepfenjagd, sah die Drei einst in ihrem altmodischen Wagen vorbeifahren. Erstaunt folgten seine Blicke dem uralten Gefährt, in dem solch jugendliche Schönheiten saßen. Da er annahm, dass sie seine Herrschaft besuchen wollten, schwang er sich, um schneller vorwärtszukommen, hinten auf den Kutschtritt.
Die Hufe der Pferde und die eisenbeschlagenen Holzräder wirbelten bei der rasenden Fahrt der Kutsche den Staub des Feldweges hoch auf und nahmen dem Schnepfenjäger jegliche Sicht. Mit einem Male hörte er es rauschen, und unversehens spritzte schon Wasser über ihm zusammen. Geschwind sprang er vom Kutschtritt und erreichte nur mit müh und Not das rettende Ufer.
Der Wagen war in den Buchensee hineingefahren und verschwand gluckernd in der unergründlichen Tiefe.
Nass wie ein Pudel erreichte der Schnepfenjäger Haus und Hof.
Wieder einmal erschienen die schönen Jungfrauen zum Kirmestanz in Wildprechtroda.
Nur diesmal gab es einen Burschen, dem es lieb gewesen wäre, wenn sie für immer blieben. Mit der Schönsten von ihnen tanzte er den ganzen Abend.
Wonnetaumel ergriff den Jüngling und die Stunden verronnen wie im Fluge. Wie sie tanzten, was sie sprachen, ward ihm die ganze Zeit nicht bewusst. Selbst das wirbelnde, jubelnde Festtreiben, das sie umgab, nahm er nicht war. Tief schaute er in die leuchtenden Augen der schönen Jungfrau und sah in diesen das Paradies für sich blühen. Mit aller Klarheit wurde ihm bewusst, er liebte diese Maid.
Diese Einsicht ließ alles andere in den Hintergrund treten.
Der Bursche konnte nicht satt genug davon bekommen, ihrer lieblichen Stimme zu lauschen. Zärtliche Worte flüsterte er ihr ins Ohr. Nichts tat ihm mehr leid, dass sie jeden Abend nachts nach zwölf Uhr verschwunden war, während die Kirmes Tag und Nacht fortdauerte. Um sich von seiner Herzallerliebsten nicht trennen zu müssen, stellte er eines Nachts kurz entschlossen die Dorfuhr zurück.
Zwei der Jungfrauen erkannten das schändliche Spiel des Buben. Sie hielten ihre Zeit ein und kehrten rechtzeitig zum See zurück.
Die Dritte ließ sich täuschen und blieb. Im steten Gespräch und Scherz merkte sie den Verzug der Zeit nicht, sie war etwas in den hübschen Kirmesburschen verliebt.
Da krähte der Hahn.
Mit einem fürchterlichen Schrei riss sich die Nixe los und stürzte laut jammernd dem See zu.
Erschrocken lief der Bursche ihr nach.
Vergeblich bemühte er sich, sie zum Bleiben zu bewegen, konnte aber nicht verhindern, dass sich die Nixe in das hoch aufspritzende Wassers des Buchensees stürzte.
Entsetzt weiteten sich seine Augen über das tosende Brausen im Kessel, aus dem bald darauf ein starker Blutstrahl senkrecht emporschoss.
Als am folgenden Morgen etliche Leute am See vorbei kamen, hörten sie ein klägliches Wimmern und sahen einen blutig roten Fleck auf der Wasseroberfläche schwimmen.
Seit dieser Zeit kamen die Jungfrauen nimmermehr zum Kirmestanz nach Wildprechtroda.
Viele Jahre vergingen.
Ein neuer Herr siedelte sich in Wildprechtroda an und die unheimliche Geschichte mit dem Schloß und dem traurigen Los der Nixen geriet langsam in Vergessenheit.
Bis, es muss an einem heißen Sommertag gewesen sein, ein jugendlicher Mann auf seinem Weg nach Wildprechtroda am Buchensee vorbeikam. Verschwitzt wie er war, wollte er sich hier bei einem kühlen Bade erfrischen. Mit gleichmäßigen Schwimmzügen durchquerte er die sich leicht kräuselnde Wasseroberfläche und tauchte in der Mitte des Sees in dessen unergründliche Tiefe hinab. Lange blieb er verschwunden und ein jedermann musste annehmen, dass er ertrunken sei. Endlich, keiner wusste, wie viel Zeit verstrichen war, teilte sich die Wasserfläche und der Kopf des Schwimmers tauchte aus der Tiefe der Flut auf.
Das Gesicht verstört und bleich.
In der Dorfkneipe erzählte er anschließend bei einem Humpen Rotwein, dass er wunderbare Dinge dort unten erblickt habe.
Einmal neugierig geworden, wollten die Dorfbewohner von ihm wissen, was er auf dem Grund des Sees gesehen und erlebt habe.
Doch der Mann schwieg beharrlich.
Von dem Gerede erfuhr der Schloßherr. Er schickte einen Diener aus, den Kerl auf sein Schloß einzuladen. Neugierig geworden, wollte er ihn nach den geheimnisvollen Geschehnissen auf dem Grund des Buchensees ausfragen.
Der immer noch verstört aussehende Mann rückte nicht mit der Sprache raus und beteuerte immer wieder: „So gerne ich auch wollte, ich kann nicht. Ich habe einen Eid bei meinem Leben schwören müssen“.
Da sprach der Schloßherr: „Gut, dort mein Ofen ist kein Mensch, erzähle nun dem, was du gesehen, so brichst du deinen Eid nicht!“
Der Mann stutzte, tat jedoch, wie ihm geheißen, und erzählte: „Tiefer und tiefer tauchte ich hinab und glaubte den Grund des Sees erreicht zu haben. Da packte mich eine unsichtbare Kraft und zog mich noch weiter und weiter hinab. Dunkler und dunkler wurde das anfangs grünlich schimmernde Wasser. Plötzlich, ich glaubte, meinen Augen nicht mehr trauen zu können, tauchte auf dem schlammigen Grund des Sees ein gar herrlich anzuschauender Kristallpalast auf. Im gleichen Augenblick trat aus dem Palasttor ein alter Ritter. Die ihm umgebenden bildschönen Jungfrauen sprachen mit lieblicher Stimme zu mir: Hab keine Angst du kühner Taucher. Tritt ruhig ein und folge uns geschwind. Ich tat’s. Sie führten mich durch alle Gemächer. Geblendet wurden meine Augen von den vielen glitzernden Schätzen und riesigen Reichtümern, die ich hier beisammen sah. In einem Saal war eine große Tafel mit köstlichen Speisen gedeckt und in goldenen Pokalen funkelte roter Wein. Über allen schien ein unheimlicher Zauber zu liegen und je länger ich in diesem Schloss verweilte, desto beklommener wurde mir zumute. Höflich lud man mich zu Speise und Trank ein. Ich wollte aber nicht dem Zauber erliegen und schlug dankend ab. Vergessen war mit einmal all der Reichtum und mich beschäftigte nur noch der Gedanke, wie ich hier wieder heil fortkommen würde. Davon wollten der Ritter und die Jungfrauen aber nichts wissen, bis ich ihnen versprechen musste, wieder zu kommen. Ich musste einen heiligen Eid leisten, keinem Menschen hier oben zu erzählen, was ich in der Tiefe des Sees gesehen habe. Anschließend wurde ich vor das Palasttor geführt. Ein fester Abstoß mit den Füßen vom schlammigen Grund trieb mich aufwärts, wo ich gleich darauf die Wasseroberfläche durchstieß. Wie köstlich kam mir hier die frische Luft vor. In tiefen Zügen diese einatmend füllte ich mit ihr meine Lunge. Mit kräftigen Schwimmzügen erreichte ich das steile Ufer.“
Der Schloßherr, der während der Erzählung nachdenklich geworden war, ließ den Mann, als er sich zum Weggehen anschickte, in den Kerker werfen und sorgsam bewachen.
Die Geschichte über die Schätze auf dem Grund des Büchensees ließen ihn nicht mehr los. Den unermesslichen Reichtum musste er sein Eigen nennen.
Er überlegte hin und her.
Endlich schien er eine Möglichkeit gefunden zu haben, wie er an die Schätze herankommen könne. Er ließ den Mann aus dem Kerker holen und befahl ihm unter Drohungen und Versprechungen, in den See hinab zu tauchen, um dort auszukundschaften, wie die Schätze, aber ohne die Sippschaft, heraufgebracht werden könnten.
Der Mann weigerte sich, aber vergebens. Er musste abermals hinuntertauchen in die unheimliche Tiefe des Buchensees.
Gluckernd auftauchende Luftblasen kennzeichneten die Stelle im Wasser, wo der Taucher in die Tiefe verschwunden war.
Ungeduldig wartete der Schloßherr am Ufer des Sees auf den Mann und die Schätze.
Vergeblich.
Für immer blieb der Mann verschwunden.
Der alte Ritter und die bildschönen Jungfrauen hatten den meineidigen Taucher in ihrem nassen Reich behalten. Er ist jedenfalls nie wieder ans Tageslicht gekommen.
Die weiße Jungfer im Gartenhaus der kleinen Stete
Sämtliche Gärten in der kleinen Stete, gleich links nach dem Bahnhof zu, gehörten einst einem steinreichen Patrizier. Von seinem vielen Geld ließ sich dieser Salzunger Bürger, er hieß Fulda, dort ein herrliches Gartenhaus mit einer großen steinernen Treppe bauen.
Die Sage berichtet, dass sich hier alle sieben Jahre, jeweils zur Geisterstunde, eine weiß gekleidete Frauengestalt gezeigt habe. Mit dem Glockenschlag 12 sei sie aus dem Nichts heraus aufgetaucht, lautlos zum Keller des Gartenhauses hingeschwebt und habe dabei einen Bund mit blitzenden Schlüsseln in der Hand gehalten.
Oft geschah es, dass sich zur mitternächtlichen Stunde eine oder mehrere Personen noch im Garten aufhielten. Erschrocken schauten sie der geisterhaften Erscheinung nach, die ihnen freundlich zunickte, als wollte sie sie auffordern, ihr ohne Scheu zu folgen. Im Keller des Gartenhauses, so flüsterte man hinter vorgehaltener Hand, sollte ein kostbarer Schatz vergraben liegen. Bis jetzt habe sich aber noch kein mutiger gefunden, der der weißen Jungfrau gefolgt sei, um den Schatz zu heben.
Es muss zu Beginn des Herbstes im Jahre 1860 gewesen sein. Licht, Farben, Schattenspiele - die ganze Pracht des Herbstes hatte sich in der Gartenanlage des Salzunger Bürgers Fulda wie in einem Zauberreich vereinigt. Schlanke Birken wiegten sich wie im Tanz zu dem säuselnden Wind und mit Stolz erhobenem Haupt stand eine mächtige Fichte erhaben und zeitlos über der bunten Vergänglichkeit.
Die Zeit zum Einbringen der Rüben stand vor der Tür.
So schafften auch drei Tagelöhner im Garten des Herrn Fulda. Im Schweiße ihres Angesichtes zogen sie den ganzen Tag eine weiße Rübe nach der anderen aus der feuchten Gartenerde. Mit scharfen Messern hieben sie grüne Blätter ab.
Der rot glühende Sonnenball hatte bereits den Horizont erreicht, als sich die Männer daran machten, die Rüben in den Keller des Gartenhauses zu tragen.
Die hereinbrechende Abenddämmerung schuf auf der langen, breiten Veranda unheimlich anmutende Schatten.
Bodennebel begann sich in milchigen Schlieren zwischen die Bäume und Büsche zu legen, deren Schatten immer länger wurden.
Als Erster verschwand der Jüngste, es war der Sohn des einen Tagelöhners, mit etlichen Rüben auf dem Arm in der dunklen Kelleröffnung.
Es waren kaum einige Minuten vergangen, da schallte durch die Abendstille ein markerschütternder Schrei aus dem Keller herauf.
Erschrocken blieb der Vater, der sich ebenfalls auf dem Weg zum Keller befand, an der oberen Treppenstufe stehen. Er ließ die Rüben, die er auf dem Arm trug, fallen und schaute besorgt in die dunkle Öffnung.
Der andere Tagelöhner, der ebenfalls den Schrei gehört hatte, hielt im Aufsammeln der Rüben inne.
Er richtete sich auf.
Erschrocken herüberschauend rief er mit forscher Stimme: „Was war das?“
„Ich weiß nicht“, antwortete der besorgte Vater zögerlich.
Da stürmte der Jüngste wie von Furien gejagt aus dem Keller hervor, den Vater fast umstoßend. Am ganzen Körper zitternd, bleich und atemlos kniete er nieder und jammerte vor sich hin: „Nein ..., nein ... mich bekommt keiner mehr in diesen verfluchten Keller ... Die weiße Jungfrau ..., es gibt sie wirklich ...“.
Besorgt fragte der Vater: „Was ist los? Was hast du, mein Sohn? Von was für einer weißen Jungfrau sprichst du?“.
Es dauerte noch eine geraume Weile, ehe der Sohn auf die Fragen des Vaters antworten konnte.
Mit unsicherer Stimme begann er dann zu berichten: „Meine Augen hatten sich schnell an das schummrige Licht im Keller gewöhnt und ich legte die Rüben in der hintersten Ecke ab. Da war plötzlich ein scharrendes Geräusch hinter meinem Rücken zu hören. Erschrocken fuhr ich herum und erstarrte wie zu einer Salzsäule. Ihr glaubt gar nicht ..., was ich dort sah ...“.
„Sag endlich, was hast du so Schreckliches gesehen“, drängte der Vater ungeduldig.
„Mich bekommt keine Macht der Welt mehr in den Keller.“
„Nun rede schon endlich, Junge! Wen hast du gesehen?“
„Gegenüber an der Kellerwand lehnte bewegungslos eine weiß gekleidete Frauengestalt mit einem blitzenden Schlüsselbund in der Hand. Neben ihr stand ein großer Hund, dessen Augen wie glühende Kohlen funkelten. Unheimlich waren die stummen Blicke der beiden, die mich am Ort festhielten. Unfähig war ich auch nur ein Glied zu bewegen. Wie gebannt starrte ich auf die weiße Frau und den großen Hund. Nur mühsam gelang es mir, den zwingenden Blicken auszuweichen. Und siehe da, ich konnte mich wieder bewegen. Einen Schrei ausstoßend stürzte ich wie von Sinnen aus dem Keller.“
An die Rüben dachte an diesem Tage keiner mehr, alles drehte sich um die geheimnisvolle weiße Frau.
Bereits am nächsten Tag ging das merkwürdige Erlebnis des jungen Tagelöhners von Mund zu Mund.
Die Teufelskutte
Nicht mehr als hundert Schritt südlich vom Burgsee befand sich einst in einem Loch, unter einem eingerissenen Felsen ein unheimliches Gewässer.
Den Felskessel, in dem der kleine Weiher von dichtem Gebüsch umgeben lag, wurde im Volksmund die Grube genannt.
Einst speiste dieses tiefe Wasserloch den Burgsee.
Die schauerlichen Sagen, die diesen kleinen See um flüstern, ließen seinen unheimlichen Namen Teufelskutte entstehen.
Vor vielen, vielen Jahren soll es geschehen sein, zu einer Zeit, als dort noch keine Rehabilitationsklinik und der aufsteigende Promenadenweg die Kutte vermissen ließen.
Gottlose Herrschaften preschten einst in ihrer noblen Kutsche, von zwei Rappen gezogen durch die finstere Nacht.
Riesige Wolkenberge ließen nicht einen Strahl des silbrigen Mondlichtes zur Erde dringen.
Gespenstisch war die Nacht.
Da näherte sich die Kutsche im wilden Galopp der Kutte.
Die stahlumspannten Reifen knirschten schauerlich im Sande des Weges.
Über dem unheimlichen Gewässer wallten haushoch milchige Schwaden auf.
Wie sichtbar gewordenes Unheil flogen sie hoch.
Ein milchiges Wechselspiel von dunklen und hellen Schatten.
Plötzlich zuckte ein greller Blitz aus dem nachtschwarzen Himmel hernieder.
Augenblicke später tauchte aus den tanzenden Schlieren ein Wesen auf. Ein Wesen, das nicht von dieser Welt war.
Unheimlich!
Grauenvoll!
Schrecklich!
Über dem See schwebte der Teufel in einem grellen, bläulich fluoreszierenden Licht.
Der Kutscher auf dem Bock wurde geblendet.
Tausend helle Pünktchen tanzten vor seinen Augen.
Er konnte nichts mehr sehen.
Der Pferde scheuten, sie bäumten sich auf und rasten mit der Kutsche samt Insassen in den Kessel hinein. Hoch spritzte das Wasser auf, als sie in der Tiefe des unheimlichen Sees verschwanden.
Auch der Teufel war verschwunden.
Nur in der Ferne wetterleuchtete es.
Gespenstisch lohte ein violett-schwarzes Licht über die tief hängenden Wolkenberge.
Regentropfen fielen hernieder.
Unheimliche Finsternis deckte den Mantel des Schweigens über das Geschehene.
Nur das monotone Rauschen des einsetzenden Regens schien allgegenwärtig zu sein.
Die Teufelskutte hatte die Gottlosen verschlungen und sie bis heute nicht wieder frei gegeben.
Andere wieder glaubten daran, dass der Teufel dann und wann hier des Nachts ein abkühlendes Bad genommen habe. Dann wollten sie gesehen haben, dass der Satan in Gestalt eines neunköpfigen Drachens feuerspeiend in das unheimliche, unergründlich tiefe Wasser hineingefahren sei. Zischend sei das kühle Nass aufgeschäumt und dichter weißer Dampf hätte über dem Tümpel gelegen.
Auch will man gesehen haben, dass jedes Mal, wenn der Teufel als feuriger Drache über die Grube flog, er vergangen sei und seinen feurigen Schein verloren habe.
Von dem Wahrzeichen der Stadt Salzungen
Einst soll die Stadt Salzungen ein Wahrzeichen ihr Eigen genannt haben, nur weiß heute niemand mehr etwas Genaues darüber zu berichten. Zu seiner Zeit soll jedoch der Chronist Christian Junker noch einiges über ein Salzunger Wahrzeichen gewusst haben. In seiner Geschichte spielt die Salzunger Stadtkirche, die den heiligen Märtyrern Simplicius und Faustinus sowie ihrer Schwester Beatrix geweiht worden war, eine wichtige Rolle.
Die eine Seite der eben erwähnten Kirche lag genau gegenüber der Schnepfenburg, und hier soll man dem Chronisten anno 1703 das Wahrzeichen der Stadt gezeigt haben. Mit seinen eigenen Worten beschrieb Christian Junker es als ein Bildnis, dass aus zwei steinernen Wappen, mit einem oben und unten eingemauerten steinernen Kopf und der Inschrift Heinrich von Leimbach bestand.
Dieser Heinrich von Leimbach, so erzählt man weiter, war ein treuloser Ehemann, der seine ihm Angetraute mit anderen Frauen betrog. Als die ruchlose Tat des Ehebruchs ans Tageslicht kam, wurde er nach althergebrachter Sitte bestraft. Heinrich wurde beauflagt, die Seite des Chores der sich gerade im Bau befindlichen Kirche St. Simplicii auf seine Kosten errichten zu lassen. Auf dieser Seite der Kirche wurde das Wahrzeichen der Stadt Salzungen angebracht. Der obere steinerne Kopf im Wahrzeichen wies deutlich die Züge eines Weibes auf und der untere die eines Mannes. Die Darstellung zeigte, wie das Weib hinab zum Haupt ihres Mannes Heinrich von Leimbach schaut.
Am 5.11.1786 kam es in Salzungen zu einer fürchterlichen Katastrophe. Nachmittags gegen 3 Uhr, der Priester hatte gerade den Gottesdienst beendet, brach in einem Haus auf dem Markt ein Feuer aus. Rasch griffen die Flammen um sich und in wenigen Stunden war über die Hälfte der Stadt ein Opfer der Feuersbrunst geworden. Auch die Kirche St. Simplicii wurde vollständig in Schutt und Asche gelegt und so mit ihr die Skulptur an der Kirche - das Wahrzeichen der Stadt Salzungen - vernichtet. Erst im Jahre 1791 begann man wieder mit der Neuerrichtung der Stadtkirche, und zwar als klassizistische Saalkirche. Kein Wunder, dass in der heutigen Zeit nichts mehr von dem Wahrzeichen der Stadt Salzungen zu finden ist.
Die Bad Salzunger evangelische Stadtkirche „St. Simplicius“.
Die Schlacht um die „Heiligen Quellen!
Genau um diese Zeit, etwa im Jahre 9 n. Chr. drangen die Vorfahren der heutigen Thüringer, die Hermunduren in das Gebiet zwischen Elbe, Erzgebirge, Thüringer Wald, Werra und Harz vor. Auf der Wanderung durch das deutsche Land erreichte die wilde Horde schließlich das Werratal.
Es kam, was kommen musste, die „Hermunduren“ stießen auf die „Chatten“ und es dauerte nicht lange, dass die Sippen miteinander in Streit um die „Heiligen Quellen“ gerieten. Jeder wollte sie für sich in Anspruch nehmen.
Der Zwist weitete sich zu einem erbitterten Krieg um den Besitz der Salzquellen aus. In der Nähe des „Salsunga Sees“ trafen die bewaffneten Haufen der sich streitenden Stämme aufeinander.
Vor dem Beginn des Kampfes trafen die Chatten sich noch an der Opferstätte hoch auf dem Seefelsen. Uralter heiliger Schauer durchwehte hier den Hain, an den Baumstämmen bleichten die Schädel getöteter Opfertiere. Der Priester saß auf seinen angestammten erhöhten Platz und lauschte dem Gesang der Männer. Mit funkelnden Augen verfolgte er den Tanz der Jünglinge. Im Kreis kunstvoll bewegend schwangen die Männer feindlich drohend die Speere.
Auf einem Stein verblutete das Opfertier, dessen Fleisch anschließend in einem großen Kessel garte. Das Haupt des Tieres, das den Göttern gehörte, befestigten die Männer an dem nächsten Baumstamm des Opferhains.
Über das hell lodernde Feuer hinweg verfluchte der Priester das Feindesheer und rief: „Zornig ist Euch Tyr!“ Lautstark weihte er die Opferspeise und den Opfertrank mit den lautstarken Worten: „Männer, Rosse und jegliches Leben der Besiegten soll Dir gehören.“
Die Krieger schlangen das gesottene Fleisch und das Fett des Opfertieres schmatzend herunter, schlürften gierig die Brühe und glaubten, dadurch in die Gemeinschaft mit dem heiligen Opfer zu treten. Viele hielten Trinkgefäße in den Händen, die der Form des Rinderhorns oder die des Auerochsen nachgebildet waren. Die einen knapp halben Liter fassende Hörner waren bis zum Rand mit Met gefüllt.
Met war nichts anderes als Wasser und Honig, die man miteinander vermischte, zum Kochen brachte und gären ließ.
Genussvoll wurden die Trinkgefäße in einem Zug bis auf den Grund geleert.
Immer mehr gerieten die Männer in Ekstase und das Getränk schien den Zugang zu einer übersinnlichen Welt zu öffnen.
Der Priester fiel auf die Knie. Die Hände erhoben hallte seine Stimme leidenschaftlich gen Himmel: „Wir bitten Euch, oh Götter für den Sieg über den Feind! Wir bitten für Kraft, Mut und Ausdauer! Mars, Mercurius haltet die Hände schützend in der Hitze des Gefechtes über uns! Euer sei im Falle des Sieges die feindlichen Schlachtreihen, Männer, Rösser und alles, was sich bei den Besiegten befindet!“
Die Chatten mit den großen Langschilden und langen Lanzen verschanzten sich bereits in der Nacht vor dem Kampf. Mit strategischem Geschick verstanden die Männer es, Reih und Glied im Kampf einzuhalten, die Blößen des Gegners sofort wahrzunehmen und den richtigen Augenblick zum Angriff abzupassen. Sie verließen sich nicht auf das Glück, sondern setzten Vertrauen in die Tapferkeit. Weder Furcht noch Verzweiflung rief der Anblick der Barbaren bei den Männern hervor. Ihre Herzen füllte es weder mit Entsetzen noch vernebelte es die Sinne.
Diesmal sollte aber alles anders kommen.
Sich argwöhnisch belauern, fand keiner der gegnerischen Haufen den Mut, den ersten Schritt zu wagen, und es schien als wolle der Kampf gar nicht erst beginnen.
Doch, da!
Schlachtrufe erklangen!
Gekleidet in zottige Bärenfelle stürmten in Windeseile die fürchterlichen Hermunduren heran.
Die Chatten drängten sich aneinander und versuchten sich gegenseitig mit den Schilden zu schützen. Ihr Hände schlossen sich fest um den Schaft der Lanzen, deren scharfe Spitzen den Angreifern drohend entgegen starrten.
Immer schneller und schneller stürmten die Barbaren heran. Ihre Schreie und der laute Hörnerklang ließen die Erde und die Luft erzittern.
Grässlich wie die Posaunen von Jericho gellte die Melodie der Schlachthörner, verstärkt durch das Echo der umliegenden Berge und Hügel.
Der erste Speerwurf als Kampfansage rauschte heran.
Gebrochen war der Bann und mit Gejohle drangen die blutrünstigen Männer aufeinander. Zwei Herzschläge lang war die Welt ein wirbelndes Chaos aus verschwommenen Bewegungen, als die Bewaffneten aufeinanderprallten. Gewaltiges Krachen erfüllte im Augenblick des Zusammentreffens die Luft und hallte in den dichten Wäldern wider.
Die Kämpfenden hieben und stachen blindlings um sich. Eisenbeschlagene Holzkeulen krachten auf menschliche Schädel und ließen diese wie geknackte Nüsse zerspringen. Dutzende von Pfeilen stiegen gleich einer Vogelschar hinter den Linien der johlenden Haufen empor und fanden herniederprasselnd die Ziele.
Speere drangen in die Bäuche der Männer. In der Hitze des Gefechtes liefen die Kämpfenden noch einige Schritte weiter, bevor sie feststellten das aus ihrem Leib der Schaft eines Speeres ragte. Verwirrung auf den Gesichtern, laute Schreie ausstoßend schlossen sich die Hände um den Holzschaft. Der eine und andere versuchte mit letzter Kraft den Speer heraus zuziehen. Die Schreie endeten dann in Husten und Würgen, als sich ein Schwall dunklen Blutes aus dem Munde ergoss. Blut spuckend sanken die Getroffenen auf die Knie und rangen nach Atem.
Andere packten, dem vom Blut schlüpfrig gewordenen Schaft des Speeres fester und wandten sich einem neuen Gegner zu.
Die Gesichter verschwammen vor den Augen der Kämpfenden in einem Nebel aus Schweiß und Blut.
Todesschreie erfüllten die Luft.
Den Chatten gelang es mit den Leder überzogenen, hölzernen Schildern und 1,80 bis 2,40 langen Speeren, deren Schaft aus Eschenholz und einer zweischneidigen Eisenspitze bestand, die Wucht des ersten Ansturms aufzufangen.
Überall, wohin man blickte, haufenweise Leichen.
Verletzte krümmten sich leise wimmernd oder schreiend vor Schmerzen am Boden.
Dazwischen huschende Weiber die, die Entseelten forttrugen.
Der mit Erbitterung geführte Kampf wogte hin und her.
Mehr noch als die Sucht, alles mit der Waffe zu entscheiden, wirkte der Glaube, dass die Stätte, um die sich die Männer schlugen, dem Himmel besonders nahe sei und ihre Gebete von den Göttern nirgendwo besser vernommen würden als hier.
Fest glaubten die Männer daran, dass nur durch die Huld der Gottheiten das Salz in dem Flusse und in den Wäldern entstehen konnte und es aus den entgegengesetzten Elementen Feuer und Wasser erst erwachse.
Ihr Salz entstand nicht durch salzhaltiges Meerwasser, das in der heißen Sonne verdunstete, sondern durch das Übergießen brennender Baumstämme mit dem aus der Erde sprudelnden salzhaltigen Wasser.
Eben hatten die beiden Haufen noch gleichermaßen erbittert gekämpft, da wandte sich das Kriegsglück von den Chatten ab. Sie konnten sich kaum noch den Keulen- und Axthieben der wild um sich schlagenden Hermunduren erwehren, die wie Berserker wüteten, schrien, tobten und sich vor lauter Kampfeseifer gegenseitig über den Haufen rannten.
Dumpf rasselten auf Schädel und Schild Streithämmer und Kolben.
Immer wilder stürzten die Hermunduren in das dichteste Gewimmel, die deutlich an den Helmen aus Geweih und Löwenrachen zu erkennen waren.
Inmitten des dichtesten Gedränges schlug ein klobiger Kerl, sein Panzer schien aus Häuten schuppiger Drachen zu bestehen, mit blutverschmiertem Schwert um sich und mähte mit der schartigen und stumpfen Klinge einen Chatten nach den anderen erbarmungslos von den Beinen. Jeder seiner machtvoll geführten Hiebe trieb die Gegner Schritt für Schritt zurück. Das Schwert war für den unkultivierten Kerl mehr als nur eine Waffe. Es galt als Symbol kriegerischer Tüchtigkeit.
Plötzlich flog ein Hagel von Steinen und Schleuderkugeln durch die Luft und schlug in den Reihen der Chatten ein. Die Chatten mussten sich jetzt auch noch den Wurfgeschossen ausweichen.
Die Lücken in der Gefechtsordnung der Chatten wurden größer, die Schlachtenreihe begann auseinanderzureißen. Langsam zogen die Männer sich zurück. Für sie bedeute die sich abzeichnende Niederlage Verderben. Die feindliche Drohung und das Gelübde, das sie hoch auf dem Seefelsen abgelegt hatten, wandte sich nun gegen die Chatten selbst!
Die Angst drohte die Männer zu überwältigen, als klar wurde, dass die Schlacht so gut wie verloren war. Der Rückzug der Geschlagenen begann in der Mitte der Schlachtordnung und breitete sich wie ein Lauffeuer nach beiden Seiten aus.
Und als sich die Nacht senkte auf die Fluren des Werratals, da flohen die Chatten vor den Hermunduren. Aus dem Rückzug wurde eine wilde Flucht, die eine Spur aus Leichen hinter ließ.
Die Hermunduren nahmen die Verfolgung auf, eilten mit erschütterndem Geschrei hinter den Flüchtenden her, fest entschlossen den Fliehenden keine Gelegenheit mehr zu geben sich neu zu formieren. Sie trieben die Chatten, deren Gesichter panische Angst zeichnete in das rauschende Wasser der Werra.
Es schien, als wollten die reißenden Fluten schnell entfliehen. Sie ließen den Fluss mit Grauen anschwellen.
Blutrot gefärbt strömte es dahin.
Die Schlacht war entschieden.
Zahlreiche Leichen von Freund und Feind bedeckten das Schlachtfeld.
Der Tod hatte sie vereint.
Pfeile ragten aus ungezählten Körpern, die meisten waren gleich mehrfach getroffen. Lanzen, die in Leibern staken, ragten senkrecht in die Luft. Und dazwischen zerbeulte Helme, halbe Schilde, zerbrochene Pfeile und zersplitterte Lanzen.
Jetzt verübten die Hermunduren an den Besiegten das, was diese als Sieger getan hätten.
Es folgte die grausame Erfüllung des Gelübdes, eines Gelübdes, das Männer, Rösser und jegliches Leben der Besiegten den Göttern anheimgab. Alles, was an Männern und Pferden der Chatten den Hermunduren in die Hände fiel, wurde den Göttern Mars und Mercurius geopfert. Furchtbar in ihrer Zerstörungswut vernichteten sie alles Lebende. Die Beute wurde ins Wasser des Salzflusses geworfen. Gewänder zerrissen. Schilder, Speere und allerlei Kriegsgeräte zerstört. Aufgegriffenen Chatten hängte man kurzerhand mit Stricken um den Hals an den Ästen der nächsten Bäume auf und durchstach sie mit den eigenen Speeren.
Das Gemetzel, der Besiegten erfuhr kein Erbarmen.
Nicht mutwillige oder wütende Grausamkeit hatte diese schauervolle Tat bewirkt, sondern die Pflicht gegen die Kriegsgötter, welche die Opfer verlangten, nachdem diese die Bitte und das Gelöbnis erhört und den Sieg gegeben hatten. Nur diesmal nicht den Chatten, sondern den Hermunduren.
Die heilsame Quelle
Blutig umstritten waren in grauer Vorzeit die Thüringer Salzquellen, galt dieser kostbare Besitz doch als Geschenk der Götter. So stießen im Werratal bereits kurz nach Christi Geburt die Hermunduren auf die Chatten, die sich um den hier im Werratal liegenden See angesiedelt hatten. Es dauerte nicht lange und die zwei Stämme gerieten miteinander in Streit um die Heiligen Quellen. Jeder wollte sie für sich in Anspruch nehmen.
In einem erbitterten Gemetzel trafen die wilden Menschenhaufen aufeinander. Eben hatten die beiden Horden noch gleichermaßen erbittert gekämpft, da wandte sich das Kriegsglück von den Chatten ab. Sie konnten sich kaum noch den Keulen- und Axthieben der wild um sich schlagenden Hermunduren erwehren, die wie die Berserker wüteten, schrien, tobten und sich vor lauter Kampfeseifer gegenseitig über den Haufen rannten. Und als sich die Nacht senkte auf die Fluren, da flohen die Chatten vor den Hermunduren. Aus dem Rückzug wurde eine wilde Flucht, die eine Spur aus Leichen hinterließ.
Wer die Heiligen Quellen besaß, gelangte zu Reichtum und Ansehen, war aber auch nicht vor der Missgunst seiner Mitmenschen gefeit. So soll ein gewisser Plaue durch einen Salzbrunnen zu solcher Wohlhabenheit gekommen sein, dass alles in Samt und Seide gekleidet ging. Nur lange konnte er sich dieses Reichtums nicht erfreuen. Ein Siedeknecht verstopfte die Quelle aus Rache und belegte diese mit einem Zauberspruch.
Die Jahre vergingen und die Quelle geriet in Vergessenheit und mit der Zeit wussten nur noch wenige, wo sich diese befand.
Es muss im Jahr 1688 gewesen sein, da pflügte ein Bauer von Möhra in unmittelbarer Nähe Salzungens den Acker seines Vaters. Mit lauten „Hüh“ und „Hot“ trieb er die beiden Pferde an. Einen schweren Pflug hinter sich herziehend zogen die Gäule eine tiefe Furche nach der anderen in den fruchtbaren Ackerboden.
Als die Sonne am höchsten Stand war die Hälfte der Arbeit getan. Der Bauer setzte sich in den Schatten, der am Feldrain stehenden Bäume, um sich nach der getanen Arbeit etwas auszuruhen. Den Hut ins Gesicht gezogen döste er vor sich hin. Nach einer Stunde fuhr er erschrocken empor, er musste wohl eingeschlafen sein. Aufspringen und die Pferde antreibend ging es wieder an die Arbeit.
Und schon zogen die Pferde den schweren Flug durch den Ackerboden und brachen eine Erdscholle nach der anderen auf.
Die Arbeit war fast getan, als der Bauer erschrocken stehen blieb. Hinter ihm, in der letzten Furche sprudelte unvermutet eine starke Quelle zutage.
Molkiges Wasser quellte aus dem Boden und färbte die Erde ringsumher mit gelblichem Schlamm.
Vorsichtig kostete der Bauer die gelbliche Brühe und spie sie sofort wieder aus. Einen seltsamen Geschmack besaß das Wasser und der Mann ahnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht, welch köstliches Heilwasser da auf seinem Acker aus dem Boden floss.
Schnell sprach es sich in der Gegend herum, welche komische Flüssigkeit dort zutage trat.
Manch Neugieriger eilte hinaus auf den Acker und musste sich erst einmal selbst von der seltsamen Erscheinung überzeugen und von dem Wasser kosten.
Unter den Neugierigen befand sich auch der eine und andere Kranke. Doch welch ein Wunder, bereits nach kurzer Zeit waren die Gebrechlichen von ihrer Krankheit geheilt.
Das Wasser erwies sich als solch vortreffliches Heilmittel, das die Leute aus Nah und Fern herbeieilten, um von ihren Gebrechen geheilt zu werden. Bald hingen die in der Nähe stehenden Feldbirnenbäume voller Krücken. Die geheilten Lahmen hatten sie aus Dankbarkeit zurückgelassen.
Als die Gemeinde solches Wunder sah, erwachte der Eigennutz. Ganz schlaue Gemeinderatsmitglieder schlugen vor ein Häuschen über den segensreichen Born zu errichten. Und wer von dem Wasser trinken wollte, musste erst seinen Obolus in einen Opferstock werfen.
Gesagt, getan.
Was wurde aber nun aus der gezahlten Münze?
Das Geld kam nicht etwa der Gemeinde zugute oder wurde für wohltätige Zwecke verwendet, nein es floss nur in die Taschen der Gemeinderatsmitglieder.
Darüber erzürnten sich die gütigen Berggeister sehr, die dem Ort solchen Segen gespendet hatten.
Fernes Grollen hallte eines Tages aus der Ferne herüber. Der Wind frischte auf, wurde stärker und stärker und trieb Staub und Blätter wirbelten durch die Luft. Dunkle Wolken verfinsterten den azurblauen Sommerhimmel. Ein greller gezackter Blitz, begleitet von einen krachenden Donnerschlag, zuckte zur Erde hernieder und schlug mit ohrenbetäubendem Getöse im Häuschen das über der Quelle stand ein.
Hell loderten aus dem Gebäude die Flammen empor und es verging keine halbe Stunde, da war es in Schutt und Asche gelegt.
Sofort ging man daran die verkohlten Überreste der Hütte zu beseitigen, um die Quelle wieder in Betrieb zu nehmen. Wie groß war aber die Überraschung, dass nichts mehr von der Quelle zu finden war.
Alles Suchen war vergebens.
Die gütigen Berggeister hatten den heilsamen Quell versiegen lassen um somit die gierigen Gemeinderatsmitglieder für alle Zeit zu bestrafen.
Nur traf es auch die Gebrechlichen, die nun nicht mehr auf eine Heilung hoffen konnten.
Die Pest in Salzungen
In vergangenen Jahrhunderten gab es Zeiten, da wurde das Land von Seuchen heimgesucht. Eine der schlimmsten war die Pest oder der schwarze Tod wie sie im Volksmund genannt wurde. Ihr fielen nicht nur in Thüringen, sondern in ganz Deutschland Hunderte, ja Tausende von Menschen zum Opfer. Diese Geißel der Menschheit machte auch vor den Toren Salzungens keinen Halt. Zahlreiche Bürger der Stadt starben eines qualvollen Todes. Sie fanden ihre letzte Ruhestätte in der Nordwestecke des Friedhofes Husen, wo sie bis zum heutigen Tag ungestört modern.
Während des Dreißigjährigen Krieges war Salzungen eine kleine Landfestung mit Ringmauern und Gräben, die aber die Vorstädte, den Nappenbezirk und die Kunsthäuser am Niederborn nicht mit einschlossen.
Die Stadt besaß zu dieser Zeit etwa 2 200 Einwohner.
Im Jahr 1634 besetzte der kaiserliche General der leichten Kavallerie und Obrist eines Kroaten Regiments Isolani den Frontabschnitt von Schleusingen über Meiningen und Schmalkalden bis Salzungen. Seine Truppen gehörten zum Verband der Armee des Grafen Piccolomini.
Außerordentliche Kriegslasten kamen auf die unglückliche Stadt zu. Die Bürger Salzungens brachten, im Glauben sich von Plünderungen freikaufen zu können, kurz hintereinander zweimal je 3 000 Taler auf.
Vergeblich war dieses Bemühen, denn die Soldaten des Regimentes erstürmten am 16. Oktober die Mauern der Stadt. Sie schlugen die Tore ein und plünderten die Häuser. Wer Widerstand leistete, wurde niedergestreckt.
Für Salzungen hatte eine Zeit der Einquartierungen und der Plünderungen, des Mordes und des Totschlages begonnen.
1635 stellte sich, wie es auch nicht anders kommen konnte, eine große Hungersnot ein. Und die nicht genug, griff eine verheerende Seuche um sich, die die Soldaten eingeschleppt hatten. Allein in diesem Jahr gingen 1 400 Stück Vieh zugrunde und es starben 1 338 Menschen an dieser unheimlichen Krankheit.
Mit unterschiedlichen Methoden und Mitteln versuchten die Menschen, der verheerenden Krankheit Herr zu werden. Sie griffen nach jedem rettenden Strohhalm, der sich ihnen bot.
Sagen erzählen noch heute davon, was dabei in Salzungen geschah.
Viele Opfer hatte die Pest bereits gefordert, als man von einer geisterhaften Stimme berichtete, die im Stadtgebiet aus der Luft zu vernehmen war, die rief: „Koch Bibernell, sonst müsst ihr alle sterben schnell!“
„Wer hat da gesprochen? Wo kommt die Stimme her?“, flüsterten die Salzunger erschrocken hinter vorgehaltener Hand.
Vergeblich schauten sie sich um. Sie konnten jedoch niemanden entdecken und hielten es für einen bösen Spuk des Teufels.
Das Sterben wollte und wollte kein Ende nehmen. Es wurden immer mehr Stimmen unter den Bürgern laut, die verlangten, doch der geisterhaften Stimme Gehör zu schenken.
Was konnte denn noch Schlimmeres geschehen?
Noch immer skeptisch beschlossen einige Wagemutige, das Bibernell herzustellen und den Todkranken einzuflößen.
Das Sterben musste endlich sein Ende finden.
Und wirklich, es dauerte nicht lange, als sich der unerwartete Erfolg einstellte.
Etwas anderes geschah wiederum in einer Nacht, in der die Kälte eine Atmosphäre erzeugte, wie sie in einer finsteren Gruft herrschen mochte.
Der Nachtwächter zog seine Runde. Er hatte den Kragen des Mantels hochgeschlagen, die Mütze tief in die Stirn gezogen und die Hände in den Taschen vergraben, um sich vor der Kälte zu schützen. Sein Weg führte ihn durch die wie ausgestorben daliegenden Gassen der Stadt.
Fest waren die Türen der Häuser verschlossen.
Nirgendwo drang der kleinste Lichtschein durch einen Spalt der klapprigen Fensterläden.
Mitternacht nahte.
Totenstille, nur die schlurfenden Schritte des Nachtwächters hallten in der Dunkelheit wieder.
Kaum war der letzte Glockenschlag verklungen, der die mitternächtliche Stunde ankündigte, ließ ein seltsames Geräusch den alten Mann aufhorchen.
Was war das?
Vorsichtig schlich er bis zur nächsten Straßenecke. Was er da zu sehen bekam, ließ ihn an seinem Verstand zweifeln. Ein Schrei wollte sich seiner Kehle entringen, doch etwas Kaltes, das ihn in den Mund drang, ließ den Schrei nicht heraus.
Wie von Geisterhand öffnete sich gerade das Tor des Gasthofes Zum goldenen Ochsen. Ein langer Leichenzug, es waren Alte und Junge, Männer und Frauen, kam wankend daraus hervor. Sie trugen alle Anzeichen der Erschöpfung. Ihre rot unterlaufenen Augen, ihre blassen Gesichter und ihre müden Bewegungen waren deutliche Sprache genug.
Die runde Scheibe des blassgelben Vollmondes tauchte alles in gespenstisches Licht.
Langsam bewegte sich der unheimliche Zug bleicher Gestalten über den Marktplatz, die Ratsgasse hinauf. Das Getrappel der vielen Dutzend Schuhe auf dem holprigen Pflaster hörte sich merkwürdig an.
Wäre der Nachtwächter sich nicht sicher gewesen, dass es sich um Menschen handelte, so hätte er bei dieser schaurigen Prozession an ein Heer von Ratten gedacht.
Die Kolonne schritt schwankenden Schrittes durch das von unsichtbarer Hand aufgerissene Obertor und verschwand die Straße hinunter auf dem Husenfriedhof.
Hoch zu Ross war dem Zug der schwarze Tod auf dem Fuße dahin gefolgt. Um seine dürre Schulter flatterte ein schwarzer Mantel. Der bleiche Totenkopf mit dunklen Augenhöhlen leuchtete im fahlen Mondlicht, und die unheimliche Sense in seiner knochigen Hand ließ Schreckliches ahnen.
Gebückt schlich der Nachtwächter an der Friedhofsmauer entlang bis zu einer Fichte, die ihm leidlich Deckung bot. Vorsichtig spähte er über die Mauer. Aber nirgends konnte er den gespenstischen Zug und den schwarzen Tod entdecken.
Alle waren sie verschwunden und sie blieben auch verschwunden.
Jetzt erst spürte der Nachtwächter, wie sehr ihm der Schreck in die Glieder gefahren war.
Seine Knie zitterten.
Mit dem Verschwinden des gespenstischen Zuges, den der Erdboden auf dem Husenfriedhof verschluckt zu haben schien, war auch der schwarze Tod verschwunden.
Das Sterben in der Stadt Salzungen hörte auf.
Raubgesindel
Ungarn fielen einst in Sachsen und Thüringen ein und zogen raubend und plündernd durch das Land. Dieses Raubgesindel erreichte an einem Nachmittag auch die Werra in unmittelbarer Nähe Salzungens.
Die leichte Reiterei und die ungarischen Bogenschützen überschritten den Fluss und machten vor den Toren der Stadt halt. Die Bogenschützen formierten sich zu einer Kette und die Reiterei ging in Angriffsformation über.
Und dann ging es los.
Der erste Pfeilhagel lag zu kurz, aber der zweite erreichte die Stadt. Wie ein Schwarm, bösartiger Riesenhornissen schwirrten die Geschosse heran, die Schrei der getroffen hallten an den Fassaden der Häuser wieder.
Auf das Zeichen des Anführers setzte sich die Reiterei in Bewegung, erst langsam, dann immer schneller. Dem Druck der ungarischen Reiter konnte die Stadt nichts Gleichwertiges entgegensetzen.
Durch die Straßen und Gassen galoppierend wurde Jagd auf die Menschen gemacht, der Ort verwüstet und das Salzwerk zerstört.
Als die Ungarn die Wallburg, hoch auf dem Felsen über dem See einnehmen wollten, stieß die Räuberbande auf unerwarteten Widerstand.
Die Burgbesatzung hatte mitbekommen, was da aus der Niederung auf die Stadt zu kroch. Die Männer hatten den Atem angehalten und überlegt, was geschehen sollte.
In aller Eile bereitete man sich auf die Verteidigung der Anlage vor. Das Tor verbarrikadierend und mit der Waffe in der Hand wurde der Angreifer erwartet. Es wusste jedoch keiner von den Männern, die auf den Wehrgängen zum Kampf bereitstand, wie das Unheil, das da so mächtig heranzog, noch abgewendet werden konnte.
Das Pferd des Anführers, als wisse es besser als sein Herr, was zu tun sei, stieg steil, wie zum Kampf empor. Allein der Reiter zügelte es, bis es schließlich, unwillig und vor Aufregung mit den Vorderhufen scharrend still stand.