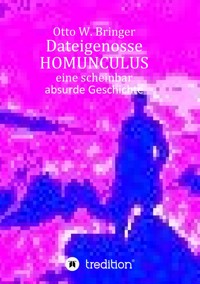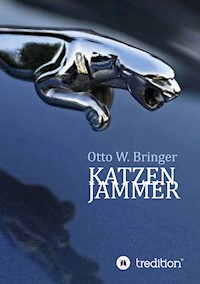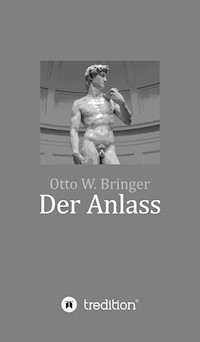3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wer wie der Autor wissen will, wer sein Vater war, hat in der Regel Dokumente. Familien-Stammbuch, Zeugnisse, Briefe, Urkunden, vielleicht noch Unterlagen über seine berufliche Tätigkeit. Der Autor wusste praktisch nichts über seinen Vater, was er gedacht, gefühlt, geliebt. Wie sein beruflicher Alltag aussah. Nur ein altes Foto, zufällig entdeckt beim Aufräumen. Sich nur erinnert, was er gesehen, gefühlt als Kind. Schüler, Flakhelfer und Soldat Ende des Zweiten Weltkrieges. Gewusst nur, dass sein Vater 1915/16 als Soldat in Riga war. Fragt sich: War er beteiligt an der Zerstörung der Stadt? An der Verhaftung von Juden?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Otto W. Bringer
Wer bist Du, Papa?
oder
Der lange Weg zu mir
Copyright: © 2020 Otto W. Bringer
Satz: Erik Kinting – www.buchlektorat.net
Umschlag u. Fotobearbeitung: Otto W. Bringer
Verlag und Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
978-3-7482-5077-7 (Paperback)
978-3-7482-5078-4 (Hardcover)
978-3-7482-5079-1 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Es musste fast ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod vergehen, bis ich mir über meinen Vater Gedanken machte. Zufällig fiel mir ein altes Foto in die Hände. Und schon erinnerte ich mich an dies und das, einen Vorfall, ein Wort. Zu wenig aber, um Gefühle zu wecken. Fragte mich, wer war eigentlich der Mann, der mich zeugte? Groß gewachsen, ein Goliath. So habe ich ihn erlebt und erlitten. Erduldet, bis ich Soldat werden musste. Zurück aus Gefangenschaft mich geweigert. Nicht mehr gehorchen auf Befehl. Endgültig satt, rumkommandiert zu werden. Demokratie sollte kommen, in der jeder das Recht auf Mitsprache hat. Picasso, Miro winkten mir zu: komm. Verließ das Elternhaus, die Welt zu entdecken. Das Leben, die Liebe und mich selbst. Papa und das Elternhaus ad acta gelegt. Es kommt mir vor, als hätte er ohnehin nur die Rolle des «Deus ex machina» gespielt. Ob er sich als Vater fühlte, ohne dass ich etwas davon merkte? Hatte ich falsche Vorstellungen? Oder war er so anders als andere Väter, die ich kannte? Wusste, er war 1915 Soldat in Riga. Entschließe mich, dieses Buch zu schreiben, herausfinden, was ihn beeinflusste. Der Vater zu sein oder zu werden, den ich erlebte. Möchte wissen, ob ich ihn verstehen könnte im Nachhinein. Und lieben.
Inhalt
Was war da noch mal?
Bahnfahrt rückwärts
MIHCK
Kopfbahnhof Riga
Was ist wahr und was gelogen?
Was war da noch mal?
Mein Vater lebt nicht mehr. Einundvierzig Jahre tot. Knochen nur noch und kein Gehirn, das ich befragen könnte. Sein Gipskopf bei mir auf der Fensterbank. Zu erinnern. Nach Antworten suchen unter den buschigen Brauen. In seinen aufgerissenen Nasenlöchern, den riesengroßen Ohren, die er Horchlappen nannte. Karl riefen ihn seine Schwestern. Dass er auch noch Otto hieß, erfuhr ich erst bei seiner Beerdigung. Als der Pfarrer versuchte, sich ihm zu annähern.
In frühester Kindheit war er für mich eine Riese. Groß und verschlossen, ein viereckiger Schrank. Arme eiserne Beschläge, die um sich schlugen, aber mich nie hineinblicken ließen. Zuoberst glänzte seine Glatze wie eine Kugellampe. Als man auf dem Sterbebett seine Körperlänge für den Sarg ermittelte, maß er 1,92 m. Fünf Zentimeter geschrumpft in den letzten Jahren. Er soll 1,97 m gewesen sein. Erinnere, als zehnjähriger Knirps sah ich seine Glatze schweben. Hoch über allem Irdischen. Entfernt wie der Vollmond am nächtlichen Himmel. Glänzend wie dieser Erdtrabant sein kahler Kopf. Sah ihn leuchten inmitten der acht Glühbirnen des Kronleuchters im Wohnzimmer.
Papas Glatze vergessen, verdrängt im Laufe der Jahre. Vier Jahrzehnte nach seinem Tod taucht er wieder auf. Nicht als Mond, sondern wie ein Komet, kommt und verschwindet wieder. Mich zu erinnern? Zu strafen im Nachhinein? Zu demonstrieren: Ich bin der Herr im Haus. War er ’s oder war er ’s nicht? Und warum? Fragen über Fragen. Versuche, Antworten zu erhalten, Klarheit zu gewinnen, wer er wirklich war. Nicht nur der Zweimetermann mit einer Glatze. Und Fäusten wie ein Goliath. Erinnere an Kindheit und Pubertät. Die schlimme Zeit unter den Nazis. Krieg und Nachkriegszeit. Alles fliegt mir jetzt zu. Eins ergibt sich aus dem anderen wie eine Ketten-Reaktion. An deren Knackpunkten ich in irgendeiner Weise beteiligt war.
Spontan fällt mir ein, schon früh musste ich den Kahlkopf meines Papas rasieren. Pünktlich am ersten Samstag nach meinem 14. Geburtstag. Papas Gesicht todernst, als er es mir befahl. Es sei Familien-Tradition bei Bringer, dass der älteste Sohn den Kopf seines Vaters rasierte, sobald er das vierzehnte Lebensjahr vollendet. Ich meinen Vater. Der seinen Vater, meinen Großvater. Großvater den seines Vaters, meines Urgroßvaters. Generationen von Männern, die hoch erhobenen Hauptes ihre Glatze trugen, als wäre sie eine Krone.
Mag sein, sie wären gerne König oder Kaiser gewesen. Um die Jahrhundertwende hatten Männer Vornamen von Herrschern: Wilhelm, Friedrich, Otto. Alle Deutsche Kaiser. Großvater hieß Peter. Möglich, dass seine Vorfahren am Zarenhof Postbriefe verteilten. Denn mein Großvater machte dasselbe. Als hätte er Verteilen in den Genen. Legte täglich die eingegangene Post in Fächer der Filiale Düsseldorf-Bilk. Pingelig genau nach Straßen geordnet.
Mein Vater stolz auf Karl den Großen, erster Deutscher Kaiser. Kannte dessen silbervergoldete Büste im nahen Aachen. Ein Reliquiar, in dem sein Schädel aufbewahrt wird. Vor jeder Krönung trug ein Bischof die Büste in einer feierlichen Prozession jedem entgegen, der Kaiser werden sollte. Vorbild und Mahnung zugleich. Schulterlang das gelockte Haupthaar. Bart und Schnurbart umschließen die vollen Lippen. Heute wieder Mode, Merkmal reifer Männlichkeit.
Mein glatzköpfiger Papa identifizierte sich trotzdem mit ihm. Feierte seinen Namenstag auf dessen Namenstag, am 28. Januar. Gegen Ende seines Lebens ließ er seine Haare wachsen. Kämmte sie mehrmals am Tag. Schwester Klara erzählte, er habe versucht sie zu zählen, den Handspiegel über sich haltend. Immer wieder Birkin von Dralle darauf geschüttet und gewünscht, sie würden mehr und voller. So wie man sie auf Kaiser Karls Büste sieht.
Guste, seine zweite Frau und unsere Stiefmutter, treue Katholikin. Sie zeigte sich am 28. Januar wenig erfreut. Kaiser Karl, den Sachsenmörder feiern – nein. Kochte zwar Papas liebste Suppe: Linsen mit Speck und Metwürsten. Das Geschenk aber versteckte sie bis zum 4. November, dem Namensfest des Heiligen Karl Borromäus. Im katholischen Heiligenkalender Schutzpatron der Bücher und Bildungseinrichtungen.
Mein Papa, nicht auf die Glatze gefallen, feierte ab da zweimal Namenstag. Zweimal Festessen, zweimal Geschenke. Zweimal er der Mittelpunkt. Ob ich auch so gefeiert würde, hätte ich eine Glatze? Otto gibt es auch zweimal: Kaiser und Bischof von Bamberg. Wart ’s ab, die ersten Haare fallen aus. Lassen Lücken zurück. Ob es mehr, dann eine Glatze werden, ist mit egal. Feiere im Gegensatz zu Katholiken seit Jahrzehnten meinen Geburtstag. Einmal geboren und nicht zweimal.
Die Köpfe aller Bringer-Männer waren kahl geschoren. Wie ich auf alten Fotos sah. Frage mich: war es allen ältesten Söhnen bewusst, einer Tradition zu folgen? Erledigten sie die Prozedur einmal in der Woche nur pflichtgemäß? Oder machte es ihnen Spaß, die rosafarbene Kopfhaut von grauen Haarstoppeln zu befreien? Auch Papa den seines Vaters zu rasieren? Quasi den natürlichen Zustand wiederherzustellen? Nie erzählte er uns von seiner Jugend. Es muss auch ihm Vergnügen bereitet haben, das Resultat seiner Arbeit vor Augen. Die obere Hälfte des Globus glatt und glänzend, wie soeben von Gott erschaffen. Ein so gewaltiges Werk musste gesetzlich geregelt sein.
Irgendein pedantischer Bringer es festgelegt haben in seinem Testament. Dieses Papier beim Notar hinterlegt. Die Kopie im Keller unter der Kartoffelkiste versteckt vor neugierigen Blicken. Niemand durfte erfahren, dass er unfähig war, seinen eigenen Schädel zu rasieren. Damit ’s in der Familie blieb, seinen Ältesten beauftragt. Als die Wohnung nach dem Tod der Eltern aufgelöst wurde, entdeckte ich im Keller diese Kiste. Ließ sie stehen, wo sie stand. Nichts wert, dachte ich. Bis ein Nachbar anrief und fragte, ob er die Kiste mit den Kartoffeln haben dürfe, sagte ich ja. Die Papiere darunter habe er verbrannt. Geerbt habe ich ohnehin nichts. Beide unverheiratete Schwestern erbten alles. Hab ’s ihnen gegönnt, weil sie die Eltern bis zu ihrem Tod gepflegt. Aber was auf dem Papier stand, hätte ich allzu gerne gewusst. Es hat sich in Rauch aufgelöst und bleibt ein Geheimnis wie vieles, was Bringer heißt.
Zurück zur Rasur. Vierzehn Jahre, Latein im Kopf und Ursel, schwarze Locken und Kussmund. Das Gegenteil von Papas Glatze. Sollte sie zum ersten Mal rasieren. Das, was ich mir glatt vorstellte, sah von Nahem betrachtet aus wie ein Stoppelfeld nach der Getreideernte. Im Laufe einer Woche waren die Haare zwei, drei Millimeter gewachsen, dicht an dicht. Die Rasur fällig.
Zuerst erklärte mir Papa vor dem Spiegel im Bad, wie ich es machen soll. Sah ihn Kinn und Wangen einpinseln, bis es schäumte. Mit dem Rasierer vorsichtig über die Haut schaben. Schaum und Härchen blieben am Gerät, die Haut streifenweise blitzsauber und glatt. Den Rasierer abgespült unterm Wasserstrahl. So oft geschabt und abgespült, bis Papa im Spiegel wieder das Gesicht zeigte, das ich kannte.
Papas Schädel musste ich in der Küche rasieren. Er setzte sich in seinen Armsessel am Kopfende des Esstisches. Thronte auf ihm wie bei jedem Essen. Seine Glatze jetzt unter mir, meinen Händen ausgeliefert. Fühlte mich einen Moment größer als ich war. Legte ihm das Handtuch um. Stopfte es zwischen Hals und Hemd, damit es nicht herunterfiel, während ich rasierte. Hätte mich bücken müssen und ihn mit dem Rasiermesser verletzen können. Papa schweigsam während der ganzen Prozedur. Nur zweimal einen Kurz-Kommentar abgegeben. Nahm ich den Rasierpinsel in die Hand: „Echt Dachshaar“. Das Rasiergerät: „Gilette aus Amerika.“ Die Schüssel mit Wasser, Crèmedose und weichwollenes Tuch für ihn nicht der Rede wert.
Zum Glück gab es schon diese Rasierer, die nicht mehr gefährlich waren. Die Klinge lugte schräg und nur zwei Millimeter aus dem Gehäuse. Leicht umzudrehen oder auszuwechseln, wenn sie nach einer Woche stumpf waren. Nicht zu glauben, dass dünne Härchen eine superscharfe Klinge so schnell verschleißen lassen. Früher waren es Klappmesser, wie Barbiere sie heute noch benutzen. Behaupten, nichts rasiere so glatt wie ein Klappmesser. Glatt wie ein Kinderpopo. Lustige Vorstellung: Männer kleine Kinder, ha, ha.
Dann wurde es ernst. Ehrgeiz packte mich, wollte der beste Glatzkopf-Rasierer werden. Seife mit dem Dachshaar-Pinsel kreisen lassen. Kurz in Wasser getunkt, weiter gepinselt, bis es schäumte, die Stoppeln aufrecht standen. Vorsichtig zog ich die Klinge, umgekehrt wie einen Rasenmäher, von hinten nach vorn. Von den Schläfen hoch zur Mitte und zurück. Und zum Schluss die Politur. Mit Wolltuch und einer Art Bohnerwachs. Wischte über die Glatze solange, bis sie glänzte wie der Linoleumboden in der Küche.
Wehe, ich berührte seine großen Ohren. Als wären sie der Eingang zum Paradies. In dem er mit seinem Ego allein war. Kinder und andere Teufel mussten draußen bleiben. Passierte es, schlug er wild um sich, riss das Tuch von der Schulter und trieb mich damit aus der Küche. Er muss sich wohl im Bad vor dem Spiegel betrachtet und für gut gefunden haben. Zum Mittagessen, wenig später, erschien er im frisch gebügelten Hemd mit blauer, weiß gepunkteter Fliege und großem Appetit.
Papa rasieren und polieren gehörte zu meinem Pflichtprogramm. Neben Spülen, Abtrocknen, Einräumen, Herdputzen, den Linoleumboden bohnern. Alles nach Schulschluss und Mittagessen. Täglich die Küche auf Hochglanz bringen. Einmal in der Woche Papas Glatze. Für Hausaufgaben blieb mir die Zeit bis zum Abendessen. Samstags bis zur Abendandacht um 18:00 Uhr.
***
Als hätte Andacht mich erinnert, Papas Mutter, meine Großmutter, ging nie in die Andacht. Ob sie die Stille nicht ertrug, weil man nichts hörte, außer Husten oder Nase schnäuzen? Nichts geschah, was sie interessierte? Langweilig, nur dazusitzen? Auch sie mit großen Ohren gesegnet oder geschlagen. Der Biologe Mendel hat nicht immer Recht. Von wegen überspringen. Papa hatte große Ohren, von dem ich sie geerbt in direkter Linie. Großmutter kannte ich nur mit hochgekämmten Haaren. Sodass ihre Ohren noch größer, die Ohrläppchen noch länger wurden. Das Loch in der Ohrmuschel wie ein Schalltrichter. Flöhe husten zu hören. Ein Hörrohr brauchte sie nicht. Nichts lenkte ab. Kein goldenes Ringlein, kein funkelnder Granat wie bei anderen Frauen.
Hoch gekämmt heute wieder modern. Plus Ohrclips oder winziges Taittoo auf den Ohrläppchen. Alles ist Mode. Schuhe, Kleider und Frisuren wechseln öfter als nötig wäre. Nur Tattoos bleiben. Damals trug meine jüngere Schwester Kleider und Blusen der älteren. Mode war sie umzuschneidern, bis sie passten. Tante Änne unsere Nähmaschinenfrau.
Als meine Füße größer geworden, die Schuhe zu klein, schnitt ich vorne in das Oberleder ein breites Loch. Zwei mal fünf Zehen freuten sich. Meine Zunge freute sich nicht. Zur Strafe das Taschengeld gestrichen. Vier Wochen keine Salmiakpastillen kaufen schlimmer als vier Wochen ohne Abendessen. Zehn Pfennig kostete ein Tütchen. Legten die schwarzen, rautenförmigen Lakritze auf dem Handrücken zur Rosette. Leckten und schmeckten das Herbsüße, wo wir auch waren. Auch während des Unterrichts, stand der Lehrer mit dem Gesicht zur Tafel. Oder beschäftigt mit Schülern in den Bänken hinter mir.
Großmutter hatte ebenso große Füße wie ihr Sohn. Große Menschen haben große Füße, sonst verlören sie die Balance. Schloss ich aus dem Physikunterricht. In der Wohnung schluffte sie in Pantoffeln, draußen in geräumigen Pelzstiefeln. Sommers wie winters, als wäre sie eine russische Babuschka.
Verwandte riefen sie Jettchen und nicht Henriette. Niedlich wie es sich anhört, war sie weiß Gott nicht. Fast stieß sie an den Türbalken. Uns kam sie vor wie Papa mit Busen. Liebte bunte Schürzen über einem knöchellangen schwarzen Kleid. In der rechten Schürzentasche griffbereit ein Portemonnaie. Besuchten wir sie, schickte sie uns, meinen Bruder und mich, zuerst ein Liter Bier zu holen. Aus der Eckkneipe schräg gegenüber. Das Mittagessen sei besser zu verdauen. Leichter die Hausarbeit am Nachmittag.
Interessant fand ich den aufklappbaren Deckel des Keramikkruges. Betrachtete ihn lange. Klappte ihn auf und wieder zu. Hören, ob ’s klingt oder klackt, wenn Metall auf Keramik fällt. Heute weiß ich, er war aus Zinn gegossen, ein halb plastisches Relief. Hoch aufgereckt auf seinen Hinterbeinen das Pferd. Im Sattel senkrecht ein Reiter mit Krone. Jan Wellem, der Kurfürst von Berg. Komisch, Bringer-Männer lieben Kaiser, Bringer-Frauen Kurfürsten. Ob es an den Geschichtsbüchern im Schulunterricht lag?
***
Und schon die Jan Wellem-Büste im Kopf, ausgestellt im Düsseldorfer Rathaus. Auf einer Säule wie die Büste des Perikles im Vatikanischen Museum. Der 65. Geburtstag meines Bruders Karl nahte. Die Idee im Kopf, ihm einen aus Tonerde geformten Papa-Kopf zu schenken. Es sollte ein Denkmal werden. Sah ihn im Geiste schon auf seinem Bücherschrank hoch oben. Wenn schon nicht in Bronze gegossen vor dem Römer in Frankfurt, wo er wohnte. Papas Kopf galt es nicht mehr wie früher zu rasieren, also äußerlich zu glätten. Wollte ihn mit meinen Händen zum Charakter formen.
Sein Äußeres erkennbar. Für jeden, der ihm schon mal begegnet, ein Bier mit ihm getrunken: Blanker Schädel, große Ohren, Ohrläppchen richtige Lappen. Die Lippen leicht geöffnet, als dürstete es ihn. Zwei Nasenlöcher wie der Gotthardtunnel. Das Dreifachkinn fließender Übergang vom Kopf zu Brust und Bauch.
Vielleicht, dachte ich, komme ich so dahinter, wer er wirklich war. Seelenverwandt vielleicht. Meine Fingerspitzen im weichen Ton den Herzschlag spüren. Beim Runden und Schleifen des gewaltigen Schädels Gedanken kommen, die er gedacht. Beim Formen der leicht geöffneten Lippen Worte hören, die sein Geheimnis lüften. Die Büste in Gips abgegossen und bronzen lackiert. Als wäre sie in der Eifel gefunden worden wie die von Nero, dem römischen Kaiser.
Und schon die Neuronen in meinem Gehirn aktiviert. Die Zellen geöffnet und mich daran erinnert, dass eine Büste des Römischen Kaisers Nero auf dem Bücherschrank meines Papas stand. Von seinem Vater geerbt, in Ehren gehalten und vom Staub befreit jeden Tag. Großvater erzählte mir, dass er Zeuge einer Ausgrabung in der Eifel war. Fragte den Archäologen, ob es stimmte, dass Nero Rom anzünden ließ. Nur um die Stadt danach schöner wiederaufzubauen. Der staunte über seine Geschichts-Kenntnisse und fragte ihn, ob er eine Kopie haben wolle. Großvater überrascht, dann begeistert. Nach Papas Tod erbte mein Bruder den Kaiser, inklusive Bücherschrank.
Damals interessierte mich Picassos Plastik «Mann mit Lamm» mehr als Hinterlassenschaften. Papas bronzierte Büste aus den Augen verloren. Und nichts gewonnen. Erinnert nur, was ich ohnehin wusste. Papas wässerig graue Augen. Als wartete Träne darauf, abwärts zu kullern. Statt Zähnen ein künstliches Gebiss. Sah beim Essen die Klammer im Mund. wenn er ihn aufriss, um eine ganze Kartoffel oder ein Hühnerbein hineinzustopfen. Aß dreimal so viel wie ich. Ob es ihm schmeckte, weiß ich nicht. Wir durften beim Essen nicht reden, nicht fragen. Folglich wusste ich nichts über den inneren Zustand meines Erzeugers. Außer dass er furzte aus Spaß. Abwesend den ganzen Tag im Telegrafenamt.
Meine bronzierte Büste ließ mein Bruder in seinem Kistenkeller verschwinden. Ob eins seiner Kinder sie eines Tages ausgräbt und auf seinen Bücherschrank stellt, steht in den Sternen. Ich aber hoffe, dass die Ganglien meines Gehirns aktiv bleiben. Erinnerungen wach rufen, die mich eines Tages erkennen lassen, wer Papa war. Sein wird, solange ich lebe. Und wissen. ob er mich liebte, mehr liebte als die Kopie einer Kaiserbüste.
***
Dreiundzwanzig Jahre im Elternhaus gelebt und nicht herausfinden können, wes Geistes Kind mein Vater war. Was er ersehnte, was verfluchte. Wissen wollte oder vergessen. Warum er jedes Wochenende zwei Kilometer am Rhein entlang spazierte. Einsamer Mann mit einem runden Filzhut auf dem Kopf. Wie ihn damals Pastore trugen. Begegnete ihm einer dieser Zunft, grüßte er Papa: Guten Morgen Confrater. Auf Beerdigungen trug Papa einen Gehrock plus Zylinder. Ich wagte nicht, ihn zu fragen, warum. Er hätte mich gescholten, die Hand erhoben zum Schlag. Gedroht: „Halt ’s Maul!“ Papa hatte eine eigene Art zu verdeutlichen, was er meinte. Selten ein, zwei Worte. Gelegentlich verklausulierte er seine Meinung.
An Fronleichnam stellte er unsere Gips-Madonna ins offene Fenster. Blauweiß auf lang herunter hängendem Pseudo-Orientläufer. Kerzen brannten, bunte Blumensträuße jubelten Halleluja. Alle sahen, hier wohnt ein Katholik.
Am 20. April, Hitlers Geburtstag an allen Fassaden lange Hakenkreuzfahnen, Führerbilder in den Fenstern. Papa protestierte auf seine Art. Im Gegensatz zu langen Fahnen quetschte er das Symbol der neuen Zeit briefbogenklein ins Lüftungsfensterchen. Mit Aquarellfarben schwarzweißrot gepinselt. Äußerung, die ich auch ohne Worte verstand. Aber erst lange nach dem Krieg. Dass er extravagante Mode liebte, erlebte ich jeden Abend.
Im offenen Fenster der ersten Etage gegenüber Frau Beetz. Hellblond onduliert. Blauen Schal locker um die Schulter gelegt, die Brüste in weißen Spitzenhaltern knapp über der Fensterkante. Neugierig verfolgte sie Spaziergänger oder Prozessionen. Ab und zu das Gesicht uns zugewendet: blass geschminkt, die Wangen gerötet. Hoch gezogen die Brauen. Lange Wimpern klappten auf und nieder. Lippenstifte in vielen Farben wechselten wie der Schal von Tag zu Tag. Zinnober, Karmin, blau, Lila, die ganze Palette.
Papa lauerte hinter der Gardine, bis sie sich wieder zeigte. Täglich um 18:00 Uhr schien sie jemanden zu erwarten. Starrte auf das Gegenüber, betrachtete sie wohlwollend, als wäre es ein Gemälde von Peter Paul Rubens. Dann wieder lästerte er: „«Das Gemälde» hängt wieder aus dem Fenster.“
Krieg und Nachkriegszeit haben alles verändert. Papa als leidenschaftlicher Pfeifenraucher in großer Not. In Rauchwarenläden gab es Tabak nur in kleinsten Mengen auf Raucherkarte. Das Risiko groß, ihn illegal auf dem Schwarzmarkt zu kaufen. Fürchtete er, von der Polizei erwischt zu werden? Ins Gefängnis zu kommen? Ein Beamter im Knast? Der gute Ruf dahin. Bisher alle Männer, die Bringer hießen, geradezu vorbildlich. Präsent durch ihre Glatze, aber zurückhaltend in der Öffentlichkeit. Regelmäßig im Gottesdienst. Kein Parteimildglied. Weiß ihre Weste, von innen betrachtet.
Was macht einer, der bisher nicht auffiel durch Einfallsreichtum? Jahrzehntelang gewohnt zu rauchen, Dampf zu inhalieren und wieder auszublasen. Diese zum Ritual gewordene Leidenschaft zu groß, um aufzuhören zu können, weil es keinen Tabak gibt. Papa schnitt von unserem Kirschbaum die erreichbaren Blätter ab. Fermentierte sie mit einem Mittel aus der Drogerie und legte sie zum Trocknen in den warmen Backofen bis zum nächsten Morgen. Schnitt sie in schmale Streifen und stopfte den braunen Krüllschnitt in die blecherne Tabakdose. Abends schmauchte er genüsslich seine Pfeife. Im Ohrensessel, den er für sich selber gekauft. Niemand sonst durfte ihn benutzen.
Wenn Gustes Brüder, meine Onkels uns besuchten, war alles anders. Mit Papa vier ausgewachsene Männer auf Stühlen mit hohen Rückenlehnen um den ovalen Tisch im Wohnzimmer. Bei solchen Anlässen der Rauchsalon. Frauen und Kinder nicht zugelassen. Wollte aber wissen, was Männer machen, wenn sie unter sich sind. Versteckte mich hinter dem Fenstervorhang. Beobachtete und wartete darauf, dass was passiert. Redeten, was ich nicht verstand. Bis Onkel Josef sein Zigarrenetui aus der Innentasche seines Jacketts holte. Es aufklappte, Papa und den anderen hinhielt: «Greif zu, eine echte Havanna, die Bauchbinde beweist es», sagte er. So großzügig kann nur ein Bürgermeister sein.
Onkel Josef war Bezirksbürgermeister in Düsseldorf - Benrath. Dachte damals, wäre ich Bürgermeister, böte ich keine Zigarren an, sondern Karamellbonbons. Sah, wie alle dem dicken Ende der Zigarre ein Stück abbissen, als hätten sie es in einem Kurs gelernt. Beleckten es mit ihrer Zunge und zündeten das spitze Ende an. Wie mag Zigarre schmecken? Mir wären Karamellbonbons lieber. Als die Männer in der Runde, von Rauchwolken umnebelt, nur noch Schemen ihrer selbst, ich Hüsteln nicht unterdrücken konnte, entdeckten sie mich. „Möchtest Du auch mal eine schmauchen?“ rief Onkel Alex.
Der Volksschullehrer war sehr beliebt bei seinen Schülern, weil er nicht vom Katheder dozierte. Sondern das Thema setzte und sie erst mal machen ließ, bevor er korrigierte. Im Rausgehen sah ich Papas Gesicht rot vor Zorn. Wird er mich verprügeln nach Strich und Faden, wenn ich Onkel Alex Angebot annehme? Erst mal werden sie sich streiten mit Worten. Aufstehen und sich schlagen vielleicht, fürchtete ich.
Verwandtschaft verpflichtet nicht unbedingt zu lieben. Das Beispiel Tante Hedy im Kopf. Hörte die Männer hinter der verschlossenen Tür reden, mal flüstern, Onkel Alex lauthals lachen. Dabei im Takt auf die Oberschenkel klopfen. Es müssen Witze gewesen sein, die Frauen und Kinder nicht hören durften. Beschloss, bei Karamellbonbons zu bleiben.
***
Als ich jetzt darüber nachdenke, was Papa gerne machte außer Pfeife rauchen, fällt mir ein: er malte kleine Bilder. Mit Vorliebe den Zollturm von Zons am Rhein, die Wassermühle bei Kalkum, nördlich von Düsseldorf. Ich sah das ein oder andere, wenn er die neusten dem Kaplan oder anderen Besuchern zeigte. Aquarelle, klein wie Postkarten. Ich habe ihn aber nie malen gesehen. Nie dabei gestanden und gelernt. Nie hat er mit uns über seine Liebhaberei gesprochen. An den Wänden der Vierzimmerwohnung hing keines seiner Aquarelle.
Malte er sie im Geheimen? Und traute sich nicht, sie einzurahmen und aufzuhängen? Die Frage blieb unbeantwortet bis heute. Dafür drängten sich Bilder seines Großonkels «Fritz Beinke» auf. Der, wie ich hörte, in Stadt und Land bis Sidney bekannt, viele Ausstellungen beschickte. Hierzulande Radierungen und Gemälde in Kunsthandlungen und Galerien erfolgreich verkaufte. Auf Versteigerungen sollen manche Motive Höchstpreise erzielt haben. Romantik ist immer gefragt. Außer zwei Landschaften, einem Bauern mit Pfeife hing ein ganz besonderes Gemälde dieses Verwandten bei uns im Wohnzimmer. Prominent zwischen Gläserschrank und einem Fenster ohne Gardine. Im Licht des frühen Nachmittags konnte man sogar feine Details gut erkennen. Die Farben wirkten natürlich, Betrachter fühlten sich in ihre Kindheit zurückversetzt. Nach Großmutters Tod erbte Papa das Bild.
Stelle mir vor, verwandt mit einem international bekannten Künstler wollte Papa selber einer dieser Gilde sein. Kaum die Mäntel abgelegt, lancierte er jeden Besucher zuerst ins Wohnzimmer. Bis vor das Beinke-Gemälde. Jüngere Schwägerinnen mit sichtlichem Vergnügen. Heute denke ich, sie ließen sich gerne drängen, von kräftigen Männerhänden geschubst, ihren Allerwertesten spürten und an Gott weiß was dachten. Nur nicht an Kunst. Kein Wunder, dass sie uns öfter besuchten als die Schwestern meines Vaters. Die interessierte mehr, welche Zeugnisnote ihre Neffen in Latein und Mathematik hatten. Um sie mit erhobenem Zeigefinger und überflüssigen Worten zu ermahnen.
Vor dem Gemälde reckte Papa sich, als müsste er noch größer werden als er war. Wies mit ausgestrecktem Zeigefinger auf dies und das. Ich hörte Worte, die ich erst später im Malunterricht kennenlernte: Umbra, Preußischblau oder Olivgrün. War es die Farbe Zinnoberrot, hielt er den Finger länger drauf. Machte eine Pause und dann mit erhobener Stimme:
„Das ist meine Mama als 6jähriges Kind. Mit anderen ihrer Klasse und dem Lehrer auf einem Schulausflug. Dieses wunderbare Gemälde hat mein Großonkel Fritz Beinke gemalt, FB 1867 hier unten rechts signiert. Die Kleine mit dem zinnoberroten Käppchen muss ich immer wieder anschauen, mir sagen: das ist meine Mama. Vergleiche ich sie mit der 68jährigen heute, wird mir klar, wie schnell die Zeit vergeht und mit ihr die Mode. Heute trägt Mama schwarze Kleider, damals als Kind ein hellblaues Kleidchen, über dem Arm einen weißen Schal. Rot aber musste ihr Käppchen sein. Wie Rotkäppchen das beliebteste Märchen bei Erstklässlern. Immer noch lebendig in unseren Köpfen, habe ich Recht?“
Weder davor noch danach hatte ich ihn so lange reden hören. Als wären Schleusen geöffnet. Mag sein, dass Stolz ihn munter machte. Der Großneffe eines so bekannten Künstlers zu sein. Tante Lore betrachtete das Bild noch, als die anderen schon am Kaffeetisch saßen und redeten. Über was, konnte ich nicht verstehen. Beobachtete die Tante, die sich nicht vom Fleck rührte. Nur den Kopf bewegte. Sie schien auf dem Gemälde immer neue Details zu entdecken. Ob sie an ihren Schulausflug dachte? Den strengen Lehrer, an die Farbe ihres Kleides, ihrer Mütze?
Ich hatte dieses Gemälde erst mit etwa zehn Jahren zur Kenntnis genommen. Aber im Gegensatz zu Papa und meinen Geschwistern nie richtig gemocht. Halte es auch heute noch für eines der im 19. Jahrhundert gefragten Motive. Naturalistisch gemalt Kinder, Bauern und Mädchen in ländlicher Idylle. Eindrucksvoll allerdings der mächtige, barocke, gipsvergoldete Rahmen. In bürgerlichen Kreisen damals beliebt. Wenn ich das Bild geerbt und nicht mein Bruder, hätte ich den Original Beinke gegen einen Picasso-Druck ausgewechselt. Oder einen meiner ersten abstrakten Linolschnitte. Erst am Gegensatz erkennt man den Meister.
In der elterlichen Wohnung war dieses Gemälde für Papa willkommener Anlass, mit einem berühmten Künstler in der Verwandtschaft größer zu sein als er in Zentimetern maß. Und beliebt. Strahlte förmlich, zeigte er das Bild einem neuen Kollegen. Guido aus Mailand, dem eingeheiratetem Neffen. Dem neuen Pfarrer. Frauen himmelten ihn an. War er doch ein stattlicher Mann und verwandt mit einem weltbekannten Künstler. Männer verlangten einen «Münsteraner Korn». Wussten sie, seine Schwägerin Maria besaß eine Schnapsfabrik im Münsterland. Das laute Gerede anschließend täuschte vor, was nicht war. Ob Papa sich als Künstler fühlte – keine Ahnung.
Ich erbte ein Selbstbildnis Fritz Beinkes, eine Radierung. Sie lässt nicht genau erkennen, wie er aussah. Auf mattem Papier gedrucktes bartloses Gesicht, rastlos um sich selbst kreisende Selbstfindungsversuche. Mir gefiel es sehr. Papa trennte sich leicht von dem, was er nicht erklären konnte. Jetzt hängt es neben dem Klavier über meiner ersten Architektur-Zeichnung. Gäste fragen: „Wer oder was ist das?“ „Ein Selbstbildnis meines Urgroßonkels Fritz Beinke, berühmter Maler im 19ten Jahrhundert.“
Schleppte sie anschließend vor das Portrait meiner Urgroßmutter, vis à vis der Haustür. Auch von Beinke gemalt. Stolz, eine Ahnin im Haus zu haben. Wie mein Papa, fällt mir jetzt ein. «Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm» scheint zu stimmen. Bis ich erfuhr, sie ist nicht Papas Oma, sondern die Schwester des Malers. Also Papas Großtante. Meine Urgroßtante. Im Laufe der Zeit freundete ich mich mit dem Gedanken an, verwandt bin ich ja mit ihr. Wenn auch über drei Ecken. Außerdem mit Ölfarben gut gemalt, die Proportionen stimmen. Auf seine Art ein Meisterstück. Mit Firnis überzogen, die Farben nach fast einem Jahrhundert unverändert, dunkel zumeist. Nur Gesicht und Hand meiner Urgroßtante hellrosa. Das schmale Weiß des Kragens ihrer Bluse darüber. Der Rest ist dunkel, undefinierbar. Kein Lichtblick, den ich von einem Gemälde erwarte. Sie wirkt ernst. Sehr ernst. Wie die Gesichter aller Verwandten meines Vaters auf Fotografien. Mit der linken Hand hält sie ein Tuch, das sie als Hausfrau definiert. Der Kragen ihrer dunkelgrauen Bluse mit einer Brosche geschlossen. Von vergoldeten Blättern eingerahmt ein emailliertes Irgendwas.
Aber ihre blauen Augen leuchten, verfolgen mich, wo ich auch bin, wohin ich auch gehe. Selbst hinter der geschlossenen Tür spüre ich ihren Blick im Nacken. Als verfolgte Papa jeden meiner Schritte. Rätselhafte Tante, von der ich lange glaubte, sie ist meine Urgroßmama. Nicht aufgeklärt über Sachen und Personen, die für mich wichtig waren. Nebulös alles in meinem Elternhaus, was klar sein müsste, um es zu begreifen.
Als ich verheiratet war, wollte ich alles anders machen als meine Eltern. In unserem Haus spürten Besucher Liebe und Empathie. Zeigten, wer wir sind und was wir lieben. Offen und ehrlich Meinungen geäußert. Transparent die Fenster, durchgängige Innenräume. Animierend das Essen auf Tischen, die Bilder an den Wänden. Alles hell und es duftete. Nur die Art zu lieben, blieb unser Geheimnis.
Kamen die Eltern uns besuchen, war es, als stäube Vergangenheit herab wie Nieselregen. Stieg auf wie Novembernebel aus allen Ritzen, Löchern, den Fugen des Marmorbodens. Legte sich auf die Gemüter. Traumata aus Kindertagen wurden wach. Und alle unbeantworteten Fragen. „Wie geht ’s, wie steht ’s? Es hat uns geschmeckt“ sagte Guste, höflichkeitshalber. Papa schwieg, sah gedankenverloren aus dem großen Fenster ins Grüne. Als dächte er an früher.
***
Versuche zu erinnern. Seine erste Frau, meine Mutter, hieß Elli. Eine lebenslustige Frau, die gut Geige spielte, erzählte mir Tante Ali, ihre Schwester. Sie starb, als ich Sechs war. Großmutter managte den Haushalt ein Jahr. Dann kam eine neue Frau. Streng sah sie aus. Den Mund leicht verkniffen. Wir sollten Mutti zu ihr sagen. Dass sie Guste hieß, erfuhren wir viel später. Vater schwieg und sagte nichts mehr. Als hätte er die Sprache verloren.
Nur seine rechte Hand spürte ich, wenn er mich, vom Dienst nachhause gekommen, im Auftrag seiner zweiten Frau ohrfeigte. Weil ich beim Mittagessen mit dem Finger in der Nase gebohrt hatte. Es passierte öfter, besonders in Heuschnupfenzeiten. Einmal versteckte ich mich im Kleiderschrank, als er nachhause kam. Hörte sie reden, Türen schlagen, bis er die Schranktür aufriss und mir drei saftige Ohrfeigen verpasste.
Fragte mich, wenn es schon unanständig ist, beim Essen in der Nase zu bohren, warum schlägt Mutti mich nicht? Sofort, als sie mich erwischte? Heute denke ich, sie wollte sich unter keinen Umständen nachsagen lassen, sie sei eine böse Stiefmutter.
Später, viele Jahre später verdiente ich während der Semesterferien Geld als Schaffner in einem Bus. Auf der Strecke von Düsseldorf nach Velbert und zurück.
Lernte Marga kennen. Verliebt bis über beide Ohren drängte es mich zu tun, was junge Männer tun, um zu erfahren, wie sich Sex anfühlt. Probierte im elterlichen Bad ein Kondom aus, warf es in die Toilette. Drückte ab. Es verschwand nicht im Wasserstrahl. Drückte ein zweites, drittes Mal. Die Tür aufgerissen, das Gummi im Toilettentrichter sehen und mich drei-, viermal geohrfeigt. Geboxt und geschrien: „Was machst du da? Lass das bloß sein, sonst will ich Dich hier nicht mehr sehen.“ Drehte sich um und verschwand im Wohnzimmer. Auf dem Grammophon begann sich jaulend die «Rheinische» von Robert Schumann zu drehen.
Ich ging in meine Dachkammer, legte mich aufs Bett und dachte: der hat ja keine Ahnung. Oder vielleicht doch. Nur viel zu lange schon her. Ob er überhaupt schon mal richtig glücklich war. Schwor mir, meine Kinder aufzuklären.