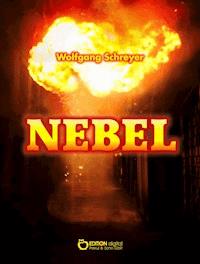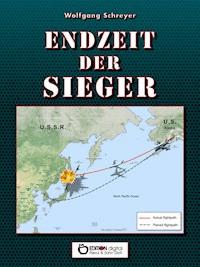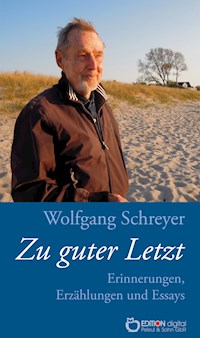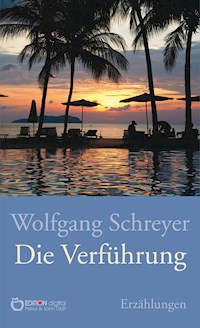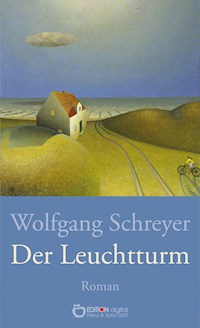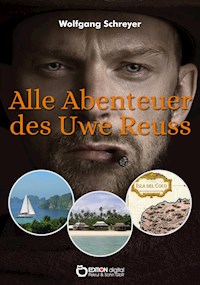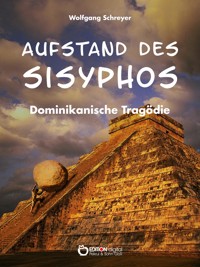
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
„Gefoltert von Qualen, wälzt Sisyphos einen gewaltigen Stein bergan. Keuchend stemmt er sich gegen die Last und schiebt sie auf den Gipfel. Doch glaubt er die Bergspitze erreicht zu haben, rollt der Felsblock zur Ebene hinunter..." Der griechische Mythos von Sisyphos erhellt die Situation in Lateinamerika. Nacht und Tag, Tag und Nacht wälzen die weißen, braunen, roten und schwarzen Arbeiter Amerikas den Felsblock ihrer unterdrückten Schöpferkräfte gegen das Schicksal der nicht selbstverschuldeten Unterentwicklung. Zweihundertdreißig Millionen Lateinamerikaner - das sind sieben Prozent der Menschheit! Und die Mehrzahl von ihnen lebt menschenunwürdig: Hunger, Krankheiten, Unbildung... Woher rührt dieses Elend inmitten einer verschwenderischen Natur? Eine zählebige, brutal herrschende Drillingsmacht ruiniert die lateinamerikanischen Völker: Feudaloligarchie, kreolisches Großbürgertum und Dollar-Imperialismus. Gibt es einen Weg, auf dem Sisyphos endlich und für immer den Gipfel erreicht? Die bitteren Erfahrungen des lateinischen Amerika im 20. Jahrhundert: Die Versuche in Bolivien, Guatemala, Santo Domingo, das Scheitern Jacobo Arbenz', Juan Boschs, Ernesto Guevaras - könnten sie nicht Zweifel wecken an den Möglichkeiten, das Schicksal zu wenden? In moderner essayistischer Form behandelt Wolfgang Schreyer ein immer noch brennend aktuelles Thema: Revolution vor der Haustür der USA. Aufstand des Sisyphos! Das Buch erschien erstmals 1970 beim Deutschen Militärverlag in Berlin. Es bildet mit den hervorragend recherchierten Informationen eine sehr gute Ergänzung zu Schreyers Trilogie "Dominikanische Tragödie" (Der Adjutant, Der Resident, Der Reporter). INHALT: Der Entdecker Mutter der Erde Die weißen Götter Tortuga – Ära der Piraten Windjammer-Strategie Das schwarze Elfenbein Revolution auf Haiti Die schwarze Republik Die Sonne sinkt Bittere Früchte República Dominicana Junger Staat zu verkaufen Das Tor nach Süden Machtstrategie anno 1870 Jobber und Putschisten Die Flagge folgt dem Dollar Wir schafften Frieden Der dicke Knüppel Die Invasion Unterm Sternenbanner Die Kindheit eines Chefs Tragödie im Dschungel Staatsstreich auf dominikanisch Fünf Säulen der Macht Groteske Fassade Das Wirtschaftswunder Lohn der Angst Der seltsame Widerstand Der tragische Widerstand Trick 46 – links überholen Trick 59 – Kolportage Trick 61 – Salto mortale Das Erbe einer Ära Flüchtlingsschicksal Das Schaufenster Die dritte Kraft Schatten einer Hoffnung Christus an die Front
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Schreyer
Aufstand des Sisyphos
Dominikanische Tragödie
ISBN 978-3-86394-098-0 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1970 beim Deutschen Militärverlag, Berlin
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2012 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Der Entdecker
Es begann vor einem halben Jahrtausend auf der portugiesischen Insel Porto Santo am Rand des Atlantiks in der Nähe von Madeira mit einer Erbschaft und einer Ehe. Ein dreißigjähriger Seemann aus Genua, Cristoforo Colombo – später nannte er sich Cristóbal Colón oder auch Kolumbus –, hatte 1481 die Tochter eines adligen italienischen Kapitäns geheiratet; der Kapitän war im selben Jahr gestorben, Colón in dessen Haus gezogen. Unter der Hinterlassenschaft fand er eine schwere eisenbeschlagene Truhe mit Landkarten, Notizen, Plänen und wunderbaren Berichten über Schätze und Länder; Berichte, wie zahlreiche Reisende jener Epoche sie sammelten, ängstlich hüteten und als wertvollen Besitz weitergaben an ihre Kinder. Das Zeitalter der Entdeckungen war eben angebrochen.
Kolumbus studierte die Karten, Notizen, Pläne und wunderbaren Berichte, er verschaffte sich die Schriften berühmter Geographen, befragte Piloten, die die Meere jenseits Madeiras und der Azoren befahren hatten und behaupteten, das große, reiche Indien und das große, reiche China – damals Kathai geheißen – seien auf Westfahrt schnell zu erreichen, obwohl keiner von ihnen je dort gewesen war oder auch nur versucht hatte, dorthin zu kommen. Der westliche Seeweg nach Indien und Kathai wurde für Kolumbus zum Fetisch. 11 Jahre jagte er ihm nach, versuchte Geld für eine Expedition zu beschaffen, verhandelte mit Königen, Schranzen, Kaufleuten, stritt mit Gelehrtenkommissionen, feilschte um Titel, um künftige Profite. Mit 120 Mann und drei Schiffen brach er endlich im August 1492, im Auftrag der spanischen Krone, vom Hafen Palos (unweit der Hafenstadt Cadiz) westwärts auf. Seinem Flaggschiff "Santa Maria" folgten die Karavelle "Pinta" und das nur 17 Meter lange Hilfsschiff "Niña". Dass Königin Isabella ihre Juwelen versetzt habe, um die Expedition auszurüsten, ist eine romantische Legende. Die Kosten, etwa 7 500 Dollar nach heutigem Geld, trug hauptsächlich die Kaufmannschaft von Palos.
Am 69. Tag der Reise meldete der Mann im Ausguck Land in Sicht – die Bahamas. Das Geschwader segelte an der schroffen Nordküste Cubas vorbei nach Haiti. Im Nordwesten der Insel gingen Kolumbus und seine Crew am 6. Dezember von Bord und wurden von kupferbraunen Menschen freundlich empfangen. Da Kolumbus sich in Indien wähnte, nannte er sie Indianer.
Der Ankerplatz gefiel ihm, nicht nur des Goldes wegen, mit dem die Indianer geschmückt waren – Kolumbus und die Matrosen handelten es ihnen preiswert ab –, sondern auch, weil die Landschaft an Spanien erinnerte: die Vegetation, die Bergketten im Süden (dort schürften die Indios angeblich das Gold), die Hitze flimmernde Luft, alles war wie in Spanien, und Kolumbus trug die Insel unter dem Namen "Hispaniola" in seine Seekarte ein. Der ständige Nordostpassat allerdings war lästig; er ließ die Schiffe schlingern, verbreitete Seekrankheit, und auf der Weiterfahrt vom heutigen Cap Haitien nach Osten warf die Passatbrandung das Flaggschiff "Santa Maria" auf eine Sandbank, wo es barst. Von der "Pinta" hatte Kolumbus sich für einige Wochen getrennt, die "Niña" konnte nicht alle Schiffbrüchigen aufnehmen. Am Ufer errichteten die Spanier aus den Trümmern des Wracks ein Fort, La Natividad: Weihnachten; 39 Mann blieben darin zurück – die erste koloniale Besatzungstruppe in der Geschichte Amerikas.
Im folgenden Herbst kam Kolumbus, nun auf dem Gipfel seines Ruhms, wieder nach Übersee – mit 14 Karavellen. Sie trugen 1 200 Bewaffnete, auch Reiter, ferner Beamte des Königs, 11 Geistliche und einen apostolischen Vikar aus Rom. 3 Lastschiffe bargen europäische Haustiere, Saatgut und Weinreben, die nach "Indien" verpflanzt werden sollten. Dies war nicht mehr ein bloßes Erkundungsgeschwader, sondern eine Flotte von Kolonisatoren. Am 27. November 1493 erreichte sie La Natividad; man fand das Fort in Trümmern. Die Besatzung hatte sich nicht mit Tauschhandel begnügt, aus Schiffbrüchigen waren Eroberer geworden. Durch die Gewalttaten und Plünderungszüge gereizt, hatte der Stamm des Kaziken Caonabo die Spanier erschlagen. Kolumbus legte 60 Kilometer ostwärts ein neues Fort an, Isabella, und ließ den Plan einer Stadt entwerfen. Ein Suchkommando fand 7 Tage weit im Inneren der Insel Gold in den Bächen. Der Admiral sandte das Gros seiner Flotte heim, beladen mit Beute und zahlreichen Kranken; das Klima im Küstenstreifen war mörderisch. Er selbst brach in das Goldland auf, besetzte die Minen von Cibao und sicherte sie durch das Fort St. Thomas. Hier ließ er 56 Mann zurück und befahl ihnen, sich friedlich zu verhalten.
Überzeugt, das Goldland Ophir des biblischen Salomo entdeckt zu haben, der zweieinhalb Jahrtausend zuvor mit Märchenschätzen von einer See-Expedition zurückgekehrt war, schickte Kolumbus sich nun an, den Weg nach Kathai zu vollenden. Am 4. Mai 1494 landete er auf Jamaica. Hier widersetzten sich die Indios; sie wurden durch einige Schüsse und durch Bluthunde eingeschüchtert. Aber Gold war nicht zu finden. Darauf drang der Admiral in das Gewirr von Riffen und Inselchen ein, die Cubas Südküste säumen. Er nannte es "Garten der Königin" und hielt es für jene Inselgruppe, die nach Marco Polo östlich von China liegen sollte. In Cuba glaubte er Japan vor sich zu sehen.
Wieder steuerte er "Hispaniola" an, wie die Insel auf nordamerikanischen Karten noch heute heißt. Im Hafen Isabella schien sich inzwischen der Fall La Natividad zu wiederholen. Durch Habgier und Brutalität hatte sich die Besatzung den Hass der Einwohner zugezogen. Caonabo belagerte die Festung St. Thomas mit 10 000 Indiokriegern, während die spanische Führung in intrigierende Gruppen zerfiel. Eine Aristokratenclique hatte sich eigenmächtig eingeschifft und war in Madrid schon dabei, Kolumbus' Ansehen zu untergraben. Nachdem der Admiral den Aufstand der Indios blutig niedergeschlagen hatte, musste er zu seiner eigenen Verteidigung heimkehren. Im Juni 1496 lief er aus, mit 225 Spaniern – meist unnützen, auf Staatskosten unterhaltenen Kolonisten – und 30 gefangenen Indios an Bord.
Er ließ ein unterjochtes Volk zurück. Mit Pulver und Blei, Harnisch und Schwert, Pferd und Reiter, in denen die Indios ein einziges furchterregendes, göttliches Wesen erblickten, hatte Spanien auf Haiti endgültig Fuß gefasst. Seine Gepanzerten hatten den Kaziken Caonabo festgesetzt und den Stämmen einen schweren Tribut in Goldstaub auferlegt.
Mutter der Erde
Über den Aufstieg und Fall des Entdeckers, seine späteren Reisen, Triumphe und Niederlagen gibt es viele Berichte. Weniger ist über das Schicksal derjenigen bekannt, die er aufspürte und versklaven ließ. Als Kolumbus Haiti betrat, lebten rund 1 Million Menschen auf der Insel; das siebenmal größere Spanien war mit 9 Millionen kaum dichter besiedelt.
Die Indios nannten ihr Land Haiti, Land der Berge, oder Quisqueya – Mutter der Erde. Die meisten lebten an den fisch- und wildreichen Binnenseen des Südens, in sechs- oder achteckigen Palmblatthütten, schliefen in kunstvoll geflochtenen Hängematten (die ihre Erfindung sind), fischten von Einbäumen mit Harpunen und gefiederten Pfeilen, erlegten Wild mit dem Blasrohr und der geschliffenen Steinaxt, behandelten Krankheiten mit Chinarinde oder Brechwurzel. Den Urwald rodeten sie, indem sie die Bäume anhackten, verdorren ließen und dann abbrannten; die Asche diente als Dünger. Die Frauen lockerten den Boden mit knorrigen Stöcken, die Zeit der Aussaat wurde nach dem Stand der Sterne bestimmt. Jagd- und Fischgründe waren Gemeinschaftsbesitz, die Beute wurde an alle Stammesmitglieder verteilt. Sie tanzten zum Klang der Panflöte, fertigten Schmuck aus Bohnen, bunten Federn und Tierzähnen und bemalten sich mit Farben aus Pflanzensaft.
Trotzdem ging es auch vor der Ankunft der Weißen dort nicht friedlich zu. Die Chronisten der spanischen Eroberung erwähnen zwei einander feindliche Bevölkerungsgruppen: die Caribes auf den Kleinen und die Guatiaos auf den Großen Antillen. Die ersten waren – nach spanischer Darstellung – menschenfressende, vom Orinoko-Delta her vordringende Gruppen primitiver Sammler und Jäger; die zweiten dagegen sesshafte Stämme einer höheren Kulturstufe, die Mais, Maniok, Bataten, Bohnen, Tabak und Baumwolle anbauten – und Gold gewannen. Der Unterschied hatte strategische Bedeutung: Die Caribes galten als unzähmbar, ihre Inseln mieden die Spanier. Die Guatiaos aber konnte man sich unterwerfen und zur Arbeit zwingen.
Zur Zeit der Entdeckung gab es auf Haiti fünf oder sechs große Stammesverbände – staatsähnliche Zusammenschlüsse – der Aruaken. In mehreren Wellen waren sie von Südamerika her über den Antillenbogen eingewandert. Sie hatten die Ciboneyes, eine aus dem Norden stammende Urbevölkerung, in die gebirgige Südwest-Landzunge der Insel abgedrängt. Der ersten Welle war eine zweite gefolgt, die höher entwickelten Tainos. Als Kolumbus eintraf, griffen diese gerade nach Ostcuba über. Auf Haiti hatten sie ihre Vorgänger überlagert und bildeten eine privilegierte Oberschicht, aus der die Kaziken hervorgingen.
Diese schon recht mächtigen Herrscher genossen als Priester auch religiöse Verehrung. Kleinere Häuptlinge, die Chefs der einzelnen Stämme, waren ihnen tributpflichtig. Gestützt auf die übrigen Tainos, lagen Gerichtsbarkeit und Regierungsgewalt fest in ihrer Hand. Das Kazikenamt war erblich, eine Feudalstruktur entstand. Ihr Staatswesen schien wohlgeordnet. Auf Beutezügen fanden die Spanier, besonders in den windabgewandten Trockenwäldern des Südens, Großdörfer mit 3 000 Einwohnern. Die Aruaken ruderten in ihren Einbäumen – es passten 70 Mann hinein – nach Cuba und Jamaica, ja sogar bis Mexico. Räumlich wie kulturell standen sie etwa in der Mitte zwischen den Hochkulturen der Maya und Azteken – und den nachdrängenden Kriegerstämmen der Caribes, die eine Insel nach der anderen eroberten.
Die Kariben rückten unaufhaltsam vor. Von Trinidad bis zu den Jungfern-Inseln vertrieben sie die Aruaken. Womöglich erschlugen sie die Männer und nahmen sich die Frauen – das würde jene aruakische Weibersprache erklären, die bis ins 18. Jahrhundert hinein auf den Kleinen Antillen gesprochen wurde; Mütter gaben sie offenbar an ihre Töchter weiter, während kein Mann sie verstand. Die Kariben hatten schon den ganzen Antillenbogen besetzt, kämpften um Puerto Rico und waren eben an der Ostküste Haitis gelandet, als die eiserne Faust der Weißen in diese Bewegung hineinstieß.
Der karibische Vormarsch stockte sofort; er kam nie wieder in Gang. Bei all seiner Militärtechnik aber bezwang Spanien das Kriegervolk nicht. Die Kariben waren meisterhafte Seefahrer, und sie kannten die schwierigen Wind- und Strömungsverhältnisse der westindischen Gewässer. Mit ihrer Taktik des plötzlichen Überfalls über große Entfernungen hinweg, ihrem Mut und ihrer Waffenfertigkeit besiegten sie die fremden Eindringlinge in vielen Einzelgefechten. Ihre Einbäume, durch überhöhte Bordwände seetüchtiger, angetrieben von 50 Mann mit Stechpaddeln, dazu durch Segel, waren noch auf Jahrhunderte hinaus der Schrecken aller weißen Niederlassungen rund um das Karibische Meer.
Die weißen Götter
Die Spanier, die jetzt die Neue Welt durchstreiften und sich auf deren Schätze stürzten, waren weder Siedler noch Händler noch Fallensteller, sondern militärische Führer, Söldner und Abenteurer: Eroberer. In ihrer Heimat war die christliche "reconquista" (Rückeroberung) Granadas eben erst beendet und das Bürgertum geschwächt worden; es herrschten die Inquisition und der Absolutismus. Zwar hatte Spanien im Mittelalter ausgezeichnete Universitäten, starke Städtebünde und auch die ersten Parlamente Europas hervorgebracht; diese Einrichtungen verfielen. Wirtschaft und Wissenschaft waren aufgeblüht dank Mauren und Juden, die man nun vertrieb. Und die Saat der Gewalt, des Missionsgeistes, der religiös verbrämten Habgier ging auch jenseits des Ozeans auf. So groß der Schritt voran auch war, den die Menschheit mit dem Anschluss der Neuen Welt tat – die parasitäre Tradition des spanischen Feudalismus drückte Lateinamerika den Stempel auf; sie bestimmt bis zum heutigen Tag die Entwicklung des Subkontinents – seine Schwäche und Unterlegenheit gegenüber dem Norden.
Die Spanier stellten alle anderen Entdeckernationen in den Schatten, nicht nur als Seefahrer. Binnen weniger Jahrzehnte brachen sie nach allen Richtungen auf, von Chile bis Florida und Kalifornien, getrieben von der Sucht nach Reichtum und Herrenleben. Für sie war Handarbeit entehrend, friedlicher Erwerb verächtlich, Sparsamkeit töricht.
Der Ausgangspunkt ihrer Unternehmungen war Haiti. In geographischer Unkenntnis legten sie hier, wie auch auf Cuba und Jamaica, die ersten Städte im feuchtheißen Norden an, wo der Passatwind das Landen erschwerte und der Dschungel den Weg ins Innere versperrte. Ihre Neigung zum Stadtleben förderte bald weitere Gründungen, nun aber an der gesünderen, besser zugänglichen Südküste. Schon ab 1495 wurde Santo Domingo an der Ozama-Mündung erbaut, als Hafen, Festung und Verwaltungszentrum, von dem aus man durch lichte Gebirgswälder flussaufwärts in die Golddistrikte kam. Sieben Jahre später zog der spanische Statthalter für ganz Westindien in Santo Domingo ein. Ihm folgte 1511 als geistliches Oberhaupt der Kolonien ein Erzbischof. Und für die Söhne der mittlerweile entstandenen weißen Oberschicht wurde 1538 eine Universität gegründet, die erste der Neuen Welt.
Die neue Gesellschaft formierte sich als eine hierarchisch gegliederte, auf den Schultern versklavter Indios ruhende Herrengesellschaft. Um die eigentlichen Führer – hohe Beamte und Offiziere, Kirchenfürsten und Grundbesitzer – sammelte sich allmählich ein bunter Tross von Einwanderern. Statt Arbeit in Handel und Landwirtschaft suchten sie leichtes Geld durch Patronage, wünschten sie Staatsstellungen zu erlangen und sich den großen Herren anzuschließen, deren Lebensform sie nachahmten.
Die spanische Staatspolitik hinderte gerade bäuerliche und gewerbetreibende Schichten daran auszuwandern. Ihre Bestimmungen schlossen Juden, Mauren, Ketzer und konvertierte Mohammedaner (selbst deren Söhne und Enkel) von der Überfahrt aus; sie wurde katholischen Nichtspaniern erst von Karl V. gestattet. Madrid war stets darauf bedacht, auch letzte Einzelheiten behördlich zu regeln. Die 1681 veröffentlichte Sammlung aller für Amerika geltenden Vorschriften enthielt 6 400 Gesetze. Wo diese jedoch den Interessen der kolonialen Oberschicht widersprachen, wie einige zum Schutz der Indios ergangene Erlasse, hatten sie kaum mehr Bedeutung als die später so glänzend formulierten Verfassungen der lateinamerikanischen Republiken.
Binnen eines halben Jahrhunderts entstand ein großes, zusammenhängendes Kolonialgebiet. Sein Schwerpunkt aber glitt vom insularen Sprungbrett weg auf den Kontinent. Als um die Mitte des 16. Jahrhunderts der Statthaltersitz nach Mexico (Vizekönigreich Neuspanien) und Lima (Vizekönigreich Peru) verlegt wurde, hatte Haiti längst seine Sonderstellung eingebüßt.
Seit 1520 gab es hier nur noch wenig Gold. Und anders als auf dem Festland, war der spanische Überschichtungsversuch hier gescheitert. Die unterworfenen Indios konnten die Last der Ankömmlinge nicht tragen. Unter dem Vorwand der Missionierung in den Golddistrikten zusammengepfercht, gingen sie an der Zwangsarbeit und an eingeschleppten Krankheiten zugrunde, starben unter den Peitschen der Aufseher oder wählten gruppenweise den Freitod. Schon 1517 lebten auf der Insel, trotz Zufuhr von 40 000 Bahama-Bewohnern, nur noch wenige tausend Indios.
Nun verließen auch die Spanier Haiti. Die Glücksritter setzten zum Festland über. Um den völligen Niedergang, ja die Verödung der Städte abzuwenden, bedrohte Madrid die Abwanderung mit Todesstrafe und Enteignung. Das wirkte; riesige Vermögen hatten sich in der Goldzeit angesammelt. Die Zurückgehaltenen wandten sich entweder der Viehzucht zu, die noch am ehesten ein Herrenleben gestattete, oder sie ließen Zuckerrohr anbauen. Zu beiden brauchte man viel Kapital und Negersklaven aus Afrika.
Tortuga – Ära der Piraten
Um diese Zeit begannen gefährliche Rivalen aus Nordwesteuropa sich um die spanischen Kolonien zu kümmern. Seeräuber hatten es auf Gold- und Silberfrachten abgesehen – anfangs nur im Ostatlantik, bald aber auch in westindischen Gewässern –, Schmuggelschiffe nutzten die Lücken im Warenangebot der vom "Mutterland" stets unterbelieferten spanischen Kolonien. Schließlich führten die Engländer ebenso viele Waren illegal nach Amerika ein, wie die Spanier auf legalem Weg dorthin brachten. Bei all dem kam das Handelsmonopol der spanischen Krone mit seiner starren Reglementierung den Freibeutern zugute. Es schanzte die Kolonialprofite hauptsächlich dem König zu, so dass spanische Kaufleute kaum imstande waren, Schiffe auszurüsten. Die Piraten dagegen bauten mit Unternehmereifer ihr Geschäft aus, gestützt auf staatliche Beteiligung.
In England gründeten Kaufleute und Mitglieder des Hochadels achtbare Gesellschaften – zur Finanzierung von Piratenaktionen gegen die Spanier; selbst Königin Elisabeth I. war Teilhaberin. Die Beute der britischen Kaperschiffe betrug im Jahresdurchschnitt 3 Millionen Dukaten (nach heutigem Geld 60 Millionen Mark). Einmal nahmen sie den Spaniern auf einen Schlag fast ½ Million Dukaten weg, mit der Besatzungstruppen in den Niederlanden besoldet werden sollten. Von den 2 421 Schiffen, die während der Regierungszeit Karl V. nach Amerika ausliefen, kehrten nur 1748 heim. Zugleich wuchs ein Wald von Schiffsmasten in britischen, holländischen und französischen Häfen.
Spanien reagierte rein administrativ. Es legte nun auch noch die Schiffsbewegungen fest, band sie an Routen und Terminpläne und schuf 1561 das erste Geleitzugsystem der Geschichte. Das System sah vor, Amerika nur einmal im Jahr durch zwei Riesenflotten zu beschicken, die "Armada" für den Süden, die "Flota" für den Norden des Kolonialreichs. Beide Geschwader sammelten sich, beladen mit Edelmetallen im Durchschnittswert von 93 Millionen Franc, zur Rückfahrt in Habana. Der schwer bestückte Geleitzug passierte die Floridastraße, dann steuerte er nordostwärts auf die Bahamas zu, wo oft das Verhängnis lauerte. Manchmal kam ein Sturm, der den spanischen Schiffsverband zerriss, den Freibeutern zu Hilfe.
Die Piraten hatten neben kleineren Schlupfwinkeln ab 1630 einen mächtigen Auslandsstützpunkt, der sie von Verbindungen zu ihren Herkunftsländern unabhängig machte. Sie ließen sich auf Tortuga nieder, einer 35 Kilometer langen, von Schildkröten bewohnten Felseninsel im Nordwesten Haitis – gegenüber jenem Küstenstrich, den Kolumbus zuerst betreten hatte. Tortuga lag nahe am Heimweg der Silberflotten und abgewandt von dem spanischen Zentrum Santo Domingo, hatte schwer erklimmbare Ufer, guten Ankergrund im Süden, kultivierbares Land und Süßwasser. Wild gab es auf Haiti, wohin die Piraten gern übersetzten. Ihre Jäger räucherten das Fleisch in "boucans" (Räucherhütten), weshalb man sie Bukanier nannte. Andere pflanzten Bohnen (Ernte in 6 Wochen), dann Maniok und Korn, schließlich auch Tabak. Gegen Tabak lieferten holländische Händler das, was man auf gekaperten Schiffen nicht vorgefunden hatte. Durch Spezialisierung der Gruppen auf Raub und friedliches Tun entstand eine merkwürdige Wirtschaftsgemeinschaft.
Der Seeräuberstaat wucherte in Spaniens Kolonialreich. Er erhielt Zuzug von französischen Auswanderern, besonders aus der Normandie. Gegen spanischen Widerstand besiedelten die Bukanier sogar Haitis Westküste. Dort stellten sie sich 1655 unter den Schutz Frankreichs, das so seine erste westindische Kolonie gewann. Noch einmal glückte es Spanien, die Eindringlinge zu vertreiben, doch musste es 1697 im Friedensvertrag von Ryswyck das westliche Drittel Haitis endgültig an Frankreich abtreten. Der Grenzverlauf wurde erst 80 Jahre später durch den Vertrag von Aranjuez geregelt.
Den Bukaniern genügten Kaperfahrten nicht mehr. Unter ihrer schwarzen Flagge mit Totenkopf und Stundenglas, dem "lustigen Roger", suchten sie die Häfen heim. Alle von See aus irgend erreichbaren Niederlassungen, soweit sie nicht schwer befestigt waren, wurden von ihnen überfallen. Allein zwischen 1655 und 1671 brandschatzten sie 18 spanische Orte, manche davon achtmal. Einer ihrer Anführer, der französische Seeräuber L'Olonois, plünderte mit 440 Mann Maracaibo und schleppte ungeheure Beute weg. Den frechsten Schlag führte der holländische Pirat van Horn. Er lief 1683 mit 6 Schiffen und 1 200 Freibeutern den spanischen Haupthafen in Mexico an. Bei Nacht drang er in Veracruz ein und plünderte die Stadt. Als im Morgengrauen am Horizont ein dreifach überlegenes spanisches Geschwader erschien, segelten die Bukanier mit ihrem Raub und 1 500 Geiseln mitten durch die Feindflotte hindurch, ohne dass diese auch nur ein Geschütz abzufeuern wagte. Ein Jahr darauf flatterte der "lustige Roger" am Pazifik. Die Piraten stürmten spanische Städte in Peru oder erpressten hohe Schutzgebühren. Gramont, ein heruntergekommener Pariser Adliger, durchstreifte mit seinen Banditen Mexico.
Die spanischen Behörden, zeitweilig in die Defensive gedrängt, gaben viele kleine Häfen auf. Niedergebrannte Küstenorte wurden meistens im Binnenland wiedererrichtet. Wo auf diese Art der Seeanschluss verloren ging, starb die exportabhängige Plantagenkultur; man ersetzte sie durch Viehzucht, ohne die wirtschaftliche Stagnation damit beheben zu können. Haitis Entwicklung, an das Zuckerrohr gebunden, erhielt einen schweren Stoß.
Windjammer-Strategie
Eine missglückte Unternehmung gegen Cartagena, den Haupthafen des spanischen Vizekönigreichs Neugranada, leitete das Ende der Bukaniermacht ein. Doch es war kein spanischer Sieg. Wieder hatten die Piraten die Stadt schon erobert und geplündert, als eine holländisch-englische Flotte sie angriff und vernichtete. Briten, Franzosen und Holländer hatten sich auf Aruba, Curaçao und Jamaica, besonders aber auf den Kleinen Antillen festgesetzt, die die Spanier gemieden hatten, um den Kariben auszuweichen. Das Versäumnis rächte sich. Die Inseln gaben ein hervorragendes Sprungbrett ab: Sie lagen im Passat-Strömungsluv zum Kern des spanischen Imperiums. Im Handumdrehen erreichte ein französisches Geschwader von Martinique aus Santo Domingo, während die Spanier von dort erst nach langwieriger Kreuzfahrt zurückschlagen konnten. Die segeltechnisch sehr fähigen Briten rechneten noch um 1770 für die Strecke Barbados–Jamaica mit 1 Woche, in Gegenrichtung jedoch mit 6 bis 8 Wochen Fahrzeit. Die Spanier leiteten ihre ohnehin schwerfälligen Gegenmaßnahmen deshalb über das Mutterland ein, ein zeit- und kräftezehrender Umweg, auf dem die Wut der Überfallenen verrauchte. Bei schlechtem Wetter fiel es ihnen auch schwer, mit dem damaligen Navigationsgerät die winzigen Feindinseln überhaupt zu finden. Es konnte geschehen, dass ihr Vergeltungsschlag statt des britischen Stützpunkts, dem er galt, einen französischen traf, was sie in neue Schwierigkeiten stürzte. Der strategische Nachteil war so groß, dass all ihre Versuche fehlschlugen, die fremden Basen auszutilgen. Spanien konnte sein von Piraten innen zernagtes Übersee-Imperium nicht mehr nach außen abschirmen.
Um die Mitte des 17. Jahrhunderts landeten die Niederländer auch auf Tobago und in Guayana, die Franzosen auf Cayenne und auf Haiti, die Briten sogar an zwei Stellen der mittelamerikanischen Küste. Den Vorzug der Kleinen Antillen erklärte ein englischer Geschichtsschreiber so: "... leicht zu besiedeln, leicht zu entvölkern und wieder zu bevölkern, reizvoll nicht nur hinsichtlich ihrer eigenen Schätze, sondern auch als Ausgangspunkt zu einem unendlichen und reichen Kontinent, vor dem sie liegen." Leicht zu entvölkern – das allerdings galt nur für die kleinen und flachen Inseln. Auf Barbuda und Santa Lucia scheiterten die britischen Besiedlungsversuche vorerst am Widerstand der Kariben. Auch die Franzosen brauchten drei Jahrhunderte, auf den Vulkaninseln Martinique, Dominica und Guadeloupe Fuß zu fassen; in den Bergen behaupteten sich weiterhin Kariben. Nachdem der Antillenbogen jedoch praktisch in fremde Hand gefallen war, glich Spaniens Kolonialreich einer unterminierten Festung.
Das schwarze Elfenbein
Zu dem militärischen und wirtschaftlichen Dilemma kamen innenpolitische Nöte. Auf Haiti war mit dem Hinsterben 1 Million Indios jeder Überschichtungsversuch misslungen. Deshalb verschaffte man sich, wie ein deutscher Historiker es ausdrückte, "die fehlende Unterschicht nachträglich durch Einfuhr..., ein Vorgang, den man eigentlich Unterlagerung oder Unterschichtung nennen müsste".
Schon im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts begann der Sklavenimport aus dem verkehrsgünstig gelegenen Westafrika, ursprünglich auf Vorschlag des spanischen Geistlichen Las Casas, dem es darum ging, einen Rest der bestialisch zugrunde gerichteten Indios zu retten. Die ersten nach Amerika verschleppten Afrikaner trafen 1502 in Santo Domingo ein – nur 10 Jahre nach der Ankunft des Kolumbus. Die Plantagenbesitzer griffen gleich zu. Sie zahlten für einen erwachsenen Neger fünfzehnmal so viel wie für einen Indianer.
Im Sklavenhandel führte schließlich England, das später für sich den Ruhm beanspruchte, gegen das unmenschliche Geschäft opponiert zu haben. John Hawkins, ein Reeder aus Plymouth, legte 1562 den Grundstein eines Unternehmens, das fast drei Jahrhunderte hindurch Weltbedeutung hatte. An der afrikanischen Guineaküste nahm er eine Sklavenkarawane an Bord, aneinandergekettete Neger jeden Alters, denen die Sklavenjäger ein Zeichen eingebrannt hatten, bevor sie sie aus dem Landesinneren herantrieben. Hawkins schaffte sie nach Haiti und organisierte neue Transporte. Elisabeth I. adelte ihn für diese Leistung und erhob ihn zum Admiral. Er legte sich ein Wappen zu, das einen gefesselten Neger zeigte.
So schlimm die Menschenjagd in Afrika und die Zustände auf den amerikanischen Plantagen waren, die Leiden der Überfahrt waren schlimmer. "Wenn die Sonne sank", schrieb der Historiker McMasters, "begab sich die ganze Rotte nach unten. Der Platz, der dort jedem zum Hinlegen zugemessen war, maß 180 mal 40 Zentimeter. Um sie zu zwingen, dicht beieinander zu liegen, wurde die Peitsche benutzt. Es war für den einzelnen unmöglich, sich von der rechten auf die linke Seite umzudrehen... Das Elend der Nächte war aber nichts gegenüber dem Elend eines stürmischen Tages. Dann wurden die Luken zugemacht, die Persenning wurde über die Gitter gezogen, und die Luftzufuhr hörte ganz auf. Die Luft (in den oft nur halbmeterhohen Zwischendecks) wurde dick zum Ersticken; der Fußboden war nass vom Schweiß, und das Ächzen und Keuchen der eingepferchten Neger war bis an Deck zu hören... Es war nichts Ungewöhnliches, dass bis zu fünf Leichen auf einmal heraufgebracht und über die Reling geworfen wurden. Für ein Sklavenschiff, das zwischen Afrika und Westindien verkehrte, war eine Sterbeziffer von 30 Prozent nichts Seltenes." Der Gestank der Sklavenschiffe war oft so stark, dass er mit dem Wind meilenweit wahrgenommen wurde.
Trotzdem betrug der Handelsgewinn bis zu 1 000 Prozent auf einer einzigen Überfahrt. Während 1630 erst 15 Sklavenschiffe im Liverpooler Hafen festmachten, waren es 1690 schon 132. Natürlich drängten sich auch Holländer, Franzosen und Portugiesen in das lohnende Geschäft; doch in britischen Schiffsrümpfen wurden viermal soviel afrikanische Sklaven transportiert wie von allen anderen Nationen zusammen. Von 1600 bis 1640 und dann wieder im folgenden Jahrhundert besaß England das Monopol auf den Sklavenhandel mit sämtlichen spanischen Gebieten. Der Utrechter Vertrag von 1713 berechtigte die English South Sea Company, binnen 30 Jahren 144 000 Neger nach Spanisch-Amerika zu bringen. Der Gesamtexport nach allen Teilen Amerikas während dreier Jahrhunderte wird auf 12 Millionen Negersklaven geschätzt. Da auf jeden verkauften Neger fünf kamen, die bei der Sklavenjagd oder auf See starben, büßte Afrika 60 Millionen Menschen ein.
Um 1744 standen 300 Schiffe im Dienst englischer Sklavenhändler; ihr Heimathafen war Liverpool. Durch 400 Warenfrachter ergänzt, bildete die Westindienflotte den Kern der damals führenden Seemacht. Dazu erarbeiteten die westindischen Plantagensklaven ein Sechstel des britischen Nationaleinkommens, obschon sie zu jener Zeit nur ein Zehntel der Gesamtbevölkerung des Vereinigten Königreichs stellten. Der erstarkende britische Kapitalismus zog doppelten Nutzen aus den Sklaven: aus dem Handel mit "schwarzem Elfenbein" und aus der Plantagenarbeit. Die großen Vermögen vieler Lords gehen auf den Schweiß und das Blut verschleppter Afrikaner zurück.
In der Neuen Welt entstand ein Ausbeutungssystem, das die antike Sklaverei an Intensität und Grausamkeit übertraf. Die Plantagenwirtschaft auf den Antillen glich "einer gigantischen Retorte, in der Jahr für Jahr Hunderttausende von Menschenleben in Profite für europäische und amerikanische Sklavenhalter umgesetzt wurden", schrieb ein sowjetischer Historiker. "Durch ungeheure Bestialität und Quälerei pressten die Plantagenbesitzer das Letzte aus den Sklaven heraus und verursachten dadurch häufig ihren frühzeitigen Tod." Deshalb konnten sie nie mit einem natürlichen Zuwachs an Arbeitskräften rechnen. Nur der ständige Zustrom aus Afrika sicherte die Produktion. Wer sie steigern wollte, musste mehr Sklaven einführen. Das Zuckerrohr, von Madeira eingeführt, gedieh im Tropenklima – zusammen mit Kaffee und Tabak – zur Quelle unerhörter Bereicherung. Die Exporterlöse kamen den früheren Erzgewinnen gleich. Hatte Spanien in drei Jahrhunderten 25 000 Tonnen Gold und 100 000 Tonnen Silber im Gesamtwert von 28 Milliarden Franc noch allein erbeutet, so musste es sich in das neue Geschäft mit den Briten und Franzosen teilen. Die Pflanzungen hatten Weltbedeutung; ihr Wert allein erklärt die scharfe Rivalität der Kolonialmächte auf den Antillen. Die Inseln glitten aus einer Hand in die andere, ihre oft dünne weiße Herrenschicht erlag rasch Angriffen von außen.
Bedroht war auch die innere Stabilität. Die Spanier hatten schon in der Frühzeit ihrer Kolonisation Indianeraufstände nur schwer niederschlagen können, weil Negerflüchtlinge zu den Indios stießen. So gering der Spielraum war, den das Sklavenjoch ließ – die Neger leisteten über Jahrhunderte hinweg zähen Widerstand. "Sie arbeiteten absichtlich langsam, liefen fort, setzten Plantagen in Brand, erschlugen Aufseher und Plantagenbesitzer, weigerten sich, Kinder zu gebären, und organisierten bewaffnete Aufstände", schrieb William Z. Forster. "In den karibischen Ländern ereigneten sich während der ganzen Kolonialperiode zahllose Sklavenaufstände, deren erster auf der Plantage des Diego Kolumbus, eines Bruders des Entdeckers, Anfang des 16. Jahrhunderts ausbrach." Spanische Chroniken verzeichnen so viele Fälle von passivem Widerstand, Massenflucht und Sklavenverschwörung, dass der Mythos vom geduckten Afrikaner sich als Legende entpuppt.
Revolution auf Haiti
Die Sehnsucht nach Freiheit ist so alt wie die Sklaverei. Auf Haiti und anderswo waren einzelne Sklaven ins Gebirge geflohen, um sich dem Rest der Indios anzuschließen; nur auf flachen Zwerginseln gab es diese Chance nicht. In Jamaica hatten die Spanier, als sie 1655 vor den Briten flohen, viele ihrer Haus- und Feldsklaven zurückgelassen. Diese lieferten den neuen Herren zwischen verkarsteten Kalkbergen einen jahrzehntelangen Kleinkrieg und ertrotzten eine begrenzte Autonomie. Der Vorgang wiederholte sich im französischen Cayenne und in Niederländisch-Guayana.
Besonders gefährdet war die weiße Herrschaft in den florierenden nichtspanischen Gebieten. Mit wachsender Exportleistung stieg dort die Sklavenzahl, wurde die Ausbeutung intensiver, häufte sich das soziale Dynamit. Gerade in den gewinnträchtigsten Kolonien saßen die "Pflanzer" auf Sprengstoff, und sie wussten es. Sie fühlten die Revolutionsgefahr, die sie mit der neuen Kolonialbevölkerung selbst geschaffen hatten, und taten alles, sie niederzuhalten. Zwanzig Peitschenhiebe auf den bloßen Rücken, Brandmarkung des Gesichts oder Ohrabschneiden galten als durchaus glimpfliche Strafen.
Der Sprengstoff war sehr unterschiedlich zusammengesetzt. Im spanischen Teil Lateinamerikas war er nicht so brisant. Dort lebten Ende des 18. Jahrhunderts neben 7 bis 8 Millionen Indios und 3 Millionen Mischlingen höchstens 600 000 Neger – beherrscht von einer Oligarchie, die sich auf 1½ Millionen Kreolen (in Amerika geborene Spanier) stützte. Der spanische Osten Haitis, seit der Piratenzeit zurückgeblieben, beschäftigte nur 15 000 Negersklaven, denen 110 000 Freie gegenüberstanden. Das Verhältnis zwischen Herr und Diener war meistens patriarchalisch, die Sklaven wurden "mild behandelt", wie es in den Geschichtsbüchern heißt. Im französischen Drittel der Insel aber, Saint Domingue genannt, gab es fast ½ Million Negersklaven; noch im Jahr 1788 trafen 30 000 frisch aus Afrika ein. Ihnen standen nur 28 000 Weiße gegenüber; rund 40 000 Mulatten und freie Farbige nahmen eine Mittelstellung ein.
Das Ausbeuterparadies Französisch-Haiti, damals die wertvollste Kolonie der Welt, schilderte ein amerikanischer Historiker so: "Tausende von schwarzen Sklaven waren dort an der Arbeit und nächtigten auf den Ackerrainen. Viele Besitzer lebten in geradezu barbarischem Luxus, besaßen Paläste, vergoldete Kutschen, viele Pferde, eine perfekte Dienerschaft und unbegrenzte Macht. Für den weißen Mann konnte es im 18. Jahrhundert wohl nirgends ein köstlicheres Leben geben... 10 000 Quadratmeilen brachten mehr Zucker, Kaffee, Schokolade, Indigo, Farbhölzer und Gewürze hervor als alle anderen Gebiete Westindiens zusammengenommen." Um die Verständigung der Schwarzen untereinander zu erschweren, verstreute man die Angehörigen gleicher Stämme über das ganze Land. Das sollte die Aufstandsgefahr mindern.
Doch solche Schachzüge nützten nichts. Zunächst protestierten – unter dem Eindruck des nordamerikanischen Unabhängigkeitskrieges, mehr noch der großen französischen Revolution – die Kreolen gegen die wirtschaftliche Bevormundung durch das Mutterland. Gleichzeitig forderte die Zwischenschicht der Mulatten und freien Neger ihre vollen Bürgerrechte. Durch die Spaltung der weißen Herren in "große" und "kleine" ermutigt, sandten die Mulatten schon 1789 eine Abordnung nach Frankreich. Sie erwirkten am 15. Mai 1791 einen Beschluss der Nationalversammlung, der den Mulatten Gleichberechtigung und der Kolonie einen autonomen Status versprach. Aber die Weißen in Haiti weigerten sich, ihre politischen Rechte "mit einer entarteten Menschenrasse zu teilen". Diese einleitende Auseinandersetzung zwischen den Kolonisatoren und ihrem Mutterland sowie der Konflikt zwischen Farbig und Weiß berührten die Sklavenfrage überhaupt nicht. Zur Befreiung der halben Million Neger war bis dahin noch nichts geschehen. Doch der Druck der Mulatten-Bourgeoisie trieb die Dinge weiter. Und plötzlich, am 22. August 1791 mitternachts, kam es zur Explosion. Der Aufstand begann, von entflohenen Sklaven gezündet, in der Nordebene nahe Cap François, unweit der ersten Landungsstelle des Kolumbus. "Im Augenblick standen 1 200 Kaffee- und 200 Zuckerplantagen in Flammen", entsetzte sich Adolphe Thiers. "Gebäude und Gutshäuser wurden in Asche gelegt, die unglückseligen Besitzer wurden von den wutentbrannten Negern gejagt, ermordet und in die Flammen geworfen. Nichts blieb von den Schrecken des Sklavenkrieges verschont."
12 Jahre verwickelter Kämpfe folgten. Gestützt auf französisches Militär, behielten die "Pflanzer" im Westen und Süden das Heft in der Hand. Dort forderten die Rebellen zunächst nur die halbe Freiheit: 3 Wochentage zur Arbeit auf eigenem Boden, die andere Zeit sollte den Herren gehören. Im Juli 1793 aber, nach dem Fall von Fort Dauphin, nun Fort Liberté genannt, und der Einnahme des Hafens Cap François (heute Cap Haitien), griff die Erhebung auf das ganze Land über. Ein Neger namens Toussaint l'Ouverture führte das Sklavenheer an.
Spanien, das damals zusammen mit England Krieg gegen das revolutionäre Frankreich führte, mischte sich ein. Es wollte die Bedrängnis der Kolonialfranzosen nutzen, um seine Herrschaft über Westhaiti wieder zu errichten. Klug genug, nicht nur militärisch vorzugehen, versprach Madrid allen Sklaven auf der Insel Freiheit und Gleichberechtigung. Danach zog Toussaint, der nie mehr als 20 000 Mann unter Waffen hatte, als General der spanischen Armee gegen die Franzosen. Anfang 1794 jedoch verkündete die Pariser Nationalversammlung, nun von linken Bürgerlichen beherrscht, ihrerseits die Aufhebung der Sklaverei in den Kolonien. Toussaint verließ die Spanier, deren Absicht er inzwischen durchschaut hatte. Er vertrieb sie mit französischer Hilfe fast vollkommen von der Insel.
Jetzt erkannte England seine Chance. Einem Ruf der bedrängten "Pflanzer" folgend, landeten britische Truppen auf Haiti. Doch Toussaints Negerheer schlug das seuchengeschwächte Expeditionskorps ebenso, wie es die Franzosen und Spanier besiegt hatte. Von 15 000 Interventen lebten nur noch 1 000, als der britische Kommandeur Maitland sich am 1. Oktober 1798 schließlich ergab. Demütig unterschrieb er einen Vertrag, in dem er die Unabhängigkeit Haitis anerkannte. Etwas Unerhörtes war geschehen: Sklaven, auf britischen Schiffen hierher gebracht, hatten England – und nicht nur England – geschlagen! Sie hatten ihre Ketten gesprengt, ein kriegstüchtiges Heer gebildet und beherrschten die ganze Insel. Die weißen Plantagenbesitzer waren vertrieben. Im Januar 1801 stellte Toussaint die politische Einheit der Insel her; völkerrechtlich gehörte sie nach dem Frieden von Basel zu Frankreich. Nun erst erhielt sie ihren alten Namen wieder – Haiti, Land der Berge. Die französische Bezeichnung Saint Domingue (nach dem spanischen Namen Santo Domingo) wurde offiziell abgeschafft.
Die schwarze Republik
Die Revolution verschmolz die Neger, zusammengewürfelt aus vielen Stämmen und Sprachgruppen, zur Nation. Der Ruf "Die Weißen kommen!" ließ jeden Streit verstummen. Denn nur vereint konnten die Rebellen ein Heer aufstellen und unterhalten. Die Nation entstand im Freiheitskampf – dem ersten in ganz Amerika, der die Sklaverei abschaffte. Der Umsturz auf Haiti, in Europa als Sensation angesehen, hatte weltweite Wirkung.
Aber der Kampf war noch nicht entschieden. Zwar hatte das französische Direktorium der Kolonialbevölkerung schon im Februar 1798 völlige Gleichberechtigung bewilligt und Toussaint als Generalgouverneur auf Lebenszeit und als Oberbefehlshaber aller Truppen auf Haiti bestätigt. Als er jedoch nach inneren Schwierigkeiten – die Mulatten hatten zeitweilig auf der fruchtbaren Südwesthalbinsel einen Separatstaat gebildet – der Negerrepublik am 9. Mai 1801 eine eigene Verfassung gab, schlug das "Mutterland" brutal zurück.
Dort war jetzt die Großbourgeoisie im Sattel. "Napoleon, der mit vollen Segeln auf Ruhm und Eroberung zusteuerte, beschloss, Toussaint Zügel anzulegen und die Insel wieder unter die feste Kontrolle der französischen Plantagenbesitzer zu bringen", schrieb William Z. Forster. "Er brauchte Haiti auch als Ausgangsstellung, um seinen grandiosen Plan, durch die Ausdehnung Louisianas ein französisches Imperium in Amerika zu schaffen, in Angriff zu nehmen. Napoleon... ordnete an, in den nahegelegenen französischen Kolonien, auf Martinique und Guadeloupe, die Sklaverei wieder einzuführen. Dies erfüllte die Herzen der kämpfenden Neger von Haiti mit dem Mut der Verzweiflung. General Leclerc erhielt von Napoleon den Befehl, Haiti zu unterwerfen; im Jahre 1801 erschien er mit 54 Schiffen und 29 800 kampferprobten Soldaten vor der Insel, um den Befehl auszuführen."
Der noch nicht dreißigjährige, mit der Schwester Napoleons verheiratete Leclerc hatte 1793 Toulon mit erstürmt, sich beim Alpenübergang und beim Staatsstreich seines Schwagers ausgezeichnet, ebenso als Divisionskommandeur in der Schlacht bei Hohenlinden. Nun zum Generalkapitän von Haiti ernannt, landete er gegen erbitterten Widerstand bei Cap François. Nach verlustreichen Vorstößen ins Landesinnere beging er, wie Forster in seinem "Abriss der politischen Geschichte beider Amerika" urteilt, "eine der empörendsten Verrätereien der gesamten amerikanischen Geschichte. Unter dem Vorwand, er wolle Frieden schließen, lud er Toussaint zu einer Konferenz, nahm ihn gefangen, legte ihn in Eisen und schaffte ihn nach Frankreich". Toussaint, eine der glänzendsten Gestalten des revolutionären Amerika, ein ehemaliger Sklave, der erste Präsident des Landes, starb in den Kasematten von Fort Joux bei Besançon.
Nach dem Verlust seines Feldherrn kämpfte das Negerheer, geführt von den Generalen Christophe und Dessalines, weiter gegen Elitetruppen der damals als unbesiegbar geltenden französischen Armee. Leclerc kam schlecht davon, obschon ihm von Frankreich her dauernd Verstärkung nachfloss. Verbittert schrieb er an Napoleon: "Um Ihnen eine Vorstellung von meinen Verlusten zu geben, sollen Sie wissen, dass das 7. Linienregiment 1 395 Mann stark war, als es hier eintraf; jetzt stehen 83 halbkranke Männer im Dienst, und 107 sind im Hospital, die anderen sind tot. Das 11. Regiment der leichten Infanterie landete hier mit 1 900 Mann; heute sind 163 Mann dienstfähig und 200 im Hospital... So machen Sie sich jetzt selbst ein Bild von meiner Lage in einem Lande, in dem seit 10 Jahren ein Bürgerkrieg wütet und die Rebellen überzeugt sind, dass wir sie der Sklaverei unterwerfen wollen."
Das gelbe Fieber befiel auch den Briefschreiber; Leclerc starb am 2. November 1802. Seine Witwe verband sich im folgenden Jahr mit dem Fürsten Borghese; zur selben Zeit musste Leclercs militärischer Nachfolger, General Rochambeau, auf Haiti kapitulieren. Mit 8 000 Soldaten, dem Rest des Expeditionskorps, räumte er die Insel. Von insgesamt 43 000 Mann, die Napoleon zu ihrer Rückeroberung aufgeboten hatte, waren 35 000 umgekommen. Und gleich nach der Abfahrt wurde die französische Flotte von britischen Seestreitkräften aufgebracht – die Niederlage war besiegelt.
Der Schlag, den ein Halbmillionenvolk Napoleon versetzt hatte, traf ihn härter als das Scheitern in Ägypten. Dort verlor er ein Projekt und rettete einen bedeutenden Rest seiner Armee. Mit Haiti aber büßte Frankreich nicht nur seinen wertvollsten Überseebesitz aus der Königszeit ein. Es verlor auch die – kurz zuvor gegen das habsburgische Toscana eingetauschte – Baumwollkolonie Louisiana und damit seine letzte Stellung auf dem nordamerikanischen Kontinent. Die erste Revolution Lateinamerikas war stärker gewesen als das französische Heer.
Mit dem Abzug des Expeditionskorps war ganz Haiti frei. Die Franzosen ließen nur ihre Sprache, die Städte und ein ziemlich gutes Straßennetz zurück. In der Unabhängigkeitserklärung vom 29. November 1803 verkündeten die ehemaligen Sklaven stolz: "Wir haben unser Recht behauptet und unsere ursprüngliche Würde wiedergewonnen. Wir schwören, sie keiner Macht der Erde jemals auszuliefern. Der furchtbare Schleier des Vorurteils ist in Stücke gerissen. So bleibe es immerdar. Wehe dem, der es wagen sollte, seine blutdurchtränkten Fetzen wieder zusammenzusetzen."
Auch gegen andere Formen des Kolonialismus schloss sich der junge Negerstaat ab. So hieß es im Artikel 12 der Verfassung, die der konsequente Antikolonialist Dessalines 1805 dem Land gab: "Kein Weißer, welcher Nation er auch sei, kann auf dieses Territorium seinen Fuß als Eigentümer setzen; keiner darf in Zukunft irgendein Eigentum hier erwerben."
Die Sonne sinkt
So stark die siegreiche Revolution auf die Freiheitsbewegungen ringsum auch ausstrahlt, der Negerstaat selbst bleibt isoliert. Die Nachbarländer behandeln ihn als einen Fremdkörper, den sie weder beseitigen können noch in ihre Gemeinschaft aufnehmen wollen. Von den sklavenhaltenden Mächten ist nichts anderes zu erwarten.
Doch auch die jungen Republiken handeln so, als sie um 1820 unter kreolischer Führung das spanische Kolonialjoch zerbrechen. Nicht einmal Großcolumbien, das sein Entstehen haitianischer Hilfe mitverdankt, erkennt die Negerrepublik an. Sie existiert anderthalb Jahrzehnte, ohne das auch nur ein einziger Staat sie offiziell zur Kenntnis nimmt.
Dieser Boykott lähmt den Außenhandel. Haitis Wirtschaft liegt ohnehin darnieder; die Plantagenerträge sind katastrophal geschrumpft, die Quellen des Reichtums scheinen versiegt. Zwölf Jahre Krieg und der Zerfall des alten Ausbeutungssystems haben die Exportkraft des Landes erschöpft. Die meisten der ehemaligen Sklaven bebauen eine winzige Parzelle, die ihre Familie knapp ernährt.
Vor diesem Hintergrund von innerer Not und äußerer Anfeindung brechen Machtkämpfe aus. Dessalines lässt sich 1804 unter dem Namen Jacob I. zum Kaiser ausrufen; 2 Jahre später fällt er einer Verschwörung zum Opfer. Ihre Köpfe sind der Negergeneral Henri Christophe, einst Mitstreiter Dessalines', und der Mulattenführer Alexander Pétion. Beide entzweien sich nun ihrerseits, der alte Konflikt zwischen Farbig und Schwarz bricht auf. Dahinter steht ein Klassengegensatz: Negerbauern und Mulattenbourgeoisie haben verschiedene Interessen.
Wie schon einmal 10 Jahre zuvor, spaltet sich 1808 auf der Südwesthalbinsel unter Pétion eine Mulattenrepublik ab. Die beiden Staaten trennt ein "zehn Stunden breiter Landstrich", wie es in den Berichten heißt. Man lässt ihn absichtlich unbebaut, so dass sich am Fuß der Landzunge, ostwärts der Linie Jacmal-Léogane, aus Lianen und Dornengestrüpp eine natürliche Trennmauer bildet, Ausdruck erbitterter Feindschaft, von der Dritte profitieren: Während Neger und Mulatten streiten, besetzt Spanien erneut den Osten der Insel.