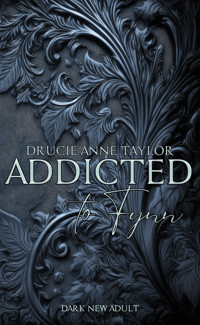4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Aleksandrs Leben bietet keinen Platz für die Liebe. Er nimmt seine Aufgaben innerhalb der Bruderschaft zu ernst, um sich auf eine Frau einzulassen, außerdem hat er sein Herz, seit dem Tod seiner ersten großen Liebe, vor sämtlichen Gefühlen verschlossen. Doch als die junge Samantha Wheeler vor seinen Augen unfreiwillig zwischen die Fronten gerät, ist es Aleksandr, der sie retten will. Er kümmert sich um die verletzte und gebrochene Frau, die er aus einem früheren Leben zu kennen scheint. Zwischen den beiden entbrennt eine zarte Liebe, die nicht nur von den Feinden der Bruderschaft bedroht wird, sondern auch im inneren Kreis verhindert werden will, denn Samantha ist nicht die, die sie vorgibt zu sein. Als Aleksandr bewusst wird, wie seine Gefühle für sie wirklich aussehen, ist es beinahe zu spät. Wird er Samantha vor ihrer Vergangenheit bewahren können oder sie für immer verlieren?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Dark Monster
GEGEN JEDE GEFAHR
DANGEROUS HEROES
BUCH SECHS
DRUCIE ANNE TAYLOR
Copyright © 2020 Drucie Anne Taylor
Korrektorat: S.B. Zimmer
Satz & Layout © Julia Dahl
Umschlaggestaltung © D-Design Cover Art
Auflage: 01 / 2023
Angelwing Verlag / Paul Dahl
6 Rue Saint Joseph
57720 Obergailbach / Frankreich
Alle Rechte, einschließlich das, des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten. Dies ist eine fiktive Geschichte, Ähnlichkeiten mit lebenden, oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Alle Markennamen, Firmen sowie Warenzeichen gehören den jeweiligen Copyrightinhabern.
Inhalt
Vorwort
Prolog
Prolog
1. Samantha
2. Aleksandr
3. Samantha
4. Aleksandr
5. Samantha
6. Aleksandr
7. Samantha
8. Aleksandr
9. Samantha
10. Aleksandr
11. Samantha
12. Aleksandr
13. Milena
14. Aleksandr
15. Milena
16. Ivan
17. Aleksandr
18. Milena
19. Aleksandr
20. Milena
21. Aleksandr
22. Milena
23. Aleksandr
Epilog
Danksagung
Über die Autorin
Weitere Werke der Autorin
Dark Wolf: Gegen jede Regel (Dangerous Heroes 1)
Dark Butcher: Gegen jeden Widerstand (Dangerous Heroes 2)
Dark Predator: Gegen jedes Risiko (Dangerous Heroes 3)
Dark Reaper: Gegen jede Vernunft (Dangerous Heroes 4)
Dark Beast: Gegen jede Bedrohung (Dangerous Heroes 5)
Dieses Buch
Aleksandrs Leben bietet keinen Platz für die Liebe. Er nimmt seine Aufgaben innerhalb der Bruderschaft zu ernst, um sich auf eine Frau einzulassen, außerdem hat er sein Herz, seit dem Tod seiner ersten großen Liebe, vor sämtlichen Gefühlen verschlossen. Doch als die junge Samantha Wheeler vor seinen Augen unfreiwillig zwischen die Fronten gerät, ist es Aleksandr, der sie retten will.
Er kümmert sich um die verletzte und gebrochene Frau, die er aus einem früheren Leben zu kennen scheint. Zwischen den beiden entbrennt eine zarte Liebe, die nicht nur von den Feinden der Bruderschaft bedroht wird, sondern auch im inneren Kreis verhindert werden will, denn Samantha ist nicht die, die sie vorgibt zu sein.
Als Aleksandr bewusst wird, wie seine Gefühle für sie wirklich aussehen, ist es beinahe zu spät. Wird er Samantha vor ihrer Vergangenheit bewahren können oder sie für immer verlieren?
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
Dieses Buch ist voller Brutalität, Schimpfwörter, Flüche und vielen weiteren Beschreibungen, die dich schockieren könnten. Wenn du einen rosaroten Liebesroman erwartest, der sich strikt an die Realität hält, wird dich dieses Buch enttäuschen. Diesmal habe ich bewusst Grenzen ausgelotet und überschritten. Dieses Buch ist reine Fiktion, nichts von dem, was darin geschieht, passiert wohl so im wahren Leben und wenn doch, dann in den Schatten, in die wir nicht blicken.
Wenn ihr derartige Darstellungen nicht lesen möchtet oder euch dabei unwohl fühlt, empfehle ich euch, dieses Buch nicht zu lesen, da es euch triggern könnte – und das ist das Letzte, was ich erreichen will.
Alle sexuellen Handlungen zwischen den Protagonisten sind einvernehmlich, dennoch gilt im wahren Leben »safer Sex« und nicht »rein da und ab dafür.«
Dieses Buch behandelt sensible Themen und könnte dich triggern, wenn du empfindlich auf Gewalt gegen Frauen reagierst!
Jedem anderen wünsche ich viel Spaß mit Aleksandrs Geschichte, die das Finale der »Dangerous Heroes« bildet und die Serie damit abschließt.
Prolog
ALEKSANDR
Siebzehn Jahre zuvor
Moskau
Ich spuckte das Blut auf das Kopfsteinpflaster, nachdem dieses mudak mir mit seinem Klingenschlagring ins Gesicht geschlagen hatte. Im Gegensatz zu ihm hatte ich nur zwei normale Schlagringe, mit denen ich mich gegen dieses dumme Arschloch verteidigen konnte. Warum wir aneinandergeraten waren, wusste ich nicht mehr. Es war zu viel Wodka geflossen, als dass ich mich daran erinnern könnte, aber es war nicht wichtig. Ich holte aus, landete einen Treffer und der Wichser ging zu Boden.
»Aleks!«, rief eine hysterische Frauenstimme.
Es musste Katia sein, meine Freundin, aber ich war in einem Tunnel. Ich wollte diesen Hurensohn umbringen, seit ich seinen ersten Kinnhaken eingesteckt hatte.
Der Mistkerl lag am Boden, ich kniete mich auf seine Brust und schlug wie ein Wahnsinniger auf ihn ein.
Immer und immer wieder.
Sein Blut benetzte meine Hände, spritzte mir ins Gesicht und in den Mund – der metallische Geschmack ließ mich in einen Mordrausch verfallen.
»Aleks, du bringst ihn um!«, schrie Katia und zog an meinem Arm.
Ich riss mich von ihr los, schubste sie weg und sie stürzte auf das Kopfsteinpflaster. Ich sah, dass sie mit dem Kopf auf die Bordsteinkante aufschlug und reglos liegen blieb, aber der Wichser, auf dessen Brustkorb ich kniete, war wichtiger. Katia würde sich erholen.
* * *
Das Gesicht meines Angreifers war nicht mehr zu erkennen. Es war nur noch eine blutige Masse und unter seinem Kopf sammelte sich die rote Flüssigkeit, die in die Fugen zwischen den Pflastersteinen floss.
»Steh auf!«, verlangte eine fremde Stimme.
Ich richtete mich auf und spähte in die Dunkelheit. Diese gottverdammte Gasse war finsterer als der Arsch einer Nutte. »Wer ist da?«
Der Mann kam näher, an seiner Seite standen drei weitere, alle trugen Anzüge. »Du hast ihn umgebracht.«
Daraufhin zuckte ich mit den Schultern. »Verdientermaßen, würde ich sagen.«
Sein Blick glitt über den Boden und haftete an etwas Anderem als mir und dem Kerl, den ich zu Brei geschlagen hatte. »War sie auch dein Opfer?«
Ich drehte mich um und sah, dass Katia sich nicht bewegt hatte. Mit einem Schnauben eilte ich zu ihr und ging auf die Knie. »Kotenok?«, fragte ich leise und tastete ihren Hals nach ihrem Puls ab. Ich konnte ihn nicht finden.
»Sie ist tot, nicht wahr?«
Ich ballte die Fäuste und richtete mich auf, danach wandte ich mich wieder den Fremden zu. »Was wollt ihr von mir?«
»Ich habe gesehen, was du mit dem Kerl gemacht hast, und nun ein Angebot für dich«, antwortete der, der mich bereits angesprochen hatte.
»Wer bist du?«, wollte ich wissen, dabei verengte ich die Augen und musterte ihn.
»Mein Name ist Vladislaw Morosow.« Er betrachtete mich eher ruhig. »Und du bist?«
»Aleksandr Karinski Romanow«, erwiderte ich und verkniff mir, die Miene zu verziehen. Jetzt hatte mich der Penner in der Hand und könnte mich problemlos an die Bullen verpfeifen.
Er schaute zu seinen Leuten und nickte ihnen zu. Einer von ihnen setzte sich von der Gruppe ab. »Ich lasse hier aufräumen und du begleitest uns.«
»Verzichte«, entgegnete ich, wandte mich ab und ging los, als ich hörte, dass hinter mir Pistolen entsichert wurden.
»Ich habe dich nicht um deine Zustimmung gebeten, sondern es so entschieden.«
Ich schnaubte amüsiert, schüttelte den Kopf und lief weiter.
Eine Kugel sauste an meinem Ohr vorbei, weshalb ich innehielt. »Du wirst mich begleiten, Aleksandr. Oder soll ich die Polizei rufen, weil ich einen Doppelmord beobachtet habe?«
»Das ist Erpressung.«
»Ich stelle dich vor die Wahl, Junge.«
Schritte näherten sich mir, weshalb ich mich umdrehte. Ich merkte mir die Gesichter der Männer, doch Morosows prägte ich mir besonders gut ein. Man begegnete sich immer zweimal im Leben, das nächste Mal würde er Bekanntschaft mit meinen Fäusten machen und sie womöglich nicht überleben. »Na gut, ich begleite euch.«
Er nickte und zeigte mir zwei Reihen gelber Zähne, zwischen denen eine glühende Zigarre steckte. »Wunderbar.« Noch einmal nickte er seinen Männern zu, die mich flankierten und zu einem Wagen brachten.
* * *
»Das ist das Haus von Stanislav Wolkow«, begann Morosow. Stolz schwang in seiner Stimme mit.
»Und was interessiert mich das?«, hakte ich desinteressiert nach und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Junge, woher kommst du?«
»Moskau.«
»Wer ist deine Familie?«
Damit traf er einen wunden Punkt, jedoch verbarg ich meine Gefühle vor ihm. »Ich bin allein.«
»Du hast niemanden?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Wo wohnst du?«
»Mal hier, mal dort«, antwortete ich übellaunig. Er musste nicht wissen, dass ich im Sommer am Fluss schlief und im Winter Schutz in Obdachlosenheimen suchte, wenn ich nicht bei Katia übernachtete. Ihre Familie mochte mich nicht besonders, weshalb es nur sehr selten vorkam, sofern es ihr gelang, mich hineinzubringen.
»Der Pakhan sucht ständig neue Männer, die ihm als byk oder als nochnoy storozh dienen. Du hast die besten Voraussetzungen. Du bist allein, brutal, skrupellos … Du hättest ein Zuhause, warme Mahlzeiten …«
»Unter welchen Bedingungen?«
»Du musst sämtliche Kontakte nach außen abbrechen, deine Loyalität unter Beweis stellen und zeigen, dass du unverzichtbar bist«, antwortete er ungewöhnlich gelassen, dennoch wirkte er wie ein Raubtier, das jeden Moment zum Sprung ansetzen und mich umbringen würde.
Ich atmete tief durch und verzog wegen des Gestanks das Gesicht.
»Ja, Junge, das bist du, der so unchristlich stinkt«, sagte Morosow unbeeindruckt. »Also, was sagst du?«
»Was ist mit Katia?«
»Jemand hat sich um sie gekümmert und sie ins Krankenhaus gebracht, da sie nicht tot ist«, antwortete er. »Den Kerl, sofern es einer war, hast du totgeschlagen, aber meine Leute lassen ihn verschwinden.«
Skeptisch betrachtete ich ihn. »Wie?«
»Der Kerl wird entsorgt. Entweder fliegt seine Leiche in die Müllverbrennungsanlage, wird mit Gewichten beschwert in den Fluss geworfen oder sie vergraben und kalken sie einfach«, erklärte er und hob eine Augenbraue. »Ich will jetzt deine Entscheidung hören.«
»Versicherst du mir, dass Katia überlebt?«, hakte ich nach.
»Bin ich Arzt?«, schnappte er und hustete im nächsten Moment so heftig, dass Speichel aus seinem Mund flog. Es war offensichtlich, dass der Kerl nicht der gesündeste Mann unter Gottes Sonne war. »Deine Entscheidung?«, forderte er einmal mehr.
»Ich bleibe«, erwiderte ich entschieden.
»Gut, ich zeige dir ein Zimmer, in dem du heute Nacht schlafen kannst, und bei Gott, geh duschen, du riechst wie ein Haufen Rattenscheiße.« Mit einem Kopfnicken in Richtung Tür bedeutete er mir, ihm zu folgen.
Ich war nicht sicher, ob ich die richtige Entscheidung getroffen hatte, allerdings hatte ich auch niemanden, zu dem ich gehen konnte. Vielleicht würde es hier gar nicht so übel werden. »Wann soll ich anfangen?«
»Morgen stelle ich dich dem Pakhan und seinen Söhnen vor, danach werden sie entscheiden, ob du ausgebildet wirst oder nicht.«
»Warum wolltest du dann meine Entscheidung?«
Morosow blieb stehen und drehte sich zu mir um. »Um sicherzugehen, dass du bleibst, bis der Pakhan seine Entscheidung getroffen hat.«
»Ah ja«, stieß ich voller Sarkasmus aus.
Sein Knurren war wenig beeindruckend, zumal er dann wieder anfing zu husten. Diesmal spritzte mir sein Speichel ins Gesicht, doch stoisch wie ich war, wischte ich ihn nicht weg. Er gesellte sich zu dem Blut dieses sukin syn, dieses Hundesohns, der mich angegriffen hatte.
* * *
Ich betrat eine Kammer, die mich an jene im Waisenhaus erinnerte. Nachdem ich dreizehn geworden war, hatte ich sozusagen ein eigenes Zimmer bekommen, das in etwa genauso groß wie dieses war. Ein Bett, ein Nachttisch und ein Kleiderschrank fanden ihren Platz darin – das war’s.
»Hier kannst du bis morgen bleiben. Das Bad ist am Ende des Flurs, du solltest duschen. Ich sorge dafür, dass du saubere Kleidung bekommst.«
Ich nickte knapp.
»Handtücher findest du im Bad.«
Ich wiederholte das Nicken – er ließ mich allein. Tief durchatmend rieb ich mit den Händen über mein Gesicht. Das Blut auf meiner Haut war getrocknet, dennoch haftete noch immer der Geruch dieser inzwischen toten Drecksau an meinen Fingern. Mein Weg führte mich ins Bad, ich wusch mich und war dankbar für das warme Wasser, das meinen Körper reinigte.
Ich machte mir Gedanken, sie kreisten um Katia und ich hoffte, dass sie überleben würde, ansonsten hätte diese Nacht nicht nur ein Opfer gefordert, sondern mir das Liebste genommen, das ich hatte.
Tränen stiegen in meine Augen, vermischten sich mit dem Wasser und ich brach zusammen.
* * *
Prolog
MILENA
Sieben Jahre zuvor
Sankt Petersburg
Achtzehn.
Endlich war ich volljährig.
Noch ein halbes Jahr und meine Ausbildung zur vollwertigen Nachtwächterin wäre abgeschlossen, dabei wusste ich, dass Stanislav Wolkow niemals zulassen würde, dass ich mich seinen nochnoy storozh anschließe. Er duldete keine Frauen in der Bratwa, aber mein Vater war der Ansicht, dass ich eine ausgezeichnete Leibwächterin abgeben würde – er war nicht einmal mein leiblicher Vater, sondern mein Onkel, der mich adoptiert hatte, nachdem sich meine Mutter mit einer Überdosis umgebracht hatte. Mit dieser »Anstellung« kämen auch die Regeln. Ich dürfte nicht heiraten, mich nicht verlieben und der Bruderschaft niemals den Rücken kehren. Am liebsten wäre ich aus diesem Käfig aus Verbrechen, Meucheln und Morden entkommen, jedoch war es unmöglich, der Bratwa zu entfliehen. Ich wollte Russland verlassen, um nicht mehr unter dem Pantoffel meines alten Herrn zu stehen, doch das würde er nicht zulassen. Er hütete mich wie seinen Augapfel. Weder durfte ich ausgehen noch Freunde treffen, sondern musste immerzu trainieren, wenn ich nicht gerade von Leibwächtern verfolgt in der Schule war. Einen seiner Schützlinge, den er vor zehn Jahren aufgenommen hatte, hätte ich im Alter von fünfzehn Jahren beinahe umgebracht, als wir mit den Sais trainierten. Aleksandr Romanow, dieser Mann war ein lebender Traum. Ich fand ihn unglaublich heiß, aber er war eine gefühlskalte Killermaschine. Ihm konnte man kaum eine Regung, geschweige denn ein Lächeln entlocken. Wenn er mich damals nach einer gut gelaufenen Trainingseinheit lobte, klang er desinteressiert; wies er mich an, wirkte er unfreundlich – er war ein richtiger Brummbär, der mich nach meiner gelungenen Attacke nicht mehr trainieren wollte. Er war der Meinung, dass er mir nichts mehr beibringen konnte.
»Milena, es geht gleich los, mach dich bitte fertig.«
Ich schaute zu Papa. »Wohin?«
»Du wolltest deinen achtzehnten Geburtstag feiern, ich habe alles in die Wege geleitet. Wir fahren gleich in die Stadt.«
Meine Gesichtszüge entgleisten. »Wirklich? Du hast eine Party organisiert?« Ich klang ungläubig, weil es mich wunderte, dass er eine Geburtstagsfeier für mich geplant hatte.
»Habe ich.«
»Und wen hast du eingeladen? Lass mich raten, die nochnoy storozh und die byki, die es zu einer unvergesslichen Nacht machen werden, weil sie Scheißlaune haben, nicht wahr?« Das war die Erinnerung an meinen siebzehnten Geburtstag, Papa hatte all seinen Männern befohlen, zu meiner Party zu kommen, und sie alle hatten extrem beschissene Laune mitgebracht.
»Und einige Leute aus deiner Schule, die Wolkows, Freunde von mir … Es werden nicht nur meine Männer anwesend sein.«
Ich nickte, während ich ihn überrascht musterte.
»Ich erwarte dein bestes Benehmen von dir, Milena, und nicht noch so ein Drama wie letztes Jahr.«
»Ja, Papa«, erwiderte ich seufzend und rutschte vom Bett. Was hätte ich denn letztes Jahr tun sollen? Die Kerle hatten meinen Geburtstag komplett versaut, obwohl ich mich sonst immer auf mein Älterwerden gefreut hatte. Dieses Jahr war diese Freude ausgeblieben, was meiner Meinung nach an dieser missglückten Fete lag. »Soll ich mich aufbrezeln oder darf ich doch ich selbst bleiben?«
»Mach dich schick, aber bleib du selbst«, antwortete er und schickte sich an, mein Zimmer zu verlassen. »Spiridon, Aleksandr und Kolja fahren gleich, also bitte, beeil dich, sonst müssen wir ohne ihren Schutz los.«
»Ich gebe mir Mühe«, versprach ich ihm, anschließend eilte ich ins Bad. Ich hatte keine Ahnung, was ich anziehen oder mit meinen Haaren anstellen sollte.
* * *
Eine Stunde später saßen wir in Papas Auto. »Ich sagte dir, dass du dich beeilen sollst, weil die Männer sich zügig auf den Weg machen wollen, aber nein, du lässt dir fast eine Stunde Zeit1«, wetterte er.
Ich schnaubte. »Du hättest mir früher sagen müssen, dass es zu einer Party geht, die du mir zu Ehren schmeißt, dann wäre ich längst fertig gewesen«, hielt ich dagegen.
»Es geht darum, dass du dir nicht immer ewig Zeit lassen sollst, Milena!«, schnauzte er mich an.
Genervt verdrehte ich die Augen. »Ja, Papa.«
»Du sollst nicht immer die Augen verdrehen!«, herrschte er mich an.
»Und es geht los«, nuschelte ich, denn so begannen unsere Dispute jedes Mal.
»Deinetwegen sind wir nun schutzlos unterwegs.«
»Ich dachte, es herrscht Waffenstillstand mit den Italienern und den Tschechen«, sagte ich angefressen.
»Mag sein, dennoch haben die Vascemis und Janko Novák nicht immer all ihre Leute unter Kontrolle«, knurrte er und ich sah die Ader an seiner Stirn pochen.
»Als ob uns irgendjemand abfangen würde«, hielt ich dagegen. »Papa, du sagtest selbst, dass wir derzeit sicher sind, weil Wolkow und der knyaz‘ Waffenstillstände ausgehandelt haben, also hör auf, dich so mädchenhaft anzustellen.«
Ein Knurren rollte seine Kehle hinauf. »Pass auf, wie du mit mir sprichst, Milena.«
»Hm«, brummte ich und schaute aus dem Seitenfenster. Ich verengte die Augen, als Papa an einer Ampel hielt.
Er polterte immer noch, doch ich blendete ihn aus.
Am Fußgängerüberweg fielen mir ein paar Gestalten auf, weshalb ich die Augen verengte, um sie erkennen zu können. »Papa, wer ist das?«, wollte ich wissen, aber er ignorierte meine Frage.
»Jetzt wechsle nicht das Thema, Milena, ich habe die Schnauze voll von deinen Allüren und der Tatsache, dass du nichts ernst nimmst.«
»Ich nehme meine Ausbildung ernst«, nahm ich den Streit wieder auf. »Ich trainiere härter als jeder männliche Rekrut; ich stecke mehr ein, als jeder einzelne von ihnen; ich habe schon mehrere deiner fähigsten Männer für Wochen aus dem Verkehr gezogen! Also, unterstell mir bitte nicht, dass ich meine Ausbildung oder Ähnliches nicht ernst nehme, denn ich habe ja nur diesen Scheiß und die Schule!«, schrie ich ihn an.
Papa wollte gerade etwas sagen, als die Fahrertür geöffnet wurde. »Was wollt ihr?«, stieß er aus, im nächsten Moment wurde ihm etwas über den Schädel gezogen und er schlug bewusstlos mit dem Kopf aufs Lenkrad.
Die Hupe ertönte.
»Papa!«, schrie ich. »Papa, Papa, bitte wach auf!«, verlangte ich besorgt und unterdrückte die Tränen meiner Sorge. Immer wieder wurde auf ihn eingeschlagen, bevor er aus dem Auto gezogen wurde. Nein, hört auf, ihn zu schlagen!« Angst hatte ich nicht, auch nicht, als meine Tür geöffnet und mir eine Waffe an die Stirn gedrückt wurde. Man hatte mir jahrelang eingetrichtert, niemals Angst zu empfinden oder sie zu zeigen.
Niemals!
»Aussteigen, Schlampe!«, verlangte der Kerl – er hatte einen Akzent, aber ich konnte nicht heraushören, welcher es war, weil ich immer noch wegen Papa aufgebracht war.
Langsam griff ich zur Seite und löste den Gurt, danach stieg ich aus. Er wollte mich gerade packen, als ich ausholte und ihm meinen Handballen von unten gegen die Nase rammte.
Er ließ von mir ab.
»Sukin syn!«, herrschte ich ihn an, schaute mich um und sah weitere Männer auf mich zukommen, während das Weichei vor mir seine Nase hielt. Ich rannte los, doch sie folgten mir.
Schüsse fielen, Kugeln flogen mit grellen Pfiffen an mir vorbei, doch sie trafen mich nicht. Im Rennen tastete ich nach meinem Handy und fluchte lautstark, weil es in meiner Handtasche war – und das miese Scheißding war im Wagen.
Blyad!
Fuck!
Ich war trainiert, aber die hohen Stiefel waren nicht zum schnellen Laufen geeignet.
Warum hatten diese Männer es überhaupt auf mich abgesehen?
»Gott!«, schrie ich auf, als ich plötzlich gepackt und zu Boden gerissen wurde.
»Habe ich dich, du verdammte Hure!«, brüllte mich der Kerl an, dem ich eine verpasst hatte. Er war ein Hüne und trotz meines harten Trainings gelang es mir nicht, ihn abzuschütteln.
»Lass mich los!«, verlangte ich aufgebracht, doch er schlug mir mit dem Handstück seiner Knarre ins Gesicht.
Meine Welt wurde schwarz.
* * *
»Na endlich«, hörte ich eine Frau sagen, als ich zu mir kam.
»W-wo bin ich?«, wollte ich wissen. Obwohl ich die Augen aufschlug, sah ich nichts. Diese Leute hatten mir die Augen verbunden und ich war gefesselt.
»Wir haben dich nach Amerika gebracht, du kleine Russenfotze«, antwortete ein Mann ziemlich nasal – vermutlich war’s mein Kumpel namens Nasenbeinbruch, den er mir zu verdanken hatte. Sie sprachen Englisch, vollkommen akzentfreies Englisch. Ich kannte ihre Stimmen nicht, wusste deshalb auch nicht, wer mich festhielt. Langsam bohrte die Angst ihre eiskalten Klauen in meinen Körper, dennoch würde ich sie ihnen niemals zeigen. Die Angst war ein Feind, den ich zu unterdrücken gelernt hatte. Ich war stärker und würde nicht zusammenbrechen.
»Morosowa«, stieß ich aus. »Ich bin Milena Morosowa und ihr schafft es nicht, mich umzu…«, meine Worte gingen in einem Schrei unter, als man mir hart ins Gesicht schlug. Ich hatte das Gefühl, dass man mir den Kopf vom Rumpf trennen wollte, so fest war der Schlag. »Dafür wird er euch alle umbringen, ihr Schweine«, herrschte ich sie an.
»Ich weiß, wer du bist, du Dreckstück, und es interessiert mich nicht, ob dein Vater Rache üben wird oder nicht, denn er hat keine Ahnung, wer dich in seiner Gewalt hat!«, herrschte er mich an. »Und ich weiß, was dir bald blüht.« Etwas raschelte. »Mund auf.«
Ich schüttelte den Kopf. »Wolkow wird das nicht dulden!«
»Interessiert mich nicht! Jetzt mach den Mund auf!«
»Nein!«
Er packte mein Gesicht und drückte seine Fingerspitzen in meine Wangen, sodass meine Lippen ein unfreiwilliges O bildeten.
»Macht mit ihr, was wir besprochen haben, danach bringt sie um und schickt Morosow Fotos ihrer Leiche«, befahl die Frau und ich wusste, dass dies nun mein Ende sein würde.
Sie hatte mein Todesurteil ausgesprochen.
* * *
Samantha
Mit meinen beiden besten Freundinnen, Amy und Sarah, saß ich in meinem Auto. Ich fuhr ein altes Mustang Cabrio, das ich mir von meinem hart erarbeiteten Geld gekauft hatte. Die Musik war laut, unsere Laune großartig, allerdings wurde meine von den zahlreichen roten Ampeln auf unserem Weg gedämpft.
»Oh, der Song ist super, mach lauter!«, rief Amy, die auf dem Beifahrersitz saß, und spielte sofort am Radio herum.
Ich verzog das Gesicht, weil sie den Regler beinahe bis zum Anschlag aufdrehte.
»Lass sie, Sam, es ist doch nur ein Song«, sagte Sarah lachend. Sie saß auf der Rückbank, aber so wie ich die beiden kannte, würden sie gleich auf den Rückenlehnen sitzen und tanzen. Glücklicherweise fuhr ich vernünftig, sonst hätte ich die beiden schon mehr als einmal auf dem Gewissen gehabt.
»Gott, das gibt’s nicht«, stieß ich genervt aus, als die Ampel vor mir schon wieder rot wurde. Ich trat auf die Bremse und ließ mich ebenfalls ein wenig von David Banner mitreißen.
»Girl let's ride, come on let's ride. I feel the need to sleep ya, to sleep. Me and you should be dancing in the sheets«, sangen die beiden gut gelaunt mit, als ich mich umsah, und wie ich vermutet hatte, setzten sie sich auf die Rückenlehnen.
Links neben uns stand ein schwarzer Mercedes, dessen hinteres Beifahrerfenster hinuntergelassen wurde. Eine Frau mit rotblonden Haaren sah lächelnd zu uns.
Dann fuhr das vordere Fenster hinunter und zwei finster dreinblickende Männer hatten ebenfalls ihr Augenmerk auf uns gerichtet. Der am Steuer schien, sich ein Grinsen zu verkneifen.
»Es ist grün!«, rief Sarah euphorisch.
»Na endlich«, stieß ich aus, lächelte die beiden Männer an und trat aufs Gaspedal. Mit röhrendem Motor rauschte mein Mustang los.
Meine Freundinnen rissen die Arme hoch und stießen ein langes »Woohoo« aus, was mir höllisch peinlich war.
»Das ist doch wohl nicht wahr!«, verzweifelte ich, als wenig später die nächste Ampel auf Rot sprang.
Wieder fuhr der schwarze Mercedes auf die Spur neben uns. Ein weiteres Mal spürte ich die Blicke der Männer auf mir, die dort drin saßen.
Ich legte meinen Kopf aufs Lenkrad. »Wenn ich heute an noch einer einzigen roten Ampel halten muss, fange ich an zu schreien.«
»Reg dich ab!«, erwiderte Amy so laut, dass ich mich wieder aufrichtete.
»Und das Radio geht mir auch auf den Keks«, brummte ich und machte das Lied leiser. Es würde sowieso jeden Moment enden.
»Och, Sam, warum bist du so eine Spielverderberin?«, fragte Amy missmutig.
»Ich glaube, das liegt an den beiden Kerlen auf neun Uhr«, mischte Sarah sich lachend ein.
Amy ließ sich auf die Sitzfläche fallen und schaute mehr als offensichtlich zu den beiden. »Hey, ihr Süßen!«
»Um Gottes willen.« Ich schob meine linke Hand seitlich an mein Gesicht, damit sie es sich bloß nicht merkten.
»Was ist?«, fragte einer von ihnen – er hatte einen starken Akzent, der mir durch Mark und Bein ging.
»Habt ihr Lust, mit uns an den Strand zu fahren? Dann werdet ihr auch diese Geschäftsgalgen um eure Hälse los«, meinte sie.
»Bitte werde grün«, flehte ich die Ampel an.
»Sorry, wir müssen arbeiten.« Eine andere Stimme.
Ich atmete tief durch, legte meine Hände ans Lenkrad und starrte weiterhin das rote Lichtsignal an. »Endlich!«, rief ich aus.
»Kommt schon, ihr könnt doch schwänzen!«, schlug Amy ihnen vor.
»Nein, das ist nicht drin«, erwiderte der Beifahrer aus dem Mercedes.
Der Fahrer sagte irgendwas in einer fremden Sprache. Ich glaubte, Russisch zu erkennen, woraufhin die beiden anfingen, zu diskutieren. Jedenfalls ging ich davon aus, weil sich die Worte so hart anhörten.
»Schönen Tag noch!«, wandte ich mich an die beiden und fuhr weiter.
* * *
Nach acht weiteren roten Ampeln und am Rande eines Nervenzusammenbruchs erreichten wir den Strand. Meine Freundinnen schnappten sich ihre Taschen und liefen schon los, während ich das Verdeck meines Wagens schloss. Ich war lieber vorsichtig, statt zu riskieren, dass jemand das alte Mädchen klaute. Danach nahm ich meinen Shopper vom Rücksitz und folgte den beiden.
Amy und Sarah hatten ihre Handtücher bereits ausgebreitet und ihre Kleidung abgelegt. Beide trugen unheimlich knappe Bikinis, die ich niemals tragen würde. Ich blieb bei meinem sportlichen Badeanzug, der bis zum Hals geschlossen war, so musste ich ihnen nicht mein Dekolleté zeigen, auf dem sich vier große kreisrunde Narben befanden. Vor ein paar Jahren war ich angeschossen worden. Bis heute wusste ich nicht, was mir eigentlich passiert war, sondern kannte nur den Bericht der Ärzte aus dem Krankenhaus.
Kopfschüttelnd vertrieb ich die Gedanken an diesen Vorfall. Ich wollte nie wieder daran denken und war froh, keine Erinnerungen daran zu haben, denn wer wollte so etwas noch wissen? Ich wusste, ich musste vorsichtig sein und dass Amy diese Männer so kopflos um deren Gesellschaft gebeten hatte, fand ich gefährlich. Wenn man erlebt hatte, was mir widerfahren war, wollte man sich nicht mehr auf Fremde einlassen. Mir war es sogar schwergefallen, mich mit Amy und Sarah anzufreunden, obwohl die beiden höchstens meinem Gehör schadeten, wenn sie sangen.
Seufzend setzte ich mich auf mein Handtuch, griff zur Sonnencreme und fing an, meine Beine einzucremen.
»Warum bist du heute so mies drauf?«, fragte Amy, die verdammt gut gelaunt war.
Ich sah zu ihr. »Ich bin nicht mies drauf«, entgegnete ich defensiv. »Ich bin bloß ein wenig genervt von dieser roten Welle von Ampeln.«
»Was soll’s? Wir sind angekommen, jetzt können wir Spaß haben«, sang sie und holte eine Flasche Prosecco aus ihrer Tasche. »Feiern wir?«
Irritiert hob ich die Augenbrauen. »Was sollen wir feiern?«
»Ich habe den Job bei Wolfram Inc. bekommen.«
»Wahnsinn!«, rief ich aus und fiel ihr um den Hals, da sie neben mir saß. »Ich freue mich für dich. Glückwunsch.«
Sie grinste, als Sarah sie ebenfalls an sich drückte. »Danke, aber jetzt lasst uns feiern.« Sie förderte drei Sektgläser aus Plastik zutage und öffnete die Flasche.
»Oh, für mich nicht, ich muss noch fahren und so wie die Sonne knallt, bin ich nach einem Glas betrunken«, entschuldigte ich mich. Ich holte eine Flasche Cola aus meinem Shopper. »Ich stoße mit Coke an.«
Sarah und Amy hoben ihre Sektgläser, ich die Cola. »Auf Amy und darauf, dass sie Wolfram Inc. ordentlich aufmischen wird«, sagte ich lachend.
Sarah wiederholte meinen Toast, was unsere Freundin erröten ließ. Wir stießen miteinander an, dann tranken wir.
»Ich habe Lust, schwimmen zu gehen«, meinte Amy.
Mit großen Augen sah ich sie an. »Du hast Alkohol getrunken.«
»Nur einen Schluck.«
»Du begibst dich nur unnötig in Gefahr, wenn du jetzt ins Wasser gehst«, hielt ich besorgt dagegen.
Meine beste Freundin schnitt mir eine Grimasse. »Sei keine Spielverderberin. Wenn ich absaufe, wird mich bestimmt einer der Rettungsschwimmer retten.«
»Du weißt aber, dass der Typ nicht wie Zac Efron aussieht, oder?«, hakte Sarah amüsiert nach.
»Ist mir klar, weil er viel heißer ist«, hielt Amy dagegen, stand auf und lief mit schwingenden Hüften aufs Meer zu.
Ich seufzte und sah Sarah an.
»Was ist?«, wollte sie wissen.
»Nichts. Ich frage mich nur, warum sie sich heute so komisch benimmt.«
Sarah neigte den Kopf. »Sie freut sich einfach über den Job bei Wolfram Inc. und ist deshalb euphorisch.«
»Den sie aber nicht antreten wird, wenn sie ertrinkt«, rief ich ihr ins Gedächtnis und legte die Sonnencreme weg.
»Geh doch einfach mit ihr ins Wasser.«
Ein weiteres Seufzen, diesmal ein resigniertes, entstieg meiner Kehle. »Du weißt, dass ich nicht schwimmen kann, und ich will definitiv nicht ertrinken.«
»Stimmt.« Sie erhob sich. »Dann gehe ich eben mit ihr ins Wasser. Ich habe zwar auch einen Schluck Prosecco getrunken, aber der wird mich nicht umbringen.«
»Na gut.«
Sarah ließ mich allein und ich ließ mich nach hinten fallen. Ich setzte meine Sonnenbrille auf, schloss die Augen und ließ mich von der Sonne braten.
* * *
Amy und Sarah hatten zwei Kerle angeschleppt, nachdem sie aus dem Wasser gekommen waren. Sie unterhielten sich mit den Männern und flirteten, was das Zeug hielt, weshalb ich mich auf dem Bauch liegend in ein E-Book vertiefte.
Lesen war eine der wenigen Möglichkeiten, der Realität zu entfliehen. Und so konnte ich die vier schnatternden Personen um mich herum ausblenden.
Ich verlor mich in der Geschichte, konzentrierte mich vollkommen darauf.
Nach einer Weile legte sich eine kalte Hand auf meinen Rücken. Ich zuckte zusammen und schaute hoch.
»Sarah und ich gehen mit den Jungs was trinken. Kommst du mit?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, ich werde nach Hause fahren. Ich muss morgen früh raus.«
»Frühschicht?«
»Leider ja«, seufzte ich, denn die Frühschicht bedeutete für mich, um drei Uhr morgens aufzustehen und um vier das Haus zu verlassen, damit ich um fünf auf der Arbeit war. Ich verdiente mein Geld als Mitarbeiterin eines Coffeeshops, der vierundzwanzig Stunden geöffnet hatte. Barista war zwar nie mein Traumjob gewesen, aber da ich nicht auf dem College war, hatte ich nur wenige Optionen. Vielleicht schaffte ich es ja noch von der Kaffeetante zur Millionärin. Von irgendwas musste ich ja träumen und dieser Traum erschien mir so sonderbar, dass er wohl auf ewig einer bleiben würde.
»Okay, dann hauen wir ab.« Amy zwinkerte mir zu, danach verschwanden die vier.
Seufzend packte ich meinen Kram zusammen, um mich fünf Minuten später auf den Heimweg zu machen. Ich musste sowieso noch ein wenig einkaufen, also konnte ich das nun auf einem Weg erledigen.
* * *
Der Abend verlief unspektakulär und die Nacht war viel zu kurz. Nun stand ich im Café und säuberte eine der Kaffeemaschinen. Wegen meines unnützen Kollegen, der die Nachtschicht hatte, war die Auffangschale für das Kaffeepulver voll, der Milchtank voller Flecken und der Boden klebte. Vermutlich hatte er mit dem Sirup gekleckert und es nicht aufgewischt.
Hinter mir räusperte sich jemand. Normalerweise ging der Betrieb erst gegen halb sieben los. Vorher sah ich höchstens mal vereinzelte Clubbesucher, die sich hier einen Kaffee holten, um den Heimweg zu überstehen, aber sonst niemanden.
»Guten Morgen«, sagte ich freundlich.
Der Mann musterte mich kurz. »Zwei Kaffee bitte.«
»Klein, mittel, groß?«, fragte ich interessiert.
»Groß, schwarz, ohne irgendwelchen Schnickschnack.«
»Zum Mitnehmen oder trinken Sie den Kaffee hier?«
Er schaute hinter sich und ich sah, dass sich ein anderer am Fenster niedergelassen hatte. »Wir trinken den Kaffee hier.«
»Geht klar.« Ich drehte mich weg und stellte die Tassen in die Maschine, danach befahl ich ihr, zwei große Kaffee zuzubereiten.
»Bringen Sie die Tassen an den Tisch oder soll ich warten?«
»Da gerade noch nicht viel los ist, bringe ich Ihnen die Tassen gleich.«
»Und was macht das?«
Ich nannte ihm den Betrag, er drückte mir einen Zehner in die Hand. »Stimmt so«, sagte er, aber Freundlichkeit suchte ich vergebens in seinen Zügen.
»Danke sehr.« Ich steckte das Restgeld in mein Trinkgeldglas und drehte mich weg.
Seine Schritte entfernten sich.
Nachdem der Kaffee der Männer fertig war, stellte ich die Tassen auf ein Tablett und brachte sie an den Tisch.
»Danke«, sagte der andere.
»Gern.« Ich nahm das Rundtablett an mich und wollte mich wegdrehen, als er mein Handgelenk umfasste. Ich verspannte. »Darf’s noch etwas sein?« Meine Stimme verriet meine Unsicherheit.
»Haben Sie Muffins?«
»Ja.«
Er gab mich frei, erhob sich und ging mit mir an den Tresen.
»Welchen hätten Sie gern?«
»Chernika«, antwortete er.
Verwirrt sah ich ihn an. »Wie bitte?«
»Verzeihung, Blaubeere bitte.«
»Okay.« Ich öffnete die Auslage, holte einen der Muffins heraus und stellte ihn mithilfe der Gebäckzange auf einen Teller, den ich ihm reichte.
»Was macht das?«
»Drei Dollar bitte.«
Er reichte mir einen Fünfer. »Stimmt so.«
»Danke«, sagte ich freundlich.
Er wandte sich ab und lief an seinen Tisch. Irgendwie kamen mir die beiden bekannt vor, aber ich wusste nicht woher. Der Akzent des anderen hatte mich an einen der Männer von gestern erinnert. Jene, die in dem schwarzen Mercedes saßen und von Amy eingeladen wurden, uns an den Strand zu begleiten. Ich schüttelte den Kopf, es war unwichtig.
Ohne weiter darüber nachzudenken, kümmerte ich mich ums Saubermachen. Ich hasste es, nach Henry zu arbeiten, weil er mir immer einen Saustall hinterließ.
»Gehen Sie in Deckung!«
Ich drehte mich irritiert um und in dem Moment zersplitterte das Fenster, vor mir barst das Trinkgeldglas. Der blonde Kerl, der den Muffin gekauft hatte, stürmte auf mich zu, warf sich über den Tresen und riss mich zu Boden.
»Was ist denn los?«, fragte ich verwirrt.
Es knallte, Leute schrien und über mir zerbarst die Auslage.
»Hab keine Angst und bleib unten«, antwortete er leise und beugte sich über mich, als würde er mich beschützen wollen.
Mein Körper zitterte und ich hatte keine Ahnung, was passierte, aber ich hatte das Gefühl, diese Frühschicht nicht zu überleben. Vor meinem inneren Auge flammten Bilder auf. Sie zeigten einen Mann mit dunklem Haar und blauen Augen, der grinsend eine Waffe auf mich richtete. Ich hörte wieder seine Worte, verstand sie aber nicht.
Abrupt endete dieser Flashback.
Der Blonde half mir auf. »Alles in Ordnung?«
Ich starrte ihn mit großen Augen an. »W-was?«
»Ich fragte, ob alles in Ordnung ist«, wiederholte er geduldig, während er mich finster betrachtete.
»Ha«, stieß ich aus, mir wurde schwindelig, dann kippte ich nach vorn.
* * *
Aleksandr
Blyad!
Diese miesen tschechischen Wichser konnten uns nicht einmal in Ruhe einen Kaffee trinken lassen. Bei diesem Attentat waren glücklicherweise weder Anatolij noch ich verletzt worden. Aber die Barista hatte es aus den Schuhen gehauen.
»Alles in Ordnung?«, fragte Anatolij auf Russisch.
Ich schüttelte den Kopf, während ich die Kleine betrachtete. »Glaube nicht.«
Er kam näher. »Was ist passiert?«
»Sie ist ohnmächtig.«
»Ist sie verletzt?«, wollte er wissen.
Vorsichtig legte ich sie auf den Boden und untersuchte sie auf Verletzungen. »Sieht nicht so aus.«
»Gut, dann sollten wir abhauen, damit wir nicht gesehen werden.«
»Sehe ich auch so«, erwiderte ich, musterte die Kleine noch einmal, die mich gestern so frech angegrinst hatte, und prägte mir ihr Gesicht ein. Samantha stand auf ihrem Namensschild.
»Aleksandr«, sagte Anatolij ungeduldig.
Ich ging um den Tresen herum und verließ gemeinsam mit ihm den Coffeeshop. Wir konnten diesen Laden nicht mehr besuchen, was mich ärgerte, denn kaum einer brachte es fertig, vernünftigen Kaffee anzubieten. Die Kleine hatte ich hier allerdings noch nie gesehen. Blyad, mich ließ der ängstliche Blick ihrer smaragdgrünen Augen nicht los.
Als wir im Auto saßen, rief Anatolij mit einem der Wegwerfhandys die Polizei, um sie zum Coffeeshop zu lotsen. Dann würde man Samantha helfen und wir waren aus der Schussbahn. Normalerweise taten wir nicht einmal das, aber in Anbetracht der Tatsache, dass sie allein und kaum jemand in dieser Gegend unterwegs war, hielten wir es für besser.
Ich sah noch einmal zum Coffeeshop, danach startete ich den Motor und wir machten uns aus dem Staub. Es war das zweite Mal in meinem Leben, das ich eine wehrlose Frau ihrem Schicksal überlassen musste, womit ich nur schwer umgehen konnte.
»Du bist unruhig«, stellte Anatolij fest, als ich den Wagen auf Wolkows Grundstück geparkt hatte.
»Bin ich nicht«, erwiderte ich entschieden, stieg aus und ging auf das herrschaftliche Haus zu.
»Der Frau wird geholfen.«
»Ich weiß.«
»Und sie wird sich sicher so sehr erschreckt haben, dass sie sich nicht einmal unsere Gesichter eingeprägt hat«, fuhr er fort.
Ich schnaubte. »Das bezweifle ich.«
»Warum?«
»Weil sie mich angestarrt hat«, antwortete ich aufrichtig.
»Du glaubst, sie hat sich gemerkt, wie du aussiehst?«, hakte Anatolij nach.
»Davon gehe ich aus.« Zielstrebig lief ich auf das Büro des Pakhans zu.
»Er wird schlafen«, sagte Anatolij. »Du solltest später mit ihm sprechen.«
»Das duldet keinen Aufschub. Das weißt du so gut wie ich.«
»Dann sollten wir ihn wecken.« Anatolij begab sich zur Treppe und nach oben.
Ich lehnte mich neben dem Büro an die Wand, während ich darauf wartete, dass er mit dem Pakhan zurückkam. In Russland gab es derartige Probleme nicht, aber wir hatten noch nicht herausgefunden, von wo aus die Tschechen operierten. Immer wieder hatten wir diese Schweine verfolgt, aber nie den Kopf der tschechischen Mafia gefunden. Es machte mich wahnsinnig, dass der miese kleine Wichser nicht zu finden war.
»Anatolij sagte, dass ihr angegriffen wurdet«, machte Wolkow mich auf sich aufmerksam, als er die Treppe nach unten kam.
Ich nickte. »Während wir in einem Coffeeshop saßen, um einen Kaffee zu trinken.«
»Irgendwelche Zeugen?«, wollte er wissen.
»Die Barista, allerdings wurde sie ohnmächtig«, mischte Anatolij sich ein. »Wir ließen sie dort, riefen die Polizei und entsorgten das Telefon.«
»War es registriert?«
»Nein, Sir«, antwortete ich. »Es war eines der Prepaidhandys, die SIM-Karten werden nach einmaligem Gebrauch entsorgt.«
Er schnaubte, öffnete sein Büro und ging an den Schreibtisch. Der Mann trug Sporthosen und Shirt, statt seines üblichen Anzugs. Und er sah verschlafen aus, was bei drei kleinen Kindern kein Wunder war. »Mir reicht’s. Sorgt dafür, dass diese Frau schweigt, damit keine Phantombilder in Umlauf gebracht werden, und dann haltet ihr euch zurück. Wenn man die Augen nach euch offenhält, werde ich wieder die Polizei bestechen müssen.«
»Ja, Sir«, erwiderten wir im Chor. Super, Hausarrest, meldeten sich meine Gedanken sarkastisch zu Wort. »Sir?«.
Er sah mich interessiert an. »Ja, Aleksandr?«
»Wenn wir uns draußen nicht blicken lassen sollen, wie sollen wir dann diese Frau aufsuchen?«
»Ihr wisst, wie ihr euch im Hintergrund haltet.« Er räusperte sich. »Habt ihr einen Namen?«
»Nur den Vornamen«, entgegnete ich.
»Dann ruft morgen in den Krankenhäusern an. Wenn sie bewusstlos war, wird sie sicher zur Beobachtung bleiben müssen.«
Ich nickte. »Ja, Sir.«
»Geht schlafen, es ist spät geworden. Wir unterhalten uns später.«
Wir verabschiedeten uns in die Nacht und während Anatolij zu seiner Frau in der ersten Etage verschwand, begab ich mich in mein Zimmer unterm Dach. Es war nicht besonders groß, aber ich hatte es mir einigermaßen wohnlich eingerichtet. Zumindest ein großes Bett, ein Kleiderschank und ein Fernseher standen dort. Ich hätte mir auch problemlos ein Haus in der Gegend kaufen können, jedoch gehörte ich zum bequemen Typ Mensch, der keine Lust hatte, einen Weg zur Arbeit auf sich zu nehmen.
Ich kickte die Tür hinter mir zu, befreite mich von meinem Anzug und ließ mich in Briefs auf das große Bett fallen. Dann schloss ich die Augen und ließ die letzte Nacht Revue passieren.
Ihre Augen wollten mir nicht aus dem Kopf gehen. Immer wieder sah ich vor mir, wie sie mich aus den smaragdgrünen Iriden angestarrt hatte.
* * *
Im Southern California Hospital hatte ich Erfolg. Am frühen Morgen war dort eine Samantha Wheeler eingeliefert worden, auf die meine Beschreibung gepasst hatte. Ich hoffte nur, dass die Cops noch nicht bei ihr gewesen waren, um sie wegen des Vorfalls zu befragen. Zwar war ich mir sicher, dass sie nicht allzu viel mitbekommen hatte, aber sie hatte Anatolij und mich gesehen. Wir waren die einzigen Gäste und sie hatte uns beide länger als nur eine Minute im Auge.
»Hattest du Erfolg?«, fragte Anatolij, als er in den Aufenthaltsraum kam.
Ich nickte knapp. »Sie ist im Southern California Hospital in Hollywood.«
Er hob die Augenbraue, die durch eine Narbe geteilt war. »Nicht gerade um die Ecke.«
»Ich weiß.« Ich räusperte mich. »Ich kümmere mich darum. Was hast du heute vor?«
»Wir sollten uns gemeinsam um die Frau kümmern.« Anatolij verengte die Augen ein wenig. Er wirkte müde, was mit einer schwangeren Frau im Haus bestimmt nicht unüblich war. »Wie ist ihr Name?«
»Samantha Wheeler«, erwiderte ich. »Sie wurde heute früh eingeliefert, nachdem sie einen Schwächeanfall hatte.«
»Mit wem hast du gesprochen, um an diese Information zu kommen?«, wollte er wissen.
»Ich habe der Krankenschwester erzählt, dass ich der Verlobte der Dame bin und in den Nachrichten von dem Vorfall gehört hätte, aber sie nicht erreichen kann und mir Sorgen mache«, erklärte ich. »Die übliche Vorgehensweise.«
»Und dein Name war?«
»Charles Baxter«, antwortete ich schulterzuckend. Mein Vorteil war, dass ich akzentfreies Englisch sprach, weil ich nach der Ausbildung zum Nachtwächter in die USA versetzt worden war. Ich hatte mich hochgearbeitet und nachdem sich mein Vorgänger wegen des Verschwindens seiner Tochter zurückgezogen hatte, war ich der Chef der nochnoy storozh geworden. Ich hatte mich gegen einige andere Männer durchsetzen müssen, aber schließlich triumphiert.
Anatolij lachte auf. »Bin gespannt, ob man dir glaubt, wenn du dort auftauchst.«
»Du wirst mich begleiten.«
Er nickte, amüsierte sich aber immer noch über das Pseudonym, das ich der Krankenschwester genannt hatte. Ich hatte keine Ahnung, ob Samantha uns wiedererkennen würde. Besser wäre es natürlich, wenn es nicht der Fall wäre. »Ich gehe mich von meiner Frau verabschieden.«
Daraufhin hob ich eine Augenbraue. »Du weißt, dass du im Dienst bist.«
Anatolij verdrehte die Augen. »Na schön, dann lass uns fahren.«
»Wunderbar, geht doch.« Ich erhob mich, steckte Handy und Munition ein, danach folgte ich ihm zum Mercedes. Ich ließ mich hinterm Steuer nieder, Anatolij saß auf dem Beifahrersitz und sah mit finsterem Blick nach draußen. »Was sagst du ihr, wer du bist?«
»Das mache ich davon abhängig, ob sie uns erkennt oder nicht.« Ich startete den Motor und fuhr vom Grundstück.
* * *
Mitten in Hollywood parkte ich den Wagen und machte mich gemeinsam mit Anatolij auf den Weg in das Krankenhaus, in das Samantha Wheeler am Morgen eingeliefert worden war. Am Empfang informierten wir uns, auf welcher Station sie lag, dort würden wir erfahren, welches Zimmer ihres war.
Wir betraten den Aufzug, der uns nach oben bringen sollte, und Anatolij warf einem jungen Mann einen drohenden Blick zu, als dieser ebenfalls die Kabine betreten wollte.
»Alles klar, ich nehme den nächsten«, nuschelte der Kerl und trat nach hinten.
»Keine Lust auf Gesellschaft?«, erkundigte ich mich.
»Keinen Nerv auf Fremde«, antwortete er und tastete nach seiner Waffe.
»Ich denke nicht, dass wir sie brauchen werden«, merkte ich an, tat es ihm aber gleich, um sicherzugehen, dass ich die Glock wirklich eingesteckt hatte. Wir alle hatten unsere Pistolen, manche wie Anatolij bevorzugten eine Smith and Wesson, andere wiederum Berettas und ich schoss am liebsten mit meiner Glock. Damit hatte ich das Schießen gelernt und es mit den Jahren perfektioniert.
Die Aufzugtüren öffneten sich und wir verließen die Kabine schnellen Schrittes. Unser Weg führte uns zur Anmeldung, hinter der eine Krankenschwester telefonierte.
»Guten Tag, kann ich Ihnen helfen?«, fragte sie freundlich, nachdem sie den Hörer aufgelegt hatte.
»Hi, mein Name ist Charles Baxter, ich habe vorhin wegen meiner Verlobten Samantha Wheeler angerufen. Können Sie mir verraten, auf welchem Zimmer sie ist?«
»Samantha Wheeler sagten Sie?«
Ich nickte zustimmend.
»Einen Moment.« Sie drehte sich zu dem PC und hackte auf die Tastatur ein. »Miss Wheeler liegt auf Zimmer neun, Mr. Baxter. Rechts den Gang runter, am Ende des Flurs auf der linken Seite.«
»Danke.« Ich schenkte ihr ein charmantes Lächeln, zwinkerte ihr zu und wandte mich mit Anatolij ab.
»Bin mal gespannt, ob wir ihre ersten Besucher sind«, sagte Anatolij leise, als wir einigen Patienten auswichen.
Ich hasste Krankenhäuser, weshalb ich froh war, noch nie in einem gelegen zu haben. Und wenn man sich doch eine Kugel einfing, machte Doktor Zolygin einen Hausbesuch, bei dem er einen behandelte. Selbst schwerere Operationen führte er im Haus des Pakhans durch.
Wir betraten das Krankenzimmer, ohne zu klopfen.
Miss Wheeler sah uns mit großen Augen an, sagte aber nichts.
»Guten Tag«, grüßte ich sie, während Anatolij schwieg.
»Ha-hallo«, stieß sie aus und blickte zur Tür.
»Erinnern Sie sich an uns?«
Ein knappes Nicken war ihre einzige Antwort.
Ich schaute kurz zu Anatolij, der eine Augenbraue hob, danach konzentrierte ich mich wieder auf Samantha. »Miss Wheeler, war die Polizei bereits bei Ihnen?«
»Ja, warum?«
»Haben Sie unseren Besuch im Coffeeshop erwähnt?«
Sie schluckte. »Ja.«
»Was sagten Sie den Cops?«
Samantha holte tief Luft. »Nur, dass Sie sich schützend über mich gebeugt haben, mehr nicht.«
»Wurden Sie gebeten, uns beide zu beschreiben?«
Hektisch schüttelte sie ihren Kopf. »Nein.«
»Haben Sie uns trotzdem beschrieben?«
»Nein«, wiederholte sie. »Ich weiß auch gar nicht, warum ich …«
Ich hob die Hand, um sie zum Schweigen zu bringen, was sofort geschah. »Ich möchte Sie bitten, mit niemandem über uns zu sprechen. Verstehen wir uns?«
»Sonst passiert was?«, hakte sie nach.
»Sonst werden wir Sie wieder besuchen, Miss Wheeler«, mischte Anatolij sich ein.
»Und wir bezweifeln, dass Sie das möchten«, fuhr ich fort.
Ihre Augenbraue glitt in die Höhe. »Drohen Sie mir gerade?«
»Nein, wir warnen Sie«, antwortete Anatolij.
»Was mein Freund sagen möchte, ist, dass wir nicht ins Visier der Polizei geraten möchten, bloß weil wir einen Kaffee bei Ihnen getrunken haben, als auf den Laden geschossen wurde.«
Samantha verengte die Augen, doch dann seufzte sie. »Okay.«
»Gut, wie ich sehe, haben wir uns verstanden.«
»Hoffentlich sieht man sich nicht wieder«, erwiderte sie leise.
Diese Frau hatte etwas an sich, das meine Neugier weckte.