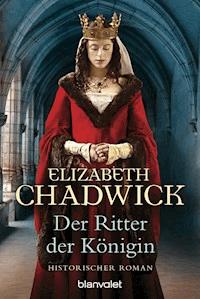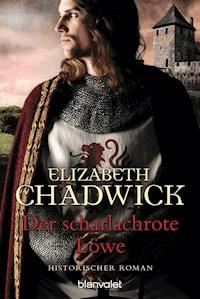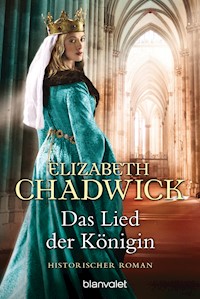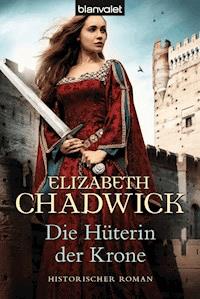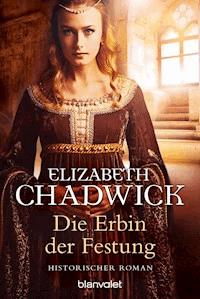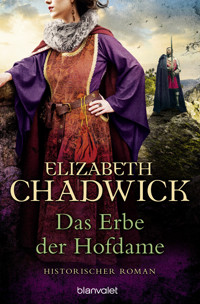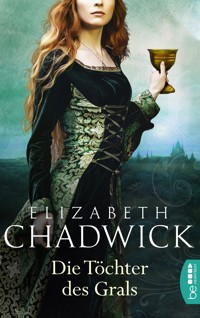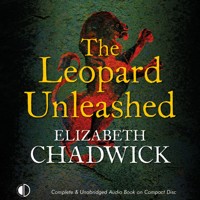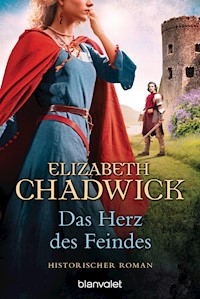7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Historische Fakten, große Charaktere und ein faszinierender Einblick in den dramatischen Kampf um die englische Krone
Zu Beginn des 12. Jahrhunderts spaltet die Nachfolge König Heinrichs bereits zu dessen Lebzeiten den englischen Hof. Nach seinem plötzlichen Tod entlädt sich der erbitterte Kampf um seinen Thron in einem blutigen Bürgerkrieg. John FitzGilbert, der königstreue ehemalige Hofmarschall, zunächst auf der Seite Stephans, des Neffen des toten Königs, wird schon bald gezwungen, das Lager zu wechseln – zu Mathilde, der Königstocher. Seiner Vaterlandsliebe wird schließlich das teuerste Gut eines Vaters abverlangt: Er soll seinen eigenen Sohn für den Frieden Englands opfern …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 802
Ähnliche
Buch
England, im frühen 12. Jahrhundert. Nach dem Tod von König Heinrich I. ist der Kampf um die Thronfolge zwischen seiner Tochter Matilda und seinem Neffen Stephan entbrannt. Ehrgeizige, mutige Männer kommen zu Ruhm und Ehre. John FitzGilbert, Ritter der Krone, ist einer von ihnen. 1135 schließt er sich zunächst Stephan an und wird reich belohnt. Doch wird er für seine Entscheidung einen hohen Preis zahlen. Als er in einem Kampf schwer verletzt wird, hat er nur eine einzige Chance, seinen Besitz und seine Nachkommen zu schützen: Er stimmt dem Angebot des Earls von Salisbury zu und heiratet dessen schöne und couragierte Schwester Sybilla, um die beiden Familien zu versöhnen. Die Ehe mit seiner ersten Frau Aline wird annulliert. John und Sybilla sind glücklich, doch der Frieden ist nicht von Dauer. Um einen Waffenstillstand zu erzwingen, wird ihr kleiner Sohn Will als Geisel genommen. Und John muss sich entscheiden, ob er sein Ehrenwort halten oder seine Ehre verteidigen will …
Autorin
Elizabeth Chadwick lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in Nottingham. Sie hat zwölf historische Romane geschrieben, deren Handlung stets im höfischen Mittelalter angesiedelt ist. Vieles von ihrem Wissen resultiert aus ihren Recherchen als Mitglied von Regia Anglorum, einer renommierten historischen Vereinigung, die das Leben und Wirken der Menschen im frühen Mittelalter nachstellt und so Geschichte lebendig werden lässt.
Inhaltsverzeichnis
1
Vernon-sur-Seine, Normandie,Herbst 1130
»Warum sind hier in der Abrechnung Zelter aufgeführt, obwohl ich im Stall nur ganz gewöhnliche Gäule vorgefunden habe?«, fragte John FitzGilbert in eisigem Ton und bedachte seinen Stellvertreter dabei mit durchdringendem Blick. Seine Augen schimmerten so dunkel wie die Oberfläche eines im Schatten liegenden Wassers.
»Mylord?« Unter dem linken Auge seines Gegenübers zuckte ein winziger Muskel.
Herbstliches Sonnenlicht glitt über die Binsen, die als dicker Teppich den Fußboden der Halle in König Heinrichs Jagdhütte bedeckten, streifte das Eck einer Tischplatte und fiel auf das untere Drittel eines Schriftstücks, das die Hand des geübten Schreibers verriet. Sein goldener Schein wärmte Johns Handrücken und ließ die Tresse schimmern, die den Ärmel seiner Tunika zierte. »Einer lahmt, der andere hat räudiges Fell, und der Braune ist alt genug, um schon Moses auf dem Heimweg aus Ägypten getragen zu haben!« Heftig pochte er mit dem Zeigefinger auf die fragliche Stelle. »Hier steht, dass Walter Picot fünf Zelter übergibt, um seine Schulden beim König zu begleichen. Wenn diese Gäule Reitpferde sind, so pökle ich auf der Stelle meine Stiefel und fresse sie.«
»Mylord, ich …«
»Keine Ausflüchte, Ralph. Schickt die Klepper umgehend zurück und sorgt dafür, dass Picot entsprechend den Vorgaben Ersatz leistet. Falls er sich weigert, werde ich ihn mir vorknöpfen. Ich bin nicht gewillt, den Abfall anderer Leute unter dem Dach des Königs zu horten.« Mit diesen Worten lehnte er sich zurück und legte die Hand in gebieterischer Pose auf den Knauf seines Schwerts. Als Marshal des Königs war John FitzGilbert für die Ordnung am Hof verantwortlich, daher war das Schwert für ihn ein unabdingbarer Teil der Ausrüstung und wurde nicht, wie von den anderen Höflingen, nur bei Zeremonien oder im Kampf angelegt. »Sollte sich jedoch herausstellen«, fuhr er fort und strich dabei nachdenklich mit dem Daumen über die weiche Rundung des Knaufs, »dass Walter tatsächlich fünf gute Zelter geliefert und einer meine Abwesenheit vom Hof ausgenutzt hat, um den eigenen Beutel zu mästen und Picots Tiere gegen diese Klepper zu vertauschen …« Den Rest des Satzes ließ er unausgesprochen in der Luft hängen.
Ralph fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. »Ich bin sicher, dass Eure Befürchtung unbegründet ist, Mylord.«
Fragend zog John eine Braue in die Höhe. Dann beugte er sich vor und legte die Hand auf das Pergament, sodass sich seine schlanken Finger über den Zeilen bogen. »Von meinen Untergebenen erwarte ich uneingeschränkte Loyalität und Tüchtigkeit, wofür ich sie auch großzügig belohne. Doch wer mich hintergeht oder betrügt, wird seines Lebens nicht mehr froh werden, wenn ich ihm erst auf die Schliche komme – falls er die Sache überhaupt überlebt. Haben wir uns verstanden?« John FitzGilbert war kaum fünfundzwanzig, doch seine Stellung als oberster Sergeant des Königs verdankte er nicht nur seinem Erbrecht auf dieses Amt. Vor nunmehr drei Jahren hatte er außerdem eine Anfechtung seiner Position vor Gericht so überzeugend abgewehrt, dass seitdem niemand mehr an seiner Befähigung zum königlichen Marshal und an seiner Kampfkraft zweifelte.
»Ich werde mich darum kümmern, Mylord«, entgegnete Ralph mit bleicher Miene und verkniffenen Lippen.
»Das will ich hoffen.« John FitzGilbert richtete seinen Blick bereits auf den nächsten Eintrag. Dort war die Anzahl der Brote aufgeführt, die an die königliche Meute verfüttert worden waren. Für gewöhnlich hätte er diese Prüfung solcher Listen einem seiner Untergebenen überlassen. Aber da er dem Hof längere Zeit hatte fernbleiben müssen, um nach dem Tod seines Vaters die Belange seines Besitzes zu ordnen, hielt er es nun für geboten, als Bestätigung seiner Macht dem Amt erneut seinen Stempel aufzudrücken. Ganz so wie man ein Siegel in warmes Wachs presste.
»Herr im Himmel, wie viele Laibe frisst eigentlich so ein Hund?« Als ein Schatten auf das Schriftstück fiel, hielt John inne und hob den Kopf. »Mylord?«
»Lasst es für heute gut sein, FitzGilbert.« Mit verschränkten Armen stand Robert FitzRoy vor dem Tisch und ließ sich seine blutrote Tunika von der Sonne wärmen. »Kommt lieber mit nach draußen. Dieses Schauspiel dürft Ihr Euch nicht entgehen lassen.«
Insgeheim seufzte John. Es war zwecklos, dem Earl of Gloucester erklären zu wollen, dass er die Abrechnung lieber bis zum Ende durchsehen wollte, ehe er sich anderen Dingen zuwandte. Robert FitzRoy, Earl of Gloucester, war als König Heinrichs ältester Sohn zwar von unehelicher Geburt, verfügte aber dennoch über größten Einfluss am Hof. Es lag also in Johns eigenem Interesse, sich gefällig zu zeigen; außerdem war Robert of Gloucester sein Bundesgenosse, Freund und Förderer.
Er erhob sich. Gloucester war hochgewachsen, aber John überragte ihn noch um die Länge eines Zeigefingers. Die massige Gestalt des Earls machte den Vorsprung allerdings wieder wett, sodass beide Männer gleich groß wirkten. Wortlos nahm John seinen Hut von der Bank, zog ihn durch den Gürtel – und fand sich insgeheim damit ab, dass die Abrechnungen vermutlich bis nach dem abendlichen Mahl warten mussten.
»Mein Cousin Stephan hat ein neues Pferd.«
John steckte seinen Umhang zusammen und kam hinter dem Tisch hervor. »Bringt alle diese Schriftstücke in mein Gemach«, rief er Ralph über die Schulter zu. »Außerdem will ich die Liste der Einnahmen der Armee während der Monate meiner Abwesenheit sehen. Und bis spätestens morgen Mittag möchte ich hören, was aus dem vierbeinigen Hundefutter draußen im Stall geworden ist.«
»Ja, Mylord.« Als sich sein Stellvertreter verbeugte, standen ihm winzige Schweißperlen auf der Stirn.
Mit langen energischen Schritten eilte John hinter Gloucester her.
»Sie bekommen zu spüren, dass Ihr wieder da seid«, bemerkte Robert of Gloucester mit verstohlenem Grinsen.
Um die Lippen des Marshals spielte ein sarkastisches Lächeln. »Das will ich meinen.«
»Und habt Ihr schon größere Missstände aufgedeckt?«
Johns Lächeln wurde breiter. Dabei zeigten sich erste feine Linien auf seinen Wangen, die sich in späteren Jahren als harte Falten eingraben würden. »Außer ein paar fragwürdigen Rössern im Stall und Hunden, die offenbar Weizenbrote in Massen verschlingen, gibt es nichts, was ich nicht im Griff hätte.«
»Und wie steht es mit den Frauen?«
»Für sie gilt dasselbe«, bemerkte John trocken.
Robert lachte laut und legte John seinen Arm um die Schultern. »Was ich nicht hoffen will. Ach, es ist gut, dass Ihr zurück seid!«
Draußen im Hof herrschte das lärmende Durcheinander, das der Jagd regelmäßig voranging. Inmitten dampfender Atemwolken und dem Geruch nach Stall und Pferden bestiegen die Lords ihre Rösser. Andere standen noch in Gruppen beisammen und warteten, bis die Stallknechte auch ihre eigenen Pferde endlich herbeibrachten. Die Hunde schnüffelten zwischen den vielen Beinen herum oder zerrten ungeduldig und zitternd vor Aufregung an ihren Leinen. Als Johns Blick auf einen weißen Jagdhund mit deutlich hervortretenden Rippen fiel, kam ihm wieder die Abrechnung in den Sinn.
In einer Ecke des Hofs hatten sich einige Zuschauer um einen rotgesichtigen Mann mit hellen Haaren versammelt, der einen mächtigen Rotschimmel gekonnt durch alle Gangarten bewegte. Mit verschränkten Armen gesellten sich Robert und John zu der Gruppe und verfolgten das Schauspiel.
»Ein Spanier«, bemerkte John mit Bewunderung und zugleich einem kleinen Anflug von Neid. Als oberster Sergeant des Königs besaß er zwar ebenfalls ausgesucht gute Pferde, aber ein Tier dieser Klasse war für ihn unerschwinglich. Für Stephan, Count of Mortain und Neffe des Königs, dagegen war ein solch edles Tier eine Selbstverständlichkeit, so weit stand er über den meisten anderen Menschen am Hof. Aber nicht, dass er deshalb eingebildet gewesen wäre. John hatte sogar einmal gehört, wie König Heinrichs Tochter Matilda, die sogenannte Kaiserin, in verächtlichem Ton geäußert hatte, dass ihr Cousin offenbar lieber wie ein gewöhnlicher Stallknecht mit den Pferden aus der Tränke soff, anstatt Wein aus einem kostbaren Pokal zu schlürfen, wie sich das für einen Mann seines Standes gehörte.
Stephan of Mortain ließ den Rotschimmel steigen und mit den Vorderhufen temperamentvoll durch die Luft schlagen. Dabei grinste er über das ganze Gesicht, und seine Augen funkelten vor Stolz. Dann hieß er das Tier stillstehen und sprang herunter – doch nur, um sich im selben Moment wieder in den Sattel zu schwingen. Nur dass er diesmal verkehrt herum saß. Durch geschicktes Überkreuzen der Beine drehte er sich gleich darauf blitzschnell wieder nach vorn und vollführte zum Abschluss eine überschwängliche Verbeugung vor seinem begeisterten Publikum. Es war eine mitreißende Vorstellung, und keiner konnte sich Stephans hervorragender Stimmung entziehen. Selbst John begann zu lachen und schloss sich dem Klatschen der Umstehenden an.
Gloucester formte die Hände zu einem Trichter. »Hast du schon einmal daran gedacht, diese Kunststücke zum Beruf zu machen?«, rief er Stephan zu.
Von der Seite her sah der Marshal kurz zu Gloucester hinüber, da ihm dessen bitterer Unterton nicht entgangen war. Die Rivalität zwischen den Vettern war unübersehbar. Beide zählten zu den Mächtigen des Landes, und beide zählten zu den engsten Verwandten des Königs, doch jedes Mal wenn sie einander anerkennend auf die Schulter klopften oder sich in der großen Halle zutranken, wetteiferten sie im Grunde nur um ihren Rang in der königlichen Gunst.
»Mehr als nur ein Mal!«, rief Stephan fröhlich zurück. Er griff nach den Zügeln, tätschelte den Hals des Hengstes und zupfte ihn zärtlich an den Ohren. »Doch ich fürchte, dass mir die Sache dann keinen Spaß mehr machen würde.«
»FitzGilbert verdient sein Brot, indem er die Dirnen des Hofs beaufsichtigt. Trotzdem konnte ich bisher nicht feststellen, dass seine Begeisterung dadurch nachgelassen hätte. Dabei erfordert sein Beruf doch eine mindestens ebenso große Geschicklichkeit im Sattel.«
Ein wissendes Grinsen huschte über Stephans Gesicht. »Ich würde mich niemals erdreisten, mit dem Hammer und Amboss eines königlichen Marshals mithalten zu wollen!«, witzelte er, worauf die Umstehenden in Gelächter ausbrachen. Schließlich wusste jeder, dass die überlieferten Amtssymbole eines königlichen Marshals auch eine Anspielung auf die männliche Zeugungskraft waren. Was Letztere anging, so hatte John einen gewissen Ruf, den er auch gar nicht in Abrede stellte. Stattdessen antwortete er mit einer spöttischen Verbeugung.
Im selben Augenblick richtete sich Stephans Blick auf einen Punkt hinter der Zuschauermenge. »Der König ist da«, erklärte er. »Wer jetzt nicht schnell aufsitzt, wird leider zu Hause bleiben müssen.« Er lenkte seinen Rotschimmel zu einem untersetzten Mann mit kurzem, angegrautem Haar hinüber, der soeben seine Unterkunft verlassen hatte und den Fuß in den Steigbügel eines Braunen schob. Eine prächtige Goldspange hielt seinen kurzen Jagdumhang an der Schulter fest. Zwei großspurig auftretende Männer begleiteten den König – und zwar Robert de Beaumont, Earl of Leicester, und dessen Zwillingsbruder Waleran, Count of Meulan. Wegen des engen Verhältnisses der beiden Männer zu Stephan und ihres vertrauten Umgangs mit seinem Vater beäugte Robert of Gloucester die Männer mit gebotenem Misstrauen. In der Vergangenheit hatte der Count of Meulan bereits einmal Verrat begangen, doch König Heinrich hatte ihm seinen Fehltritt verziehen und ihn wieder in Gnaden am Hof aufgenommen. Während Robert de Beaumont die Zügel seines Pferdes in Empfang nahm, warf er als der Vorsichtigere der Brüder einen prüfenden Blick in die Runde. Auch John stutzte angesichts der plötzlichen Nähe der beiden zum König. Diese Neuerung musste er nach seiner langen Abwesenheit sorgsam im Auge behalten und wie die übrigen Veränderungen mit einbeziehen, wenn er am Hof überleben und sein Fortkommen sichern wollte.
Mit überschwänglicher Freude begrüßte der Count of Mortain die Neuankömmlinge. Fürwahr kein schlechtes Mittel, um Türen zu öffnen und die Wachsamkeit bestimmter Männer einzuschläfern, dachte John mit zunehmender Bewunderung für den Neffen des Königs.
»Ihr begleitet mich«, bemerkte Robert of Gloucester zu John gewandt, als er sein Pferd übernahm und aufsaß. »Ich habe Euren Hengst bereits satteln lassen.« Er schnippte mit den Fingern und bedeutete einem der Stallknechte, Johns gefleckten Grauen zu bringen.
John zerrte den Hut aus dem Gürtel und drückte ihn auf sein hellbraunes Haar. »Ich danke Euch, Mylord«, entgegnete er mit verhaltener Begeisterung.
Robert lachte in sich hinein. »Im Moment seid Ihr zwar noch anderer Meinung, aber das wird sich sehr schnell ändern.« Er warf John einen Jagdspeer zu, den dieser blitzschnell am Heft auffing.
Als John kurz darauf einen Pfad durch den Wald entlanggaloppierte, zu dessen Seiten erste Herbstblätter wie sonnendurchglühter Bernstein in den Bäumen schimmerten, und er den festen und doch federnden Boden unter den Hufen seines Grauen spürte, begriff er schnell, was Robert gemeint hatte. Die mächtigen Sätze des Pferds wirkten belebend, und die herrlichen Farben und Gerüche des herbstlichen Waldes erfüllten ihn mit geradezu sinnlicher Freude.
König Heinrich liebte die schnelle Jagd und hetzte seinen Braunen und die Hunde stets bis an ihre Grenzen, während er den Körper tief über den gestreckten Hals des Pferdes beugte und sein kurzer Umhang wie ein Banner über ihm durch die Luft flatterte. Als die Treiber das erste Wildschwein aus dem Dickicht scheuchten, jagte ihm Heinrich hinterher wie der Teufel, der einer armen Seele auf der Spur war. Eine Hand hielt die Zügel gepackt und die andere den wurfbereiten Speer. Zusammen mit der übrigen Gesellschaft heftete sich John sofort an die Fersen des Königs, duckte sich unter tief hängenden Ästen hindurch und bahnte sich eine Schneise durch das dornige Gestrüpp. Das dumpfe Dröhnen der Hufe auf dem Waldboden, das heisere Bellen der Meute und das Keuchen seines Grauen waren Musik in seinen Ohren. Irgendwann preschte Count Stephan auf dem neuen Rotschimmel an ihm vorüber, unmittelbar darauf folgten die Beaumont-Brüder und als Schluss der Gruppe der königliche Mundschenk William Martel. Mit entschlossener Miene hetzte Robert of Gloucester ihnen nach. Wohlweislich zügelte John kurz seinen Grauen, um noch König Heinrichs Schlossvogt Brian FitzCount, Lord of Wallingford, den Vortritt zu lassen. Als dessen Stellvertreter im königlichen Haushalt war John stets auf ein gutes Verhältnis zu ihm bedacht. Mit blitzendem Lächeln und erhobener Faust dankte FitzCount für Johns Umsicht und jagte inmitten seiner vorbeifliegenden Meute davon.
In diesem Moment ertönte das Jagdhorn links von John, doch durch den Wind war das Signal nicht genau auszumachen. Rasch schlug John die neue Richtung ein. Als es plötzlich genau vor ihm im Unterholz raschelte, zügelte er seinen Hengst und packte den Speer fester. Sekunden später brachen drei Wildschweine aus einem undurchdringlichen Dickicht aus Dornenranken und Efeu hervor und stürmten so dicht an Johns Pferd vorbei, dass dieses einen Satz machte und scheute. John erkannte nichts weiter als erdverschmierte Eckzähne, raue Borsten und feucht schimmernde Schnauzen. Mit den Knien brachte er den Grauen wieder in seine Gewalt. Gleichzeitig holte er mit dem Speer aus und schleuderte ihn so kraftvoll von sich, dass er eines der Wildschweine genau hinter der linken Schulter traf und die eiserne Spitze bis zum Heft zwischen den Borsten eindrang. Das Schwein vollführte einen letzten Satz, bevor es unter Zuckungen und ohrenbetäubendem Quieken zusammenbrach. Der hölzerne Schaft splitterte, doch der blutige Stumpf blieb tief in der Wunde stecken. Mit gezogenem Schwert dirigierte John den Grauen vorsichtig zu seinem Opfer hinüber. Selbst tödlich verletzt konnte ein Eber noch immer einen Hund zerfleischen oder das Bein eines Pferdes bis auf den Knochen durchbeißen. Das Schwein zappelte wild, um wieder auf die Füße zu kommen, aber es war zu spät. Ein kurzes Zittern durchlief das Tier. Dann lag es still.
Als John vom Pferd stieg, wurde der Wald um ihn herum plötzlich vom Lärm der Treiber, der hetzenden Hunde und der Jäger zu Fuß erfüllt. In der Ferne kündete ein Hornsignal von neuer Beute – womöglich ein Erfolg des Königs. Stumm starrte der Marshal auf seine Beute hinunter, und als einer der Hundeführer die Meute zurückpfiff und sein hämmerndes Herz sich langsam beruhigte, grinste er mit einem Mal wie ein Junge über das ganze Gesicht.
Als die Jagdgesellschaft nach dem zweiten Hornsignal zurückkehrte, um die Beute in Augenschein zu nehmen, sah John zu, wie zwei Treiber sein Wildschwein auf ein Packpony wuchteten.
»Ihr habt uns alle übertroffen«, bemerkte der König. Sein Lächeln entblößte eine Menge schadhafter Zähne, denen man ihr Alter ansah. Seine eigene Trophäe baumelte leblos über einem Packsattel.
»Ich hatte Glück, Sire, und nur diese Wahl.«
»Mag sein, dennoch wird der Vorfall Eurem Ruf, ein gefährlicher Gegner zu sein, kaum schaden. Wer es allein mit einem ausgewachsenen Keiler aufnimmt, verdient, was auch immer das Schicksal für ihn bereithält – in Eurem Fall, John Marshal, ist das eine große Belohnung.«
»Ich danke Euch, Sire«, erwiderte John mit feierlicher Verbeugung. »Genau genommen waren es eigentlich drei Tiere«, fügte er hinzu, als er sich wieder aufrichtete. »Die anderen zwei sind meinem Speer leider entwischt und in dieser Richtung davongerannt.«
König Heinrich lachte, und sofort blitzte neue Jagdlust in seinen Augen auf. »Zumindest hattet Ihr so viel Anstand, uns noch etwas übrig zu lassen.« Er gab seinen Gefährten ein Zeichen und sprengte unter dem Klang des Jagdhorns in die bezeichnete Richtung davon.
Bevor Stephan seinem Onkel folgte, beugte er sich kurz vom Pferd herunter und klopfte John auf die Schulter. »Gut gemacht!« Ehrliche Bewunderung leuchtete in seinen blauen Augen.
»Es ist doch alles nur in der Hitze des Augenblicks geschehen«, wehrte John bescheiden ab.
»Der beste Beweis, dass Ihr keinen spanischen Hengst braucht, um Eindruck zu schinden«, bemerkte Gloucester bissig, bevor auch er sein Pferd wendete.
Ein weiteres Wildschwein und zwei Rehböcke später fand sich die Gesellschaft auf einer Lichtung ein, wo die Diener des Königs ein Mahl zur Stärkung der Jäger angerichtet hatten. Man speiste und zog John unterdessen damit auf, dass er den Eber mit nur einer Hand erlegt hatte. John wehrte die Lobreden ab, weil er wusste, dass jeder andere an seiner Stelle ganz genau dasselbe getan hätte. Außerdem lag ihm Gefallsucht fern. Doch insgeheim war er durchaus mit sich zufrieden.
Er hockte sich ans Feuer und röstete gerade ein Stück Brot auf einem angespitzten Ast, als Gloucester sich zu ihm gesellte. »Wie Ihr vermutlich gehört habt, befindet sich meine Schwester noch immer in Rouen«, bemerkte Robert nach einigen Augenblicken ganz beiläufig.
John drehte den Spieß und zog das Brot ein Stück weit aus den Flammen zurück. »Also gibt es noch keine Anzeichen für eine Versöhnung mit Geoffrey Plantagenet?«
Bevor John den Hof verlassen musste, um seinem sterbenden Vater beizustehen und sich um den Besitz der Familie zu kümmern, hatte es zwischen König Heinrichs Tochter Matilda und ihrem jungen Ehemann Streit gegeben. Daraufhin hatte Geoffrey of Anjou seine Frau zu ihrem Vater in die Normandie zurückgeschickt und erklärt, dass er nicht mit einem solchen Drachen leben und erst recht keinen Erben mit ihr zeugen wolle.
Bekümmert zog Robert die Mundwinkel nach unten. »Sie beharrt darauf, eher würde die Hölle gefrieren, als dass sie zu ihm zurückkehrt. Und von ihm hört man nichts anderes.«
»Und was sagt Euer Vater dazu?«
»Insgeheim knirscht er mit den Zähnen, aber nach außen bemüht er sich um Ausgleich. Doch so lange keine der beiden Seiten Bereitschaft zum Einlenken zeigt, wird er kaum etwas erreichen, nicht wahr?«
John zog das geröstete Brot vom Stock. Er hatte selbst schon einige Male mit Matilda zu tun gehabt, die sich noch immer mit Vorliebe als Kaiserin titulieren ließ, um an ihre erste Ehe mit dem Herrscher des Heiligen Römischen Reiches zu erinnern, der ein geachteter, würdiger Mann gewesen war und nicht nur der Sprössling eines pickeligen Counts und obendrein noch zehn Jahre jünger als sie selbst. Dass der Vater des jungen Geoffrey inzwischen König von Jerusalem geworden war, hatte ihre Haltung in keiner Weise gemildert. »Das stimmt«, erwiderte John, »doch einige Druckmittel hat er trotzdem einzusetzen.« Mit beredtem Blick sah er zum König hinüber, der sich gerade angeregt mit Stephan of Mortain unterhielt. Entspannt standen Onkel und Neffe nebeneinander, ihre Bewegungen beim Essen und Trinken glichen einander wie im Spiegel. »Ja, das muss er sogar.« John biss in das knusprige Brot. »Schließlich ist aus seinen Ehen kein männlicher Erbe hervorgegangen. Selbst wenn Euer Vater heute noch rüstig erscheint, so ist er doch längst kein junger Mann mehr.«
Nachdenklich rieb sich Robert den Nacken und runzelte die Stirn. »Aber wir alle haben doch das Thronrecht meiner Schwester anerkannt und ihr den Treueid geleistet.«
»Welcher Mann hätte denn gewagt, den Eid zu verweigern, wo Euer Vater doch haargenau jede Regung der Anwesenden beobachtet hat? Ohne sein Beisein wäre die Sache womöglich anders ausgegangen.« Auch John war damals bei der Zeremonie in der Kathedrale von Rouen zugegen gewesen, wo noch sein Vater den Treueid geleistet hatte. Doch angesichts der eher bescheidenen, wenn nicht sogar mageren Einkünften eines königlichen Marshals war König Heinrich damals vor allem an den Treueschwüren der Mächtigen seines Reiches gelegen.
»Was genau wollt Ihr damit sagen?«
»Falls Euer Vater will, dass seine Tochter Matilda eines Tages seine Nachfolge antritt, wäre er klug beraten, wenn sie bereits einen oder besser noch zwei halberwachsene Enkelsöhne vorweisen könnte, sobald ihn die Last der Jahre niederdrückt. Ob es einem gefällt oder nicht – Männer werden nun einmal lieber von einem Mann regiert als von einer Frau.«
Robert brummte unwirsch. Trotzdem wanderte sein Blick zu seinem Vater und Stephan hinüber.
John spießte ein neues Stück Brot auf den Stock und hielt es in die Flammen. »Euer Vater benutzt Euren Cousin, um Druck auf seine Tochter auszuüben. Doch manchmal lässt sich schon nicht mehr sagen, wer wen jagt. Jedes Lebewesen frisst das Schwächere – oder es passt sich ihm an, falls dies zu seinem Vorteil ist.«
»Gilt dasselbe auch für Euch?«
Johns Hand vollführte eine umfassende Bewegung. »Nehmt die Bäume als Beispiel. Der Winter raubt ihnen die Blätter, und man sieht jede Schrunde, jeden toten Ast und den starken Stamm. Doch sobald sie ihr grünes Laub tragen, kann man nur schwer etwas erkennen. Es sind zwar immer dieselben Bäume, aber je nach Jahreszeit verändern sie sich.«
»Und das soll eine Antwort sein?«, fauchte Robert. »Ihr sprecht in Rätseln.«
Während John verfolgte, wie das Brot allmählich Farbe annahm, antwortete er in aller Ruhe: »Euer Großvater hat zwar unehelich das Licht der Welt erblickt – aber dennoch hat er eine Krone auf dem Kopf getragen. Man sagt, dass …«
Robert fuhr zurück, als hätte John ihn geschlagen, und lief dunkelrot an. »Ich weiß sehr gut, was ›man‹ sagt. Wenn Ihr zu diesen Menschen gehört, FitzGilbert, so habe ich mich in Eurer Freundschaft getäuscht. Einen solchen Weg werde ich niemals einschlagen! Niemals!«
John zog den Stock zurück. »Ihr täuscht Euch so wenig in mir wie in Euch selbst, Mylord.«
Gloucester wandte den Blick ab. Dann zauste er seinen Umhang wie eine Katze ihr Fell und stapfte wortlos davon. Ungerührt widmete sich John weiter seinem Brot und dachte bei sich, dass Robert nur deshalb so ungehalten war, weil ihm die Vorstellung, selbst nach der Krone Englands zu greifen, im tiefsten Grund seiner Seele behagte – auch wenn er sich dies niemals eingestehen würde. Von klein auf hatte man ihm eingeschärft, dass nur der Sohn den Vater beerben konnte, der einer rechtmäßigen Ehe entstammte. Seit den Tagen seines Großvaters, der einst als unehelich geborener Herzog der Normandie den englischen Thron eroberte, hatte sich die Welt verändert. Robert of Gloucester konnte bedeutende Ländereien, Titel und großen Reichtum sein Eigen nennen, und die Verwandten seiner Mutter waren am Hof willkommen. Außerdem liebte ihn sein Vater von ganzem Herzen und hielt als Ratgeber große Stücke auf ihn. Auch ohne Krone war sein Lohn groß, und seine strenge Moral ließ ihn kein Stück vom rechtschaffenen Weg abweichen – ganz der gehorsame Sohn seines Vaters. Dennoch, vermutete John, musste es eine große Versuchung bedeuten, die goldene Straße parallel laufen zu sehen und zu wissen, dass man dank der Gnade Gottes und der Worte eines Priesters im Königspurpur selbst darauf hätte wandeln können. John wusste sehr wohl, welchen Weg er an Roberts Stelle gewählt hätte, doch aus der Ferne und einem anderen Blickwinkel fielen solche Überlegungen auch nicht weiter schwer.
Als John neunzehn war, hatte ihm eine Wahrsagerin auf dem Septembermarkt in Salisbury aus der Hand gelesen und ihm eine hohe Stellung geweissagt – und obendrein würde sein Sohn eines Tages England regieren. Aber John hatte der Frau mitten ins schrumpelige Gesicht gelacht. Als Sohn eines Mannes, der es durch Klugheit, Sorgfalt und Loyalität vom Sergeanten im Gefolge eines Lords zum königlichen Marshal gebracht hatte, besaß er zwar den Ehrgeiz und auch die Fähigkeit, auf solcher Grundlage weiterzubauen, aber eine Krone ließ sich auf diese Weise ganz bestimmt nicht gewinnen, dessen war er sicher. Bei der Erinnerung an die Prophezeiung legte sich ein trockenes Lächeln auf seine Lippen. Er wischte sich die Krümel von den Händen. Dann richtete er sich auf und spazierte zu den Hundeführern hinüber, um sie über die Fressgewohnheiten ihrer Meute zu befragen.
Das Fest, das der königlichen Jagd folgte, dauerte bis lange in die Nacht, und als Marshal des Hofes hatte John alle Hände voll zu tun, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Wer den König sprechen wollte, kam an ihm und seinen Männern nicht vorbei. Und wenn sich Heinrich mit einem bestimmten Mann unterhalten wollte, oblag es John, den Wunsch des Königs zu erfüllen. Ebenso mussten er und seine Männer im umgekehrten Fall dafür Sorge tragen, dass der König nicht belästigt wurde, wenn er jemanden ausdrücklich meiden wollte. Naturgemäß regte sich vereinzelt Widerspruch, doch für solche Fälle trug John sein Schwert – und den Ruf, ein gefährlicher Gegner zu sein. Niemand bemängelte mehr, wie jung dieser Marshal war, hatte er erst erlebt, wie blitzschnell er handelte, Schwierigkeiten im Voraus erahnte und sie bereits im Keim erstickte.
Als sich der König schließlich mit einigen ausgewählten Höflingen, darunter Robert of Gloucester, Stephan of Mortain und die Beaumont-Zwillinge, in seine persönlichen Gemächer zurückzog, stand der Mond bereits hell und silbern am Sternenhimmel. Johns Männer hatten sich einiger Betrunkener annehmen müssen und den Streit zwischen zwei jungen Hitzköpfen geschlichtet, indem sie ihnen kurzerhand die Messer abnahmen. Außerdem hatten sie einen Bischof in sein Quartier geleitet, nachdem dieser über Waleran de Beaumonts Hund gestolpert war und sich den Schädel an einer Tischkante angeschlagen hatte.
Als endlich alles unter Kontrolle war, kehrte John zufrieden in sein kleines Gemach in der Nähe der Ställe zurück. Im Vorbeigehen sah er, dass in der Unterkunft der Dirnen noch Licht brannte. Das war nichts Ungewöhnliches, da ihr Geschäft naturgemäß bis spät in die Nacht ging. Er überlegte kurz, ob er auf ein Wort stehen bleiben sollte, entschied sich dann aber, dass dazu morgen noch genug Zeit sein würde. In seinem Gemach warteten genügend Pergamente und Abrechnungen auf ihn, ohne dass er sich zusätzlich noch die Probleme der Hofdirnen aufbürden musste.
Genau wie Pferde, Hunde und Falken gehörten auch die Dirnen zum Aufgabenbereich eines königlichen Marshals. Ihm oblag die Sorge um Ernährung, Kleidung und Unterkunft der Frauen – und um ihre Entlohnung aus der königlichen Schatulle. Da die meisten Mädchen nach einem dauerhaften Liebesverhältnis strebten, gab es einen lebhaften Wettbewerb um die Plätze am königlichen Hof, weil man dort hervorragend nach derartigen Möglichkeiten Ausschau halten konnte. An Bewerberinnen herrschte kein Mangel, aber Johns hohen Ansprüchen genügten die wenigsten. Sein Maßstab waren die Vorlieben des Königs und der mächtigen Lords – und ganz nebenbei auch seine eigenen. Eine Dirne des Hofs musste nicht nur hübsch anzusehen sein und den Männern den besten Ritt ihres Lebens bescheren können, sondern sie musste obendrein auch noch erfahren, anpassungsfähig und vor allem verschwiegen sein. Manchmal hatte John das Gefühl, er würde eher einen Eimer Hühnerzähne finden als auch nur eine einzige Frau, die all diese Eigenschaften verkörperte.
In seinem Quartier angekommen, schickte er als Erstes seinen Diener und den Knappen schlafen. Tagsüber war er so gut wie immer mit anderen Menschen zusammen, daher genoss er die wenigen einsamen Momente, die sich ihm boten. Sie schenkten ihm die Zeit, um sich zu erholen und nachzudenken, um einfach nur still zu sein und den Gedanken freien Lauf zu lassen. Er breitete seinen Umhang über eine Truhe und hängte den Schwertgürtel an den Haken. Auf dem Tisch unter dem geschlossenen Fensterladen standen eine Kanne Wein und einige Becher bereit, daneben wartete der Stapel mit Schriftstücken und Rechnungen vom Morgen. John goss sich einen Becher Wein ein, rückte die Laterne zurecht, bis ihr Schein genau auf den Tisch fiel, und sank anschließend mit dem tiefen Seufzer eines Mannes, der sich nach getaner Arbeit der nächsten zuwandte, auf den Schemel nieder.
Als Erstes griff John jedoch nach dem Pergament, das neben dem Stapel lag und am unteren Ende Heinrichs Siegel trug. Diese Sache betraf ihn ganz persönlich, im Gegensatz zu den Pferden oder Hunden des Hofs. Vor seinem inneren Auge erstand wieder das Bild des errötenden Mädchens, das er während der Messe in der Kathedrale von Salisbury gesehen hatte, als er sich wegen der Regelung seiner Angelegenheiten dort aufgehalten hatte. Aline Pipards Vater war ebenfalls vor kurzem gestorben, und John hatte die Vormundschaft und damit das Recht erworben, die Besitztümer des Mädchens zu verwalten und Aline gegebenenfalls gegen eine bestimmte Summe mit einem Mann seiner Wahl zu verheiraten.
Er trank einen Schluck und blickte nachdenklich auf das Schriftstück. Ob Aline den Einsatz wert war, den er für dieses Amt hatte entrichten müssen? Er hatte sich noch nicht entschieden, wie er weiter verfahren wollte – ob er das Recht zur Eheschließung an jemanden verkaufen oder das Mädchen selbst zur Frau nehmen wollte. Ihre Väter waren viele Jahre miteinander bekannt gewesen, und er selbst kannte Aline seit ihrer Kindheit, allerdings nur aus der Ferne. Er war ihr einige Male rein zufällig begegnet und hatte hie und da einen Blick mit ihr gewechselt. Jedenfalls waren es nicht die familiären Bande, die ihn zu diesem Handel veranlasst hatten. Vielmehr hatten ihn die Einkünfte ihres Besitzes verlockt – und nicht zuletzt die Überlegung, dass ein Vogel in der Hand so viel wert war wie zwei im Busch. Sollten einmal magere Zeiten anbrechen, so konnte er auf diese Einnahmen zurückgreifen. Nachdenklich rollte er das Pergament zusammen, umwand es mit einem seidenen Band und wandte sich dann endgültig dem Stapel der Abrechnungen zu.
Als der Marshal beim zweiten Becher angelangt war und gerade einen neuen Federkiel angespitzt hatte, ließ ihn ein leises Klopfen an der Tür aufmerken. Kurz dachte er daran, es einfach zu überhören, doch die Arbeit langweilte ihn. Außerdem stand ihm durchaus der Sinn nach einer kleinen Abwechslung – erst recht einer weiblichen, dem Ton des Klopfens nach zu urteilen. Er ließ die Arbeit ruhen und freute sich, als er beim Öffnen der Tür seine Annahme bestätigt fand. Wortlos trat er einen Schritt zur Seite, um die Frau hereinzulassen. Mit anmutigen Schritten schwebte sie an ihm vorbei zum Kamin, wo sie sich umdrehte und ihn anblickte.
Er ließ den Riegel einrasten. »Mistress Damette«, sagte er höflich, während er seiner Besucherin einen Becher Wein einschenkte. »Welchem Umstand verdanke ich das Vergnügen?« Er benutzte den Namen, unter dem sie am Hof bekannt war. Im wahren Leben hieß sie Bertha und war die jüngste von sechs Töchtern eines verarmten Ritters aus der Gegend von Avranches. Seit Damette die Gemeinschaft der Hofdirnen verlassen hatte, um die Geliebte eines angevinischen Barons zu werden, waren drei Jahre ins Land gegangen.
Mit kehligem Lachen und bedeutsamem Blick nahm die Frau den Becher entgegen. »Das verdankt Ihr allein der Tatsache, dass Ihr der Marshal des Königs seid und ich auf der Suche nach Arbeit bin.«
»Das habe ich vermutet.« Er nahm seinen zur Hälfte geleerten Becher in die Hand und lehnte sich in gespielt zwangloser Haltung an den Tisch. »Was ist geschehen?«
Damette zog eine Schnute. »Der Kreuzzug ist an allem schuld. Mein Baron hat das Kreuz genommen und den Frauen abgeschworen. Als er nach und nach seinen gesamten Besitz verkaufte, um das Geld für die Reise und den Kampf ums Heilige Land aufzubringen, habe ich meine Sachen gepackt und ihn verlassen, bevor er auch noch meine seidenen Gewänder und die Pelze versetzen konnte.« Sie hatte sich in Hitze geredet. »Sonst stünde ich jetzt nur im Hemd vor Euch.« Sie stürzte den Wein hinunter. Dann legte sie ihren Umhang ab und warf ihn über den seinen auf die Truhe. Das eng sitzende Spitzengewand zeichnete jede Linie und jede Rundung ihres Körpers nach.
John musterte die junge Frau von Kopf bis Fuß. Sie hatte dunkles glänzendes Haar und ebensolche Augen, und der warme Schein von Laterne und Feuer zauberte einen sanften Schimmer auf ihre Wangen. Es war Johns Vater, der Damette in den Kreis der königlichen Dirnen aufgenommen hatte, und zuweilen hatte sie auch das Bett des einstigen Marshals geteilt. Jedoch nie das seine. Zu jener Zeit war Damette, obwohl gleichaltrig, schon sehr viel erfahrener gewesen als der junge John, der gerade am Beginn seiner Laufbahn gestanden hatte. »Eine hübsche Bemerkung«, stellte John fest. »Aber du kennst das Leben am Hof, und ich fürchte, dass ›nackte Haut unter dem Mantel‹ heutzutage nichts Besonderes mehr ist.«
»Ihr könntet womöglich zu der Überzeugung gelangen, dass ich etwas mehr zu bieten habe, Mylord.«
»Und das wäre?«
Damette trat näher zu ihm. Dann stupste sie einen Finger in seinen Wein und fuhr ihm damit langsam über die Lippen. »Erfahrung zum Beispiel.« Aufreizend langsam und sachter als ein Hauch glitt ihre Hand über sein Brustbein bis hinunter zu seinem Geschlecht. »Und Können.«
Heiß und schwer wie geschmolzenes Blei schoss die Lust in Johns Körper. »Du kennst die Regeln, Damette … und deine Pflichten.« Er schlang die Arme um sie und zog sie an sich. Das Gefühl ihres üppigen Körpers war köstlich.
»Oh ja, ich weiß Bescheid … Mylord Marshal«, hauchte Damette. »Ihr werdet keinerlei Grund zur Klage haben … Das verspreche ich.«
In der trägen Stimmung nach einem doppelten Liebesspiel, wenn Spannungen und Ärgernisse in milderem Licht erscheinen, faltete John die Hände hinter dem Kopf und blickte zu den Balken empor. »Woher wusstest du, dass du mich mit ›Mylord‹ anreden musstest?«, fragte er neugierig.
»Euer Stellvertreter hat mich darüber informiert, dass Euer Vater gestorben ist … Ich bedauere es sehr.« Damette stützte sich auf einen Ellenbogen. Der rosige Hauch auf ihren Brüsten und ihrem Hals zeigte deutlich, dass auch sie das Vergnügen genossen hatte.
John schwieg. Einen Moment lang zögerte Damette, aber dann beugte sie sich über ihn und legte die Handfläche an seine Wange. »Ich bedauere jedoch keineswegs, dass Ihr jetzt seine Stellung innehabt.«
Der Ausdruck stiller Zufriedenheit schwand aus Johns Augen. »Nach mir musst du deine Angel nicht auswerfen, Süße. Ich bin nicht der Mann, der sich eine Geliebte zulegt. Ich weiß zu viel, als dass mich ein solcher Köder noch locken könnte.«
Sie lachte und küsste ihn auf den Mundwinkel. »Auch wenn Ihr ausseht wie ein gefallener Engel und Euer Können zwischen den Laken nicht zu verachten ist, sollten meiner Meinung nach beide Seiten Vorteile haben. Ihr würdet zu viel von mir erwarten … und ich ebenso.«
»Das genau ist der Punkt – besonders Letzteres.« Er strich ihr übers Haar, um die romantische Stimmung nicht zu verderben. Dann setzte er sich auf und griff nach seinen Kleidern.
»Ihr schützt Euch vor den Menschen, nicht wahr?«
Rasch schlüpfte John in Hemd und Hose. »Nenne mir einen Höfling, der das nicht tut.« Dann stand er auf und kehrte an den Tisch zurück, wo noch immer die Arbeit auf ihn wartete. Er war zwar müde, aber er hatte vor langer Zeit gelernt, ohne Schlaf auszukommen. Sein Vater hatte stets gepredigt, dass im Grab noch genügend Zeit zum Schlafen sei, und John hatte sich diese Philosophie nur zu gern zu eigen gemacht. Er sah zu Damette hinüber. »Doch ich muss mich nicht schützen«, sagte er, »denn mein wahres Gesicht ist unter dem verborgen, das jeder sehen kann.«
Sie rollte sich auf den Bauch und stützte sich auf, sodass die dunklen Haare über ihre Schultern fielen. Ihre gekreuzten Knöchel ragten in die Luft. »Ihr wärt bestimmt überrascht.«
»Wovon?« Er setzte sich und begann zu arbeiten.
»Von dem, was Ihr sehen würdet, wenn man Euch auf die Probe stellte. Kann ich bis morgen früh hierbleiben?«
»Solange du still bist.«
»Ich verspreche, nicht zu schnarchen.«
»Das habe ich nicht gemeint.«
Sie verzog das Gesicht, und John hätte beinahe gelacht, doch es gelang ihm, einfach darüber hinwegzusehen.
Damette lieh sich seinen Kamm, der auf der Truhe lag, und kämmte und flocht ihr Haar, ohne sich ihrer Nacktheit bewusst zu sein. Hin und wieder sah John zu ihr hinüber und streifte ihre Gestalt mit bewunderndem Blick. Feste, volle Brüste; lange Beine. Sie würde den Dirnen am Hof nicht lange Gesellschaft leisten, sondern bald einen neuen Beschützer finden.
Damette zerrte an einem Knoten, der sich beim Kämmen gebildet hatte. »Ich weiß, dass ich Euch nicht stören soll«, bemerkte sie beiläufig, »aber vielleicht möchtet Ihr trotzdem gern erfahren, dass ich zwei Nächte mit Geoffrey of Anjou verbracht habe.«
John ließ die Feder sinken und musterte Damette mit scharfem Blick.
»Er ist ein gut aussehender junger Mann – der Gemahl der Kaiserin«, plapperte sie. »Vielleicht etwas hastig, was in seinem Alter ja nicht weiter verwundert, aber dafür gleich wieder zu einem neuen Schuss bereit.« Sie schenkte John Marshal ein beredtes Lächeln, bevor sie sich wieder der verknoteten Strähne zuwandte. »Er hat gesagt, dass er vielleicht nach Compostela pilgern will. Seine Frau möchte er selbst für alles Gold von England nicht zurückhaben.«
»Bist du sicher, dass genau das seine Worte waren?«
»Aber gewiss. Für kluge Zurückhaltung ist dieser Mann noch viel zu jung. Wenn er nach dem Liebesspiel nicht gleich einschlafen kann, spricht er gern noch ein wenig … und ich bin eine gute Zuhörerin.«
John Marshal schüttelte den Kopf. »Der König wird ihm die Pilgerreise nicht gestatten. Zumindest nicht, solange die ausweglose Situation in der Ehe nicht überwunden ist. Heinrich ist darauf angewiesen, dass seine Tochter und Geoffrey miteinander Erben in die Welt setzen.«
»Vielleicht will Geoffrey den König ja zum Handeln zwingen – oder er scherzt nur. Ich habe den Eindruck, als sei er ein Mensch, der gern Stöckchen ins Feuer wirft und dann voller Wonne zusieht, wie sie brennen.« Sie umwand das Ende ihres Zopfs mit einem roten Seidenband.
Nachdenklich sah John Damette an. »Demnach planst du also nicht, dich um den Platz als Geoffreys Geliebte zu bewerben?«
Damette zog ihr Näschen kraus und lachte. »Oh nein, der ist mir noch viel zu launisch. Im Augenblick führt er sich auf wie ein kleines Kind, das gestreichelt werden will und Bestätigung braucht. Erst wenn er eines Tages erwachsen ist, könnte es sich vielleicht lohnen.«
John arbeitete noch einige Zeit weiter, obgleich seine Gedanken ständig zwischen den Kassenberichten seines Amtes und Damettes Erzählungen hin und her sprangen.
»Ich könnte Euch nützen«, erbot sich Damette, als hätte sie seine Gedanken gelesen. »Euer Vater hat meine Beobachtungen immer als sehr nützlich erachtet.«
John blickte auf eine Rechnung hinunter, ohne das Schriftstück wirklich zu sehen. Mit einem Schlag wurde ihm bewusst, wie sehr sein Vater ihn geschützt hatte, indem er ihn von derartigen Umtrieben ferngehalten hatte, als er so jung gewesen war wie der junge Geoffrey. »Dann gehe auch ich gern auf das Angebot ein.«
»Und der Lohn?«
»Der ist Verhandlungssache.« Er beugte sich wieder über die Pergamente. Damette wusste zu genau, wie weit sie gehen konnte. Sie legte sich wieder hin und drehte ihm den Rücken zu. Dann zog sie die Decke über die Schulter und tat zumindest so, als würde sie schlafen.
John goss sich noch einen Becher ein und prostete der verhüllten Gestalt zu, während ein bitteres Grinsen in seinen Augen aufblitzte. Selbst wenn dieses Zwischenspiel zu nichts führte, so hatte es ihm doch unmissverständlich vor Augen geführt, dass er sich wieder am Hof befand.
2
Abtei von le Pré, Rouen,Herbst 1130
»Compostela!« Die verwitwete Kaiserin des Heiligen Römischen Reiches und verschmähte Ehefrau des siebzehnjährigen Count of Anjou spuckte das Wort mit einem ärgerlichen Auflachen aus. »Nun weiß ich mit Bestimmtheit, dass mein Mann verrückt ist!« Das Wort »Mann« stieß sie voller Ekel hervor, als hätte sie im Gemüse eine Schnecke entdeckt. »Was will er denn dort? Will er vom Heiligen die Auflösung der schrecklichen Ehe erflehen? Guter Gott – soll er doch meine Gebete gleich mit einschließen!« Zornesröte färbte ihre Wangen und ließ ihre Augen gefährlich funkeln.
Mit dem Amtsstab im Gürtel lehnte John neben der Tür an der Wand und bewunderte den Auftritt – auch wenn er mehr als Erleichterung verspürte, dass diese Frau nicht mit ihm verheiratet war. Kein Wunder, dass ihre Ehe mit dem um so viele Jahre jüngeren Mann, obendrein von niedrigerem Stand als sie, leckgeschlagen war und nun so rasch sank wie das Schiff, das zehn Jahre zuvor ihren Bruder mit sich in die Tiefe gerissen hatte. John hatte Gloucester berichtet, was er von Damette erfahren hatte, und war nun Zeuge, wie Robert sein Wissen weitergab, ehe die Geschwister ans andere Ufer der Seine übersetzten, um mit ihrem Vater in der Burg von Rouen zu speisen.
»Er wird nichts dergleichen tun«, sagte Robert, aber sicher schien er sich nicht zu sein. »In meinen Augen ist es nur eine leere Drohung. Geoffrey will das Seil nur noch ein wenig fester spannen.«
»Soll er sich doch daran aufhängen! Mir ist das gleichgültig.«
»Geoffrey muss seine Pflicht erfüllen, genau wie du. Aus dieser Pflicht wird unser Vater keinen von euch entlassen, und das weißt du.«
Matilda bedachte ihren Bruder und anschließend John mit finsterem Blick. »Belehre mich nicht über meine Pflicht. Ich war gerade acht, als der Wille meines Vaters meine Kindheit beendete und ich verheiratet wurde. Und Geoffrey of Anjou habe ich nur geheiratet, weil mein Vater es wünschte. Glaubst du wirklich, ich wäre eine dieser Verbindungen aus eigenem Antrieb eingegangen? In meiner ersten Ehe war ich zumindest Kaiserin und genoss den Respekt meines Mannes und meines Volkes. Diese zweite Ehe jedoch ist nur ein … ein lächerliches Zerrbild!«
Robert sah unbehaglich drein. »Auch Geoffrey of Anjou wird reifer werden.«
»Und wann?«, fauchte Matilda. Mit verächtlich gekräuselter Oberlippe sah sie zu John hinüber. »Ich vermute, dass Ihr die Sache mit Compostela von einer Eurer Huren erfahren habt.«
John senkte den Kopf. »Wo stünde der Hof ohne das Wissen seiner Dirnen und Priester, Madam?«, fragte er betont gleichmütig.
Sie runzelte gefährlich die Brauen, sodass John sich schon auf eine Schimpftirade gefasst machte. Aber dazu kam es nicht. Stattdessen wandte sich die Kaiserin an ihren Bruder. »Ich gehe auf keinen Fall zu ihm zurück, Rob.«
»Auch dann nicht, wenn die Umstände andere wären?«
»Diese Ehe hat mich genug erniedrigt«, entgegnete Matilda bitter. »Außerdem kann ich nicht erkennen, welche Umstände sich ändern sollten. Geoffrey hat mich nach Hause geschickt, also soll er jetzt mir hinterherlaufen. Wenn er jedoch Compostela und die Dirnen vorzieht, dann soll er nun eben in deren Betten liegen, aber nicht in meinem.«
Vor Wut klang ihre Stimme hart und kalt. Wenn Matilda ihre Worte und den Tonfall nur ein klein wenig geschickter wählen würde, überlegte John, so besäße sie ein unwiderstehliches Mittel, um jedermann in ihren Bann zu schlagen, ohne zugleich an eine bedrohliche Waffe zu erinnern. Aber vermutlich waren ihrem Wesen Ausgleich und Weichheit nicht gegeben. John bewunderte Matilda für ihren Mut und wusste, dass Robert seine Schwester gern hatte – wenngleich seine Zuneigung vermutlich auch davon abhing, wie stark sie eines Tages auf ihn würde bauen, wenn sie erst ihr Erbe in der Normandie und in England antrat.
Matilda durchquerte den Raum, um sich von einer ihrer Dienerinnen den Umhang umlegen und zustecken zu lassen.
»Zumindest gibt es eine erste Hoffnung«, murmelte John so leise, dass nur Robert ihn hören konnte. »Sie hat wenigstens ›also soll er jetzt mir hinterherlaufen‹ gesagt. Demnach scheint sie gewillt, die Sache noch einmal zu überdenken, wenn ihr Mann einen ernsthaften Versuch zur Versöhnung unternimmt.«
Robert war sichtlich bekümmert. »Glaubt Ihr?«
»Geoffreys Berater werden auf keinen Fall tatenlos zusehen, wie er sich die Normandie und England durch die Finger gleiten lässt. Und wenn das nur mittels Aussöhnung mit seiner Frau zu verhindern ist, so wird es auch dazu kommen. Wie Ihr richtig bemerkt habt, muss der junge Mann vielleicht noch erwachsen werden. Aber ein Narr ist er ganz sicher nicht.«
Robert lächelte. »Gibt es noch andere Erkenntnisse aus Eurer Quelle?«
»Mit dem üblichen Geschwätz der Dirnen hat das nichts zu tun«, erklärte John angespannt.
Roberts Lächeln wurde breiter. »Ihr wärt nicht der Marshal meines Vaters, wenn Ihr nicht weitsichtig und klug wärt wie eine Eule. Wie Ihr die Menschen am Hof und die Ereignisse einschätzt, ist fürwahr bewundernswert.«
Ein kleines Lächeln trat in Johns Augen. »Das ist nicht bewundernswert, Mylord, sondern notwendig.«
Hoch oben auf dem vom Wind umtosten Hügel erhob sich die Kathedrale von Salisbury über einem weiten, welligen Land voller Steinkreise und Wege, die länger bestanden, als irgendjemand zurückdenken konnte. Ein bitterkalter Ostwind peitschte kleine Schneeflocken über die Downs, und graue Wolken hingen tief über der Kirche der Heiligen Jungfrau mit ihrem neu errichteten Chor.
Im langen Kirchenschiff drängte sich eine vielköpfige Gemeinde, aber selbst diese drangvolle Enge spendete kaum Wärme. Hustenanfälle, rote Triefnasen und feuchte Ärmel waren Beweis dafür, dass das winterliche Erkältungselend die Runde machte, während die Dezembertage täglich kürzer wurden.
Aline Pipard steckte ihre erstarrten Hände unter die Achseln und bewegte unablässig die Zehen, an denen sich kleine Frostbeulen teils taub anfühlten, teils schmerzhaft brannten. Es kostete sie große Mühe, ihre Gedanken zu sammeln und der Messe von Bischof Roger von Salisbury zu folgen. Seine Gegenwart war ein besonderes Ereignis, da sich der Bischof für gewöhnlich lieber um die königliche Schatulle und sonstige Staatsangelegenheiten kümmerte und seine Schäfchen stattdessen seinen Stellvertretern überließ. Es ging das Gerücht, dass eine Prüfung der Steuereinnahmen fragwürdige Geschäfte und Nachlässigkeiten zutage gefördert hatte und sich am Hof dunkle Wolken über dem Bischof zusammenbrauten, wenn er nicht bereits in Ungnade gefallen war.
Der Dunst des Weihrauchs stieg himmelwärts – und verströmte den Duft eines der kostbarsten Gewürze, das die Heiligen Drei Könige dem Christuskind einst nach Bethlehem gebracht hatten. Der Geruch beflügelte Alines Phantasie. Im Traum kniete sie im Stall vor der Krippe und badete in dem heiligen Schein, der die Jungfrau und ihr neugeborenes Kind umgab. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Aline schwärmte für Kirchen, für ihre Rituale und für die religiösen Gegenstände und Geschichten. Selbst in dieser beißenden Kälte spendete ihr das Wissen, sich im Haus Gottes zu befinden, noch Trost und Zuversicht. Pater noster, qui es in coelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in coelo, et in terra. Als sie am Vortag gemeinsam mit ihrer Mutter in der Burg von Salisbury eingetroffen war, hatte Lord Walter, der Sheriff von Salisbury, sie davon in Kenntnis gesetzt, dass John FitzGilbert of Hamstead offiziell die Vormundschaft für Alines Besitz und ihre zukünftige Eheschließung erworben hatte. Zudem hatte sie ein persönlicher Brief des Marshals erwartet und als Geschenk ein Rosenkranz aus wunderschönen Bernsteinperlen, die golden wie Honig schimmerten. Die Perlen waren leichter als Glas oder Stein, und wenn Aline die Schnur langsam durch die Finger gleiten ließ, fühlte sie ihre Wärme wie ein Überbleibsel des Sommers. Aline war sprachlos gewesen – und verunsichert, was dieses Geschenk zu bedeuten hatte. War es ein Symbol für John FitzGilberts Wertschätzung ihrer Person? Hatte er die Absicht, sie zu heiraten, oder wollte er auch weiterhin nur ihr Vormund bleiben? Nach den üblichen Begrüßungsformeln, mit denen der Brief begann, hatte er versichert, stets mit großer Sorgfalt und Pflichtgefühl für sie und ihr Wohlergehen sorgen zu wollen. Doch das waren nur förmliche Worte. Lediglich die Perlenschnur schien persönlich an sie gerichtet zu sein. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Sie wusste noch, dass sie John FitzGilbert zum ersten Mal nur von ferne gesehen hatte, als sie noch zu Füßen ihrer Mutter spielte. Er hatte seinen Vater als junger Mann begleitet, da dieser einige Angelegenheiten der Staatskasse mit ihrem Vater regeln musste. Fremden gegenüber war sie für gewöhnlich stumm vor Schüchternheit, doch das Lächeln dieses gut aussehenden jungen Mannes und sein lustiges Wesen hatten sie insgeheim entzückt und verlegen gemacht. Von da an war sie John FitzGilbert hin und wieder begegnet, und seine Wirkung auf sie war stets dieselbe geblieben. Zuletzt hatte sie ihn, wie sie sich erinnerte, im letzten Sommer in Salisbury gesehen, als er vom Hof beurlaubt war und nach dem Tod seines Vaters seinen Besitz geordnet hatte. Damals hatte er sich nach der Messe mit Sheriff Walter unterhalten – einem hoch gewachsenen Mann mit langen Gliedmaßen, der eine elegante Erscheinung abgab. Im Nacken und an den Schläfen war sein Haar von einem warmen Braun, doch in den Schopf hatte die Sommersonne goldene Strähnen eingewoben. Das hübsche Aussehen des Jungen von damals hatte Wort gehalten und sich zu männlicher Schönheit gewandelt. Als hätte John FitzGilbert ihre prüfenden Blicke gespürt, hatte er sich kurz zu ihr umgedreht. Ihre Blicke hatten einander getroffen, und wieder hatte sie nach Luft schnappen und errötend den Kopf senken müssen. Anschließend hatte sie nicht gewagt, noch einmal aufzusehen, da seine Augen sie womöglich noch immer so eindringlich musterten, dass sogar ihr Magen rebellierte. Als er sich zum Gehen gewandt hatte, war ihr Blick noch hastig auf seinem Rücken verweilt, und neben einer gewissen Erleichterung hatte sie zugleich große Traurigkeit verspürt.
Und seit gestern hielt sie nun den Brief in Händen, demnach derselbe John FitzGilbert das Recht besaß, über ihren Besitz und ihren zukünftigen Ehemann zu bestimmen. Er hatte ihr einen wunderhübschen Rosenkranz geschenkt und ihr banges Herz mit Gefühlen erfüllt, die sie so unerfahren, wie sie war, gar nicht recht deuten konnte. Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum; sed tantim dic verbo, et sanabitur anima mea. Als sie durch das Kirchenschiff nach vorn ging, um die Kommunion zu empfangen, umklammerte sie den Rosenkranz wie einen Talisman und schwankte zwischen Bangigkeit und Sehnsucht. Sollte sie Gott bitten, dass John Marshal zu ihr kommen und sie zur Frau nehmen würde, oder sollte sie darum beten, dass er auch weiterhin am Hof blieb und ihre Phantasie nur von ferne belebte? Deo gratias.
Draußen vor der Kathedrale hatte sich der Schneefall in eisige Graupelschauer verwandelt, die heftig auf der Wange brannten. Aline und ihre Mutter senkten die Köpfe gegen den Wind und hasteten mit ihren Bediensteten im Schlepptau zurück in die Burg, wo ihnen der Sheriff Gastfreundschaft gewährte, damit sie erst am nächsten Morgen nach Clyffe zurückkehren müssten. Auch Lord Walter hatte der Messe beigewohnt, zusammen mit seiner Frau und einem Teil seiner Kinderschar, angefangen von den beiden älteren Söhnen, die so gut wie erwachsen waren, bis hin zu der jüngsten ihrer Töchter, einem klugen kleinen Mädchen von sechs Jahren. Aline ging den Kindern meist nach Möglichkeit aus dem Weg, da die Salisburys so lebhaft waren wie junge Hunde. Doch im Wissen, dass Gott alles sah, rang sie sich zumindest ein höfliches Lächeln ab, als die Kleinste an ihr vorbeihüpfte und ihr braungoldener Zopf dabei von einer Seite auf die andere flog. Schon bei dem Gedanken, eines Tages womöglich solche Kinder wie die von John FitzGilbert zu erwarten, krampfte sich Alines Magen zusammen, und sie nestelte nervös an den Perlen des Rosenkranzes herum. Er hatte diese Perlen berührt; er hatte sie für sie ausgesucht.
Ein plötzlicher Schrei, gefolgt von warnenden Rufen, ließ Aline herumfahren. Vor Schreck schlug ihr das Herz bis zum Hals. Ein älterer Mann war auf dem Rückweg von der Messe über einen behauenen Quader gestürzt, den offenbar einer der Steinmetze, die mit Befestigungsarbeiten an der Burg beschäftigt waren, achtlos hatte liegen lassen. Wie gebannt starrte Aline auf den gesplitterten Knochen, der wie ein abgebrochener Ast aus dem Arm des Mannes ragte, und auf das Blut, das aus der Wunde hervorquoll. Ihr wurde übel. Hastig wandte sie den Blick ab, aber es war zu spät. Das Bild hatte sich bereits unauslöschlich in ihre Vorstellung eingebrannt. Sie wankte, und Speichel sammelte sich in ihrem Mund.
»Oh, Aline, doch nicht gerade jetzt!«
Der entsetzte Ruf ihrer Mutter schien wie aus weiter Ferne zu ihr zu dringen. Sie spürte einen festen Griff an ihrem Arm. Dann versagten ihr die Füße den Dienst. Nur ganz entfernt wurde sie gewahr, dass man sie über den Hof und weiter in ein Gebäude der Burg trug. Dort setzte man sie auf eine Bank und drückte ihr den Kopf zwischen die Knie. Der beißende Gestank brennender Federn stieg ihr in die Nase, und sie musste würgen. Aber sie spuckte nur etwas wässrigen Magensaft in die Binsen.
»Ich bedauere sehr, dass Eure Tochter sich nicht wohl fühlt, Lady Cecily«, hörte Aline eine Frau mit besorgter Stimme sagen. Als sich ihr Blick ein wenig klärte, erkannte sie Lord Walters Frau, Lady Sybire, die neben der Bank stand.
»Ach, das ist weiter nichts«, versicherte ihre Mutter mit einer verlegenen Handbewegung. »Sie wird gleich wieder völlig zu sich kommen.«
Unter Lady Sybires prüfendem Blick wurde Aline von Scham gepackt. Jedes Mal, wenn sie Blut sah, musste sie sich übergeben. Keiner verstand das, im Gegenteil. Man hielt ihre Abneigung für närrisch und lächerlich. Sie hatte schon oft versucht, dagegen anzukämpfen, aber bisher ohne Erfolg.
Lady Sybire berührte Aline an der Schulter. »Ich werde Euch etwas Wein bringen lassen«, sagte sie. Dann drehte sie sich um, als einige Unruhe am Tor die Ankunft des Verletzten ankündigte, der von zwei Männern in die Halle gebracht wurde. »Ich fürchte, Ihr müsst mich entschuldigen.« Mit einem bedauernden Nicken wandte sie sich ab, um sich um die Neuankömmlinge zu kümmern.
»Es tut mir leid, Mama«, flüsterte Aline.
»Still, mein Kind«, entgegnete ihre Mutter mit leiser Stimme, aber ihre Verärgerung war nicht zu überhören. »Für die Zukunft musst du lernen, mit solchen Dingen anders umzugehen. Was soll denn dein Vormund von dir denken?«
»Ja, Mama.« Aline zitterte und fror. Ihr Vater hatte so gut wie nie Zeit für sie gehabt und stets verlangt, dass sie ihm nicht in die Quere kam, sondern sich in ihrem Gemach ihren Gebeten widmete. Was nun auf sie zukommen würde, erfüllte sie mit Schrecken.
Im Auftrag von Lady Sybire erschien kurze Zeit später eine Magd mit einer Kanne heißem Wein, die sich erbot, die Ladys zu einem kleineren Gemach zu geleiten, wo Aline sich erholen konnte. Erfreut nahm Cecily das Angebot an.
»Wenn du Lady Sybire beobachtest, kannst du sehr viel lernen«, bemerkte sie, als sie es sich zusammen mit ihrer Tochter auf den bunten Kissen einer Bank nahe der Feuerstelle bequem machte. »Sie ist eine wahre Lady.«
In der Hitze, die von der Glut ausging, schmerzten Alines erstarrte Füße, und ihre Wangen brannten. Doch der gewürzte Wein weckte ihre Lebensgeister und nahm ihr zugleich die größte Angst. »Ich glaube nicht, dass sie mich mag, Mama«, bemerkte Aline zaghaft.
»Still, Kind«, wiederholte Cecily ungeduldig. »Bis auf einige wenige Worte in der Kirche kennt sie uns doch gar nicht. Schließlich hatte dein Vater – Gott schenke seiner Seele Frieden – immer nur mit ihrem Mann zu tun. Ich denke jedoch, dass sie nun, da du das Mündel des Marshals bist, mehr über dich erfahren möchte. Schließlich ist FitzGilbert ein Nachbar, auch wenn er die meiste Zeit abwesend ist.«
Als ihre Mutter John erwähnte, tasteten Alines Finger nach dem Rosenkranz, doch zu ihrem größten Entsetzen hing er nicht mehr wie sonst an ihrem Gürtel. Mit einem kleinen Schrei sprang sie auf und suchte wie besessen die Bank und den Fußboden ab. Aber nirgendwo in den Binsen sah sie die Perlen im warmen Honigton leuchten.
»In der Halle hatte ich den Rosenkranz noch!« Entsetzt suchte sie weiter, weil sie einfach nicht glauben konnte, dass sie ihn verloren hatte. »Ich weiß genau, dass ich ihn dort noch hatte. Ganz sicher!«
»Wahrscheinlich hast du ihn fallen lassen.« Beruhigend legte ihr Cecily die Hand auf die Schulter. »Fasse dich, meine Tochter. Wir werden ihn bestimmt wiederfinden.« Und in leicht tadelndem Ton fügte sie hinzu: »Tränen und Schluchzen bringen ihn nicht zurück. Du solltest dich über solche Kleinigkeiten nicht derart aufregen.«
Um Haltung bemüht, wischte sich Aline die Tränen ab und ging langsam den Weg zurück, den sie gekommen waren.
Als die jüngste Tochter des Sheriffs an einer Bank in der Halle vorbeirannte, stach ihr das Leuchten des Bernsteins in die Augen. Gierig wie eine Elster stürzte sie sich auf den überraschenden Fund und wusste im selben Moment, dass der Rosenkranz der jungen Frau gehörte, die wegen der blutenden Wunde des Mannes ohnmächtig geworden war.
Die Perlen schimmerten wie Gold und fühlten sich warm und angenehm an. In der Mitte des Rosenkranzes hing eine Quaste aus goldfarbener Seide, und dann gab es noch eine Schlaufe, mit der man die Perlen am Gürtel befestigen konnte. Sybilla war hingerissen. Wie alle Mädchen hatte sie eine Vorliebe für Schmuck und hübsche Gegenstände, und es gab nichts Schöneres für sie, als an einem verregneten Nachmittag auf dem Bett ihrer Mutter zu sitzen und in den Broschen, Gürteln, Schnallen und Ringen im emaillierten Kasten herumzuwühlen. Bis auf eine bronzene Gewandbrosche und eine Sammlung hübscher Haarbänder besaß sie selbst noch keine eigenen Kostbarkeiten. Ihre Mutter sagte stets, sie sei für solchen Tand noch zu jung. Wenn sie aber erst alt genug für die Pflichten einer Lady sei, dürfe sie auch deren Vorrechte genießen.
Als Sybilla auf die schimmernden Perlen hinuntersah, empfand sie eine große Versuchung, einfach damit wegzurennen und den Schatz unter ihrem Kopfkissen zu verstecken. Niemand würde davon erfahren, und sie hätte die Kostbarkeit ganz für sich allein. Vielleicht hatte Gott sie ja als neue Besitzerin auserkoren, indem er sie die Perlen finden ließ. Oder war es doch Satan, der sie versuchte? Sybilla war alt genug, um die Zehn Gebote zu kennen, und sie wusste, dass Begehren und Stehlen zu den großen Sünden zählten. Wenn sie die Perlen an sich nahm und ihre Mutter es entdeckte, war ihr eine schreckliche Strafe gewiss. Mindestens eine Tracht Prügel und der Entzug des Abendessens, und womöglich durfte sie obendrein nie wieder mit dem Schmuckkasten spielen.
Während Sybilla noch die Vor- und Nachteile ihres Begehrs gegen die Ehrlichkeit abwog, kehrten die junge Frau und ihre Mutter in die Halle zurück. Sichtlich verzweifelt ging die junge Frau langsam umher und beugte sich immer wieder zu Boden. Ihre Mutter tat es ihr mit gerunzelten Brauen gleich. Sofort überkam die Kleine tiefes Schuldgefühl. Hin und her gerissen zwischen Bedauern und Erleichterung, ging Sybilla auf die Frauen zu und streckte ihnen den Rosenkranz hin. »Ich habe ihn gefunden«, sagte sie mit einem warmen Gefühl im Magen.
Mit einem Freudenschrei stürzte sich die junge Frau auf die Perlen. »Ich danke dir! Danke!«
Alines Mutter verdrehte die Augen. »Ich habe dir doch gesagt, dass wir ihn wiederfinden.«
»Die Perlen sind wunderhübsch«, bemerkte Sybilla und sah