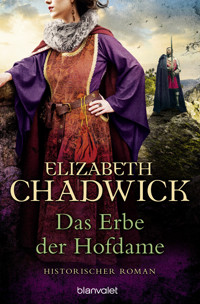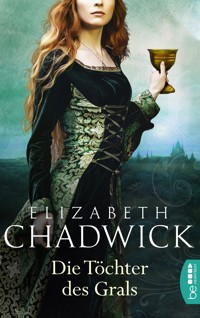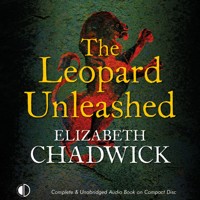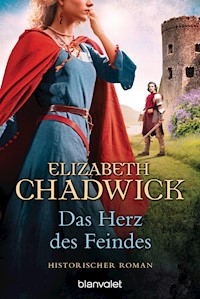9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Ravenstow-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Das Debüt von Bestseller-Autorin Elizabeth Chadwick erstmals als eBook!
England, 11. Jahrhundert: Um eine Fehde zu beenden, muss Lord Guyon auf Befehl König Williams I. das Mündel seines verschlagenen Widersachers heiraten. Doch schon bald erweist sich die schüchterne sechzehnjährige Judith von Ravenstow als mutige Gefährtin. Mehr als einmal rettet sie Lord Guyon das Leben. Und als die beiden in die Wirren des Krieges geraten, spüren sie, dass ihre Ehe weit mehr ist als nur eine politische Liaison ...
Dieser historische Roman ist in einer früheren Ausgabe unter dem Titel "Die wilde Jagd" erschienen und markiert den Auftakt der Ravenstow-Trilogie.
Band 2: Die Frau mit dem kupferroten Haar.
Band 3: Die Geliebte des Kreuzritters.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dreißigstes Kapitel
Einunddreißigstes Kapitel
Weitere Titel der Autorin
Die Ravenstow-Trilogie:
Band 2: Die Frau mit dem kupferroten Haar
Band 3: Die Geliebte des Kreuzritters
Über dieses Buch
England, 11. Jahrhundert: Um eine Fehde zu beenden, muss Lord Guyon auf Befehl König Williams I. das Mündel seines verschlagenen Widersachers heiraten. Doch schon bald erweist sich die schüchterne sechzehnjährige Judith von Ravenstow als mutige Gefährtin. Mehr als einmal rettet sie Lord Guyon das Leben. Und als die beiden in die Wirren des Krieges geraten, spüren sie, dass ihre Ehe weit mehr ist als nur eine politische Liaison …
Über die Autorin
Elizabeth Chadwick gilt laut Historical Novel Society, Großbritannien, als gegenwärtig beste Autorin mittelalterlicher Romane. Sie hat inzwischen über 20 historische Romane geschrieben, viele davon Bestseller. Ihr Debüt „Die Gefährtin des Normannen“ (vormals „Die wilde Jagd“) wurde mit dem Betty-Trask-Award ausgezeichnet und ist seit 2019 erstmals als eBook erhältlich, ebenso wie die weiteren Bände ihrer Ravenstow-Trilogie.
Die Autorin lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in Nottingham.
Homepage: http://elizabethchadwick.com/
Elizabeth Chadwick
Die Gefährtin des Normannen
Aus dem Englischen von Friedrich A. Hofschuster
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1990/2008 by Elizabeth Chadwick
Titel der englischen Originalausgabe: „The Wild Hunt“
First published in Great Britain by Sphere, an Imprint of Little, Brown Group Book
Für diese Ausgabe:
Copyright © 1991/2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titel der deutschsprachigen Erstausgabe: „Die wilde Jagd“
Covergestaltung: Manuela Städele-Monverde unter Verwendung von Motiven © shuttertock: Mark Carrel | Lukasz Pajor; © iStock: Grape_vein
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar
ISBN 978-3-7325-6881-9
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Meinen Eltern, zum Dankfür ihre Unterstützung,Alison King für ihre Hilfe,meinem Mann für sein Verständnisund meiner Agentin Carol Blakesowie meinen HerausgebernMaggie Pringle und Barbara Boote dafür,dass sie meine Träume wahr gemacht haben
Erstes Kapitel
Die walisischen Marken
Winter 1098
Schnee, getrieben von einem beißenden Novemberwind, traf in trockenen Flocken auf Guyons dunklen Umhang und wirbelte an ihm vorüber auf die Burg zu, die drohend aufragte von ihrer Klippe hoch über dem angeschwollenen Wye-Fluss. Das müde Pferd zupfte Gras und stopfte es in sich hinein, erholte sich dabei allmählich, und Guyon strich ihm über die Ohren und gab dem muskulösen Nacken des Reittiers einen Klaps. Das Licht wurde schwächer, das Wetter immer schlechter, aber zum Glück war ein schützendes Dach in Sicht.
Das graue Streitross verweigerte beinahe das Durchqueren des eisigen, bis über seine Gelenke gehenden Wassers der Furt, doch Guyon berührte das Tier nur sachte mit den Sporen, und der Hengst machte einen Satz nach vorn, preschte das letzte Stück durch das dunkle, flüssige Eis und erreichte die schlammige, schon fast gefrorene Dorfstraße auf der anderen Seite des Flusses.
Die Höfe der Kleinbauern waren von innen erhellt, von den Feuern zum Kochen der Abendmahlzeiten und den zuckenden Binsenlichtern. Als sie an der Kirche vorbeikamen, lief ein bellender Köter heraus, der versuchte, Arian hinterherzurennen und nach seinen Hinterläufen zu schnappen. Ein Hufeisen blitzte auf. Die Folge war lautes Jaulen, dann Stille. Eine Tür aus Weidengeflecht öffnete sich und wurde rasch wieder geschlossen nach einem scharfen Kommando aus dem Inneren der Hütte.
Guyon ritt weiter, vorbei an der Mühle und dem ölig schwarzen Schimmer des Mühlbaches, begann dann den steilen Anstieg zur Burg. Einmal noch hielt er inne, um hinaufzuschauen durch schneeverkrustete Brauen zu dem soliden Sandsteinbau und schnitt dazu eine Grimasse, als ob ihm ein Mundvoll Wein plötzlich zu Essig geworden wäre. Bei ihrer Ankunft würde man Arian erst einmal eine wärmende Abreibung verpassen, ihm eine warme Decke geben und eine Raufe voll Futter, das für die Nacht ausreichen würde. Guyon hätte sich sehnlichst gewünscht, dass seine Bedürfnisse auch so leicht zu stillen gewesen wären, aber er brachte Botschaften mit, die eine solche Fürsorge fürs Erste unmöglich machten.
Die Zugbrücke rumpelte herunter, und der Graue stakste über die dicken Eichenplanken, wobei seine Hufe ein hohles Echo hervorriefen. Darunter lag eine Schlucht mit kantig scharfen Felsen und mit dem Abfall von der Burg, wie er nur von den zähesten Schafen verschlungen werden konnte – und hier und da von einem nicht ganz so zähen, fluchenden Schäfer.
Er zügelte Arian zu einem Trott, sodass sie unbehindert unter dem Fallgitter hindurchkamen und durch den dunklen Bogen des Wachhauses in den offenen Burghof gelangten. Dort hielt er den Hengst an und schwang sich von seinem Rücken. Seine Beine waren so steif, dass er sich einen Augenblick lang nicht bewegen konnte und am Sattel festhalten musste, bis ein Pferdeknecht auftauchte und sich um das Pferd kümmerte.
»Schlimme Nacht, M’lord«, bemerkte der Mann, lutschte an den Zähnen und schaute ihn mit klaren Augen und einer unausgesprochenen Neugier an.
Guyon lockerte den Griff am Sattelknauf und richtete sich gerade auf. »Es kommt noch schlimmer«, antwortete er grimmig und bezog sich dabei nicht allein auf das Wetter. »Kümmere dich um das Eisen an seinem rechten Vorderhuf, Sim, ich glaube, es ist lose.«
»Aye, M’lord.«
Guyon gab Arian noch einen Klaps, dann ging er quer über den Burghof, erst langsam, bis er wieder Gefühl bekam in den Beinen, den dunklen Kopf gebeugt gegen den wilden, mit Flocken durchsetzten Wind. Er grüßte die Wachen am Eingang zum Haupt- und Wohngebäude, zog sich die Panzerhandschuhe aus und ging die steile Treppe hinauf zu der Halle im zweiten Stockwerk.
Das Dinnerhorn war gerade erst ertönt, und die Schragentische waren besetzt mit Essenden. Als sie des Erben ihres Lords ansichtig wurden, hielten sie inne mit dem Kauen, ihre Hände blieben zwischen Mund und Schüssel, und ihre Augen wurden rund und bewegten sich wie Murmeln, um seinen Weg durch die Halle zu verfolgen, wobei den Männern sein langer, ungeduldiger Schritt auffiel, während sich die Frauen an der Breite seiner Schultern und der arroganten, auffallenden Schönheit seines Gesichts erfreuten.
Guyon schaute weder links noch rechts und ging hinauf zu dem Tisch auf dem erhöhten Podium, wo sein Vater mit den älteren Rittern und den Gefolgsleuten sowie den Burgbewahrern saß, und außerdem, wie er mit leichter Verärgerung feststellte, mit seiner Halbschwester Emma, die an dem für die Dame des Hauses vorgesehenen Platz thronte.
Miles le Gallois schaute auf, erschrak und erhob sich dann, um seinen Sohn zu begrüßen. »Guy! Wir hatten dich nicht so früh erwartet.«
»Ein Mann reitet schnell, wenn ihm der Teufel auf den Fersen sitzt«, antwortete Guyon, trat hinauf, beugte sich vor, um seine Schwester zu küssen, und nahm dann den Platz ein, den man ihm hastig frei gemacht hatte. Seine Beine fühlten sich plötzlich, als wenn sie zu Wasser geworden wären. Der ganze Raum drehte sich und schwankte vor seinen Augen.
»Ein Wunder, dass du nicht vom Pferd gefallen bist, Guy, du siehst schrecklich aus!« Emma gab einem der Diener, die an ihrem Tisch servierten, ein Zeichen.
»Wirklich?« Er nahm den Becher Wein, den sie ihm hinstreckte. »Nun, vielleicht habe ich guten Grund dazu, Em.« Er fühlte, dass sich aller Augen auf ihn gerichtet hatten, erschreckt wie die Kaninchen, wenn sie den Fuchs wittern.
»Der König hat dir doch nicht die Ländereien von Onkel Gerard verweigert?«, fragte sein Vater in ungläubigem Ton.
Guyon schüttelte den Kopf und starrte in den blutroten, schillernden Wein. »Im Gegenteil: Der König hat mich mit Freuden zum Erben ernannt und mir alle dazugehörigen Rechte und Privilegien erteilt«, sagte er in einem Ton, der seinen Vater nicht beruhigte, sondern erst recht nervös machte.
Drei Monate zuvor war Gerard gefallen im Kampf gegen die Waliser auf der Insel Mon, die manche auch Anglesey nennen. Er war ein kinderloser Witwer gewesen und hatte Guyon als Erben eingesetzt, doch König William Rufus war bekannt dafür, dass er die Erbschaftsrechte zugunsten der Rechte des Geldes zu benachteiligen pflegte. Guyon war zu Rufus in die Normandie gereist, um seinen Anspruch auf die Ländereien geltend zu machen, aber die Art und Weise seiner Rückkehr erfüllte Miles mit einer unguten Vorahnung. Die Augen seines Sohnes waren so schwarz wie die Wasser des Mühlbaches und so grimmig. Sicher, ein Teil davon war Müdigkeit. Aber ein anderer Teil war etwas, das Guyon bisher zurückhielt.
Miles warf einen Blick auf Guyons zusammengepresste Lippen, auf den harten Griff, mit dem er die Finger um den Stiel des Bechers gelegt hatte, dann ließ er den Blick über die anderen Männer am Tisch schweifen. Was immer es war, Guyon würde es nicht öffentlich bekannt geben. Er deutete ihnen durch ein Gähnen an, dass sie in ihre Räume zurückkehren sollten, doch das wurde verhindert durch seine Tochter, der, Gott segne sie, Guyons Zustand keineswegs entgangen war.
»Jesus!«, schalt sie und legte ihre Hand auf die ihres Bruders. »Du bist ja eiskalt! Wie konntest du auch bei einem solchen Wetter reisen? Die Nachricht hätte sicher ein paar Tage warten können. Und schau mich nicht so an. Ich lasse die Mädchen eine Wanne zubereiten in deinem Zimmer, und du gehst inzwischen dorthin, wo es warm ist!«
Etwas von der Schwärze wich aus Guyons Augen. Ein Funke leuchtete auf. Emma hielt die Tatsache, dass sie drei Jahre älter war als er, für ein Privileg, ihn herumkommandieren zu können, umso mehr, als seine Mutter vor zwei Wintern an der Fieberkrankheit gestorben war. Wenn ihr Mann mit dem Hof reiste, als Stellvertreter des Großkämmerers und Vorstehers des Hofstaates, spielte sie in den Marken die Schlossherrin, terrorisierte die Dienstboten und die Familie und forderte hier wie da die Einhaltung einer strengen Hausordnung.
Diesmal jedoch kämpfte er nicht dagegen an, sondern ließ sie gewähren. »Du solltest die Köche ein bisschen munter machen, damit meine Leute etwas zu essen bekommen«, sagte er, während er aufstand, um ihr zu folgen. »Die treffen in einer Stunde ein und werden mich ganz schön verfluchen, die armen Teufel.«
Emma begann ihn auszuschelten wegen seiner Torheit, ihnen vorauszureiten, vor allem in dieser Zeit, wo die Marken so gefährlich und wild waren. Aber Guyon ging das Gezeter zum einen Ohr hinein und zum anderen heraus.
Sobald die dampfende Wanne bereit war, begann Guyon sich auszuziehen, und Emma schickte die Mädchen mit einem autokratischen Fingerschnippen hinaus. Er zog die Brauen hoch, als er es sah, bevor er sich das Kettenhemd über den Kopf zog.
Miles zog den Vorhang zu hinter den zwei Mädchen. »Ich glaube kaum, dass Guyon momentan besonderes Interesse für die Verführungskünste der Frauen hat, Emma«, bemerkte er trocken.
»Glaubst du? Nach dem, was mir mein Mann über den Hof erzählt, wäre Guy noch empfänglich für die Reize der Frauen, wenn man ihn gefesselt und halb tot geprügelt hätte.« Sie nahm ihrem Bruder mit anklagenden Blicken das Kettenhemd ab.
»Die Hälfte Gerücht und ein Körnchen Wahrheit«, verteidigte sich Guyon, dann jaulte er, als sie zu fest an seinem Wams zerrte, das sie ihm ebenfalls über den Kopf zog und ihm dabei fast die Ohren abriss.
»Weiber!«, schimpfte er, rieb sich den Hinterkopf und duckte sich dann vor ihrer nächsten, handgreiflichen Erwiderung, richtete sich wieder auf und packte sie an den Handgelenken, um sie zu sich herzuziehen und sich einen Kuss zu stehlen.
Emma funkelte ihn an, und ihre Lippen zuckten, obwohl sie sich bemühte, sich das Grinsen nicht anmerken zu lassen. »Und du bist mir vielleicht ein Schweinehund!«, gab sie ihm zurück und fügte hinzu, als er seine Lippen auf die zur Faust geballten Knöchel drückte, die er gefangen hielt: »Du brauchst gar nicht erst mit deinen höfischen Tricks zu kommen. Ich kenne sie in- und auswendig.«
Guyon ließ sie seufzend los. »Das kann ich mir denken«, sagte er, und plötzlich war der scherzende Blick aus seinen Augen verschwunden. Sein Gesicht wurde wieder zu der grimmigen Maske, die er bei seiner Ankunft gezeigt hatte. »Aber lass mir wenigstens die Hoffnung, dass sie auf andere Frauen wirken.«
Emmas klare Augen verengten sich. »Nicht in dieser Umgebung«, sagte sie streng.
»Ich dachte eigentlich etwas weiter die Marken hinauf. An die Tochter von Maurice FitzRoger, um genau zu sein.«
»Was?« Miles, der sich gegen einen schönen Intarsienschrank gelehnt hatte, war plötzlich hellwach.
»Judith von Ravenstow«, sagte Guyon in neutralem Ton, zog die Stiefel aus, dann die Hose, und stieg in die dampfende Wanne. »Im Auftrag des Königs.«
»Rufus hat dir die Tochter von Maurice von Ravenstow angeboten?«
»Nicht angeboten. Er hat gesagt: Du heiratest sie ohne Widerrede, sonst ...« Guyon schaute mit düsteren Augen auf seinen völlig verblüfften Vater. »Er hat außerdem die Grafschaft Shrewsbury an Robert de Belleme verkauft – für dreitausend Silbermark.«
»Was!«, rief Miles schon zum zweiten Mal, und seine Bedenken verwandelten sich in Bestürzung. »Der König würde ihm doch nicht gestatten, das Land zu erben! Angesichts dessen, was er bereits besitzt und was er für ein Mann ist – das wäre viel zu gefährlich.«
Guyon nahm die Seife und den Lappen, den Emma ihm reichte. »Jeder Mann hat seinen Preis, und de Belleme hat den von Rufus als bezahlbar gefunden«, sagte er mit einer Grimasse. »Er wollte Ravenstow ebenfalls, da es immerhin seinem Halbbruder gehörte. Und er hätte es bekommen, wenn sich Fitz-Hamon nicht daran erinnert hätte, dass die Erbin ein unverheiratetes Mädchen von heiratsfähigen sechzehn Jahren ist. Also hat sich der König entschlossen, sie mir zu bestimmen, und sicher mit boshaftem Vergnügen.« Er begann sich heftig zu waschen, als könnte er sich damit von den Gedanken reinigen, die ihm durch den Kopf jagten.
»Das kannst du nicht machen!« Emmas Mundwinkel zuckten vor Empörung. »Wenn du das Mädchen heiratest, wirst du mit diesem Monstrum blutsverwandt. Ein jeder weiß, wie übel dieser Mann ist. Er raubt und foltert zum Spaß, und er steckt diejenigen, die ihm aus irgendwelchen Gründen nicht passen, auf gefettete Stangen und schaut grinsend zu, wie sie sterben. Mein Gott, er sperrt seine eigene Frau in die Gewölbe unter der Burg ein, mit nichts als Ratten zur Gesellschaft!« Sie schauderte und schlang sich die Arme um die Brust. Und Guyon konnte nicht behaupten, dass sie zu stark reagierte. Denn selbst in einem Zeitalter wie diesem, wo die Gewalt regierte, schreckten auch die Brutalsten vor den sadistischen Grausamkeiten von Robert de Belleme zurück, dem ältesten Sohn des verstorbenen Roger de Montgomery, des Earls von Shrewsbury.
Nicht die Art und Weise, wie er seine Dienstboten behandelte – ihre Leben waren allgemein nicht viel wert –, sondern die Foltern, die er adeligen Gefangenen angedeihen ließ, welche ohne Weiteres ein Lösegeld hätten zahlen können, erregten die Menschen, doch das interessierte ihn nicht, denn er kannte keine Autorität außer der seinen.
»Wenn ich nicht in diese Heirat einstimme, Em, dann verliere ich auch das Land von Onkel Gerard, und beides geht an einen der flämischen Freunde des Königs.« Er ließ die Seifenschüssel im Bad schwimmen und schaute zu, wie sie schaukelte. »Ich stecke in einer Zwickmühle. Nicht nur, dass mir Rufus zwangsweise ein Weib fürs Bett verpasst, er lässt mich auch noch dafür bezahlen – fünfhundert Silbermark. Sicher, das sind weniger als dreitausend, aber genug, dass meine Lehensbauern jammern werden, wenn ich ihnen das Geld abpresse. Belleme kann sich glücklich schätzen, dass er kein Gewissen hat.«
Emma schauderte und bekreuzigte sich.
»Und natürlich bilden die Ländereien, die du hast«, sagte Miles und verengte die Augen, »zusammen mit denen, die du aus der Ehe gewinnst, ein ausreichendes Gegengewicht in den mittleren Marken, falls es de Belleme einfallen sollte, sich das alles unter den Nagel zu reißen.«
»O ja«, erklärte Guyon mit Nachdruck. »Auch für dieses Privileg werde ich zahlen müssen – vielleicht mit meinem Leben.«
Danach herrschte gespanntes Schweigen. Emma stieß einen Seufzer aus, der auch ein unterdrücktes Schluchzen sein konnte, murmelte etwas von Essen und Wein und floh aus dem Raum.
Miles seufzte ebenfalls und setzte sich mit behänden Bewegungen auf einen Hocker. Mit seinen vierundfünfzig Jahren hatte er körperlich wenig Last; er war beweglich und geschmeidig geblieben, wenn auch vielleicht etwas untersetzter als in seiner Jugendzeit.
»Ich kenne die Mutter des Mädchens«, murmelte er nachdenklich. »Alicia FitzOsbern, die Schwester von Breteuil. Sie war mit fünfzehn ein hübsches Ding – sehr hübsch sogar. Wenn ich damals nicht schon mit deiner Mutter verheiratet gewesen wäre – glücklich verheiratet –, dann hätte ich ihr vielleicht einen Antrag gemacht.«
Guyon knurrte. »Ich dachte, du hättest seit jeher nichts übrig gehabt für den FitzOsbern-Clan.«
»Das gilt für die Männer. Sie waren alle – und sind es noch, wenn du dir Breteuil vor Augen hältst, falsch wie die Schlangen. Aber Alicia war anders. Sie hatte einen mutigen und zugleich sanften Charakter, dazu Augen wie wilde Veilchen. Sie hat den Männern ihrer Familie nie verziehen, dass man sie bei der Heirat an einen so brutalen Kerl wie Maurice de Montgomery verkauft hat.«
Guyon langte nach dem Handtuch, das Emma in Reichweite gelegt hatte, und stieg aus der Wanne. »Grund genug für jede Frau, die Männer zu hassen, würde ich annehmen«, bemerkte er trocken und dachte an den früheren Lord von Ravenstow, der mehr an einen wilden Eber als an einen Menschen erinnert hatte.
»Wenn ich mich richtig erinnere, ist Judith erst spät geboren worden, nach zahllosen, vergeblichen Versuchen, bei denen man Alicia die Schuld zugeschoben hat«, erinnerte sich Miles und verschränkte die Arme. »Ich bezweifle allerdings, dass es ihre Schuld war. Aber wie ich ihn kannte, hätte Maurice trotz seiner eigenen Fehltritte niemals einen Bastard als rechtmäßigen Nachfolger anerkannt.«
Guyon zog sich ein pelzbesetztes Nachthemd an und rief zwei Diener herein, die das Wasser aus der Wanne gossen, durch einen Abfallschacht in der einen Ecke des Raums.
»Wenigstens ist Ravenstow ein ordentlicher Besitz, von dem aus du deine Herrschaft ausbreiten kannst«, bemerkte Miles auf Guyons Schweigen und dachte an das wuchtige neue Fort über dem River Dee. »Was für Sünden man Bellemes Seele auch zur Last legen mag, er ist ein meisterhafter Festungsarchitekt.«
»Und ich habe den Verdacht, dass er früher oder später versuchen wird, die Burg in seine Grafschaft einzubeziehen. Immerhin hat Ravenstow eine Schlüsselstellung inne zur Ebene von Chester und zu allen Straßen, die in den Osten führen.« Guyon warf ihm einen Blick zu, unter gesenkten Brauen. »Ideal geeignet für Räuberei und Erpressung, meinst du nicht auch?«
Miles schaute ihn an und erkannte die Unsicherheit hinter der schnippischen Fassade. Es war etwas, das er ihm vererbt hatte.
»Es gibt notfalls immer noch das Heilige Land«, fügte Guyon hinzu, mit einem schiefen Lächeln. »Freiheit von Rufus und de Belleme, und der Ruhm, die Ungläubigen zur höheren Ebene der eigenen Seele zu schlachten.«
»Hör sofort auf damit, Guyon! Das ist Gotteslästerei!«
»Wäre es dir vielleicht lieber, wenn ich heule, mich am Zipfel des Altartuchs festhalte und dort Zuflucht suche?«, zischte er den Vater an.
»Ja, vielleicht«, erwiderte Miles, ungerührt von dem Zornesblitz in den feurigen, braunen Augen. Guyon verfügte über einen königlichen Unmut, aber auch die Kontrolle, um ihn zurückzudrängen. »Es wäre zumindest besser als ...« Er brach ab und atmete tief ein, als Emma zurückkam, gefolgt von einem Mädchen, das Essen und Wein auf einem Tablett bei sich hatte.
Guyons Lippen pressten sich zusammen. Er ließ sich auf einen Stuhl mit harter, hoher Lehne nieder.
»Rhosyn ist in der Halle«, verkündete Emma, während sie das Mädchen entließ und den Wein selbst einschenkte. »Du wirst es ihr sagen müssen.«
Guyon warf einen müden, erschöpften Blick auf seine Schwester, als er den Becher entgegennahm, und trank. »Was ist mit ihr? Als ich sie zuletzt zu Michaeli sah, wollte sie nicht bleiben und machte mir klar, dass sie an nichts weiter interessiert war als an dem üblichen Beisammensein zwischen den Bettlaken. Sie hat keinen Grund, beleidigt zu sein.«
»Sie hat vielleicht keinen Grund gehabt zu Michaeli, aber jetzt hat sie einen«, erwiderte Emma dunkel.
»Nämlich?« Guyons Müdigkeit verstärkte sich.
»Damit will ich sagen, dass sie kein so erfahrenes Kräuterweib ist, wie sie dachte, was die Rundung ihres Bauchs beweist. Spätestens zum Mittsommer ist es so weit, würde ich meinen.«
Guyon blickte von der schmollenden Entrüstung seiner Schwester auf die Ahnungslosigkeit seines Vaters. Er trank noch einen Schluck Wein und zuckte mit den Schultern. »Also gut, ich rede morgen mit ihr, aber ich sehe nicht ein, dass diese Heirat irgendetwas ändert. Ich erkenne das Kind an und bin auch bereit, dafür zu sorgen – aber ihr kennt doch Rhosyn – sie tut doch immer nur das, was ihr passt.«
»Ich denke weniger an das, was ihr passt, sondern was dem walisischen Recht passt«, erwiderte Emma, als sie nach einem Stück Brot langte. »Der erstgeborene Sohn eines Mannes, auch wenn er ihn unehelich von einer Mätresse empfängt, hat die gleichen Rechte wie die anderen, legitimen Nachkommen aus seinem Samen.«
Guyon kaute und schluckte, dachte einen Moment lang nach und schüttelte den Kopf. »Ich bin unter normannischem Recht geboren, Emma, und die walisischen Gesetze gelten nicht auf dieser Seite der Grenze, so leid es mir tut. Außerdem ist das Kind ja noch nicht geboren und kann ebenso gut ein Mädchen werden. Das letzte Kind, das ich von einem Küchenmädchen in Windsor bekam, war ein Mädchen.«
Emmas volle Lippen wurden eine schmale Linie. »Wann war das?«, fragte sie in eisigem Ton.
»Im letzten Frühjahr, vor dem Feldzug nach Wales. Das Baby ist keine Woche alt geworden.«
»Du bist nicht knausrig mit der Verteilung deiner Gunst, wie?«, fuhr sie ihn an. »Oder habt ihr beide, du und Prinz Henry, Wetten abgeschlossen, wer von euch mehr Bastarde zustande bringt?«
»Ach, sei doch nicht so prüde, Emma!«, knurrte er. »Du weißt, wie es bei Hofe zugeht. Also, ich gehe lieber in die Hölle für die Sünde der Unzucht als für die Sünde des Königsmords.«
Farbe strömte in ihr Gesicht. Ihr Mann, als rechte Hand des Großkämmerers, wusste, was im Umkreis des Königs vor sich ging: Er kannte die Skandale, die lächerlichen, kleinen Machtkämpfe, die Laster – und Guyon mit seinen hübschen, arroganten Zügen, seinem geringen Interesse für Besitz und einem Anflug walisischen und märkischen Barbarentums war geradezu ein Magnet für alle drei höfischen Fehler, ob er es wollte oder nicht.
Miles erhob sich taktvoll und streckte sich wie eine Katze, die lange zusammengerollt dagelegen hat. »Für diese Diskussion ist morgen noch Zeit genug«, sagte er. »Ich bin jetzt für’s Bett, damit mich nicht das Morgengrauen noch erwischt.« Er schaute seine Tochter nachdrücklich an.
»Eine Verschwörung der Männer«, erklärte Emma mit einem hochmütigen Schniefen, dem sie ein kleines Lächeln folgen ließ. »Ich weiß, wann ich mich geschlagen geben muss.« Sie ging zu ihrem Bruder hin, beugte sich zu ihm hinunter und küsste seine stoppelige Wange.
»Wie ich dich kenne, heißt das nicht, dass du nachgibst«, sagte er lachend und zupfte sachte an ihrem dicken, kupferfarbenen Zopf.
»Nein?« Sie zog die Brauen hoch, als sie ihn anschaute. »Pass auf, ich gebe diesen Kampf gern an deine Zukünftige weiter und hoffe, dass sie mehr Glück hat dabei als ich, den Luftikus in dir zu zähmen.«
»Du weißt, wann du dich geschlagen geben musst, hast du vorhin gesagt!« Er lachte, als er auf den Vorhang zuging. »Hast du deshalb immer das letzte Wort?«
Zweites Kapitel
In der schwach beleuchteten großen Halle warf sich Rhosyn auf ihrem behelfsmäßigen Lager herum und setzte sich dann auf – verärgert, dass ihre Blase schon wieder voll war. Neben ihr lag ihr Vater, tief in Schlaf versunken. Er war ein wohlhabender Wollhändler, und der Ansatz eines Bauches legte dafür Zeugnis ab. Selbstgefällig. Es ging ihnen gut, seit sie mit Miles, dem Lord von Milnham und Ashdyke, Geschäfte machten. Wolle brachte guten Profit, und auch der Stoff, der daraus gewoben wurde. Lord Miles züchtete sie direkt ab Huf. Ihr Vater verkaufte das Tuch in Flandern und spekulierte ein bisschen mit anderen Märkten – Gewürze und Leder, Seide und tyrisches Glas –, und sie wurden reich dabei.
Neben ihrem Großvater schliefen die Kinder aus ihrer ersten, jetzt verwitweten Ehe wie Hündchen in einem Korb. Rhys war zehn, ein stämmiges, dunkeläugiges Abbild seines Vaters. Eluned, erst sieben, erinnerte mehr an die Mutter, also an sie selbst: schlank und lebhaft mit blauschwarzem Haar, Augen in den Herbstfarben und mit einem rosigen, strahlenden Teint. Und das Kind in ihrem Leib: Wenn es ein Junge wurde, so konnte sie nur bei Gottes Güte hoffen, dass er Guyons Schönheit erbte, aber nicht seinen komplizierten Charakter.
Wie dumm, dachte sie ärgerlich, während sie hinausschlich, um den Abtritt zu finden, wie dumm, sich so erwischen zu lassen: sie, die alle Kräuter kannte oder zu kennen glaubte, weil es bisher immer funktioniert hatte. Jetzt war es zu spät, zu gefährlich, außerdem wuchsen die Pflanzen zurzeit nicht, die sie ganz sicher von weiterem Nachwuchs kuriert hätten.
Sie hatte sich lange überlegt, ob sie diese Reise nach Heresford mit ihrem Vater unternehmen sollte, aber dann hatte sie sich gesagt, dass es ihre letzte Gelegenheit war, bevor das Wetter zu unwirtlich zum Reisen wurde, und sie brauchte noch Leinen für die Bänder, die sie in den dunklen Wintermonaten, in denen man im Haus bleiben musste, sticken wollte. Das eiskalte Wetter und die Schneeschauer hatten sie gezwungen, ihre Reise zu verkürzen und für die Nacht hier auf Ashdyke Zuflucht zu suchen.
Guyons Erscheinen zur Dämmerung war eine Überraschung gewesen, und sie wusste nicht, ob es eine willkommene war. Die Nachricht seiner bevorstehenden Heirat hatte ihr keinen Kummer bereitet. Sie hatte immer gewusst, dass der Tag kommen würde, ja, sie hatte sich sogar ein bisschen darauf gefreut. Er war immerhin Erbe eines beträchtlichen Landbesitzes und hatte die Pflicht, sich eine Frau seines Standes zu suchen und mit ihr Kinder großzuziehen, eine Frau, mit der er mehr gemeinsam hatte als mit ihr.
Rhosyns praktische Grundlagen, die sie aus ihrer Händlersfamilie hatte, sagten ihr, dass es keinen Sinn gehabt hätte, ihre Beziehung auszubauen. Trotz all seiner Schönheit, des attraktiven Körpers und seiner Raffinesse im Bett war er nur zu einem Viertel ein Cymru und zu einem Lord in den Marken erzogen worden, der immerhin auf dem Rücken eines Schlachtrosses nach Wales ritt, um das Land zu verwüsten, wenn sein König es ihm befahl. Er betrachtete die mit Türmen besetzte Grenze der Normannen als seine Heimat und Zuflucht, nicht als graue Gefängnismauern, die einen in der Seele hemmten und schadeten.
In der Garderobe, wie man den Raum beschönigend nannte, war es kalt und stank nach der Hauptfunktion; daher blieb sie nicht lange. Aber statt zurückzuschleichen in ihr Bett, ging sie in Richtung der privaten Gemächer. Sie wusste, welche Kammer man Guyon gegeben hatte, denn Cadi, seine junge, weiße Hündin, lag davor, zusammengerollt, dass die Nase neben der Rute zu liegen kam. Sie erhob sich mit freudigem Gewinsel, als sie Rhosyn begrüßte, und diese streichelte das Tier eine Weile, ehe sie den schweren Vorhang lüftete.
Guyon war tief im Schlaf gewesen, aber er war rasch erwacht, als er die Vorhangringe klimpern und den Hund leise winseln hörte. Das war das Schloss, in dem er aufgewachsen war, hier freute man sich über seine Rückkehr, aber seine Gedanken und sein Körper waren so an Gefahren gewohnt, dass er innerhalb von fünf Herzschlägen aus dem Bett und am Vorhang war.
Ein Schatten flackerte über die schwache Fackel im Gang. »Guyon?«, fragte eine Stimme zweifelnd, stieß dann einen gedämpften Schrei aus, als sie von hinten gepackt wurde.
»Ich bin’s, Rhosyn!«, keuchte sie, und in ihrem Französisch lag der lispelnde Akzent von Wales. »Bist du verrückt?«
»Eher schon du!«, erwiderte er, aber mit Amüsement, jetzt, da er voll wach war und ihren weichen, schlanken Körper an dem seinen fühlte. »Es ist Wahnsinn, sich mitten in der Nacht an einen Mann anzuschleichen, cariad. Ich schlafe oft mit einem nackten Schwert an meiner Seite. Ich hätte dir den Kopf abhauen können!«
»Ich habe dein nacktes Schwert oft genug gesehen, als dass ich davor Angst hätte«, erwiderte Rhosyn mit gespielter Naivität und drückte sich dabei gegen ihn in der Dunkelheit, fühlte, wie die vertraute, süße Verwirrtheit ihre Adern durchströmte. Sie fuhr mit den Fingern durch sein dichtes Haar, stellte sich auf die Zehenspitzen, um ihn ins Ohrläppchen zu beißen, und flüsterte: »Aber vielleicht ist es sicherer, wenn Ihr es in die Scheide steckt, Mylord.«
Guyon lachte mit tiefer Stimme. »Und bis ans Heft«, murmelte er, bevor er sich hinunterbeugte, um ihre willig dargebotenen Lippen zu küssen, während seine Finger sich mit den Verschnürungen ihres Nachthemds befassten.
Rhosyn streckte sich lüstern wie eine Katze und entspannte sich dann, ein zufriedenes, kleines Lächeln um die Lippen. »Ich hatte schon ganz vergessen, wie viel Spaß das macht«, schnurrte sie und schaute Guyon von der Seite an, im schwachen Licht der Kerze, über das beiseite geworfene Bettzeug hinweg.
»Selbst schuld«, bemerkte er, aber leicht, ohne Anklage. »Ich hätte dich ohne Weiteres mitgenommen.«
»Und ich wäre unter all den normannischen Frauen aufgefallen wie ein bunter Hund und hätte mich miserabel gefühlt wie die Sünde.«
»Die Sünde ist nie miserabel.« Guyon kicherte und bekam dafür einen Klaps aus Liebe. Er packte ihr Handgelenk, zog sie zu sich her und erwiderte den Klaps auf ihren Hinterbacken. Sie warf sich über ihn, fühlte, dass er noch halbsteif war, und wusste einen Moment lang nicht, was sie tun sollte, dann machte sie sich frei, setzte sich auf und betrachtete ihn durch den Vorhang ihres Haars.
Er hatte die leicht olivfarbene Haut seiner walisischen Großmutter, und auch das Haar war keltisch wie seine Augen, dunkle, leuchtende, braune Teiche. Er hätte leicht als Cymru durchgehen können, wenn man von seiner anglonormannischen Größe und den breiten Schultern abgesehen hätte.
»Was schaust du?«, fragte er und lächelte.
Ihr Blick schweifte über das Ganze, und sie musste lachen. »Ich komme mir vor wie ein Bettler beim Fest. Die gebotenen Köstlichkeiten überwältigen meinen Appetit.«
Guyon grinste, doch der Ausdruck erreichte nicht ganz die Augen, die sie ernst anschauten. »Ich höre, dass du ein Kind bekommst?«, fragte er leise.
Auch aus ihren Augen verschwand das Lachen. Sie hob verteidigend das Kinn in die Höhe. »Na und?«
»Hättest du es mir gesagt?«
Rhosyn biss sich auf die Lippen. »Wahrscheinlich«, sagte sie und senkte den Blick vor seinen prüfenden Augen. »Mein Vater und der deine machen zu viel gute Geschäfte miteinander, als dass man die Sache geheim halten könnte, und Rhys und Eluned sind beide alte Klatschbasen. Sie wären früher oder später dahintergekommen.«
Guyon betrachtete sie nachdenklich, fühlte ihre Zurückhaltung und auch, wie es ihm an die Nieren ging. »Meine Schwester glaubt, dass du für das Kind walisisches Recht angewendet wissen willst«, murmelte er leidenschaftslos.
Die schönen, grünen Augen wurden groß.
»Der erste Sohn einer jeden Küchenhilfe ist einem jeden legal geborenen Sohn gleichgesetzt«, erklärte er, als sie ihn verständnislos anstarrte.
Sie schüttelte den Kopf; ihre Miene wirkte fast erschreckt. »Da irrt deine Schwester. Was würde mir das schon nützen, diesseits der Grenze, wo die Normannen herrschen?«
»Emma hat aus dem Blickpunkt einer normannischen Frau gesprochen«, sagte er. »Sie überlegt sich, was sie in deiner Position tun würde, und ich weiß, sie würde mit Zähnen und Klauen dafür kämpfen, dass das Kind meiner Verantwortung zugerechnet wird.«
Rhosyn schnitt eine Grimasse und erinnerte sich an Emmas frostige Blicke, als sie die provisorischen Betten in der Halle aufgestellt hatten.
Die Nachtkerze spuckte und sprühte Funken, und Guyon streichelte Rhosyns Haar. »Uns geht es aber nicht um Emma, sondern um dich«, sagte er und schaute sie an, suchte nach einem Zeichen ihrer Mutterschaft. Vielleicht waren ihre Brüste ein wenig voller, und ihr Bauch war nicht mehr konkav.
Rhosyn schaute müde drein, bevor sie die Lider senkte.
»Ich versuche, durch Fehler klug zu werden«, sagte er leise, als er ihre Angst erkannte. »Ich will nicht versuchen, dich zu halten, obwohl es mein größtes Vergnügen wäre.«
»Meinst du, wegen deiner Braut?«, fragte sie ohne Groll.
Guyon schnitt eine Grimasse. »Das weißt du schon? Ach Gott, ja, wieso solltest du es nicht wissen, wenn meine Männer unten in der Halle schon von nichts anderem mehr reden. Rhosyn, cariad, du bist gut dran, wenn du dich da raushältst. Nimm die Straße nach Wales und schau dich nicht um, in Gottes Namen.«
»Guyon?«
Er schaute sie an mit einem Blick, ganz ohne Humor, dafür dunkel und grimmig. »Du hast es also schon gehört. Ich soll ins Haus Montgomery einheiraten. Es ist der Befehl des Königs, und die Mutter des Mädchens ist eine alte Bekannte meiner Familie. Meine Weigerung würde sie in tödliche Gefahr bringen, vonseiten Roberts de Belleme, des neuen Earls von Shrewsbury. Wenn er es fertigbringt, seine eigene Frau in einem Verlies darben zu lassen, und wenn er es fertigbringt, seinem eigenen Pflegesohn die Augen auszustechen – was wird er sich da lange Gedanken machen, seine Schwägerin und seine Nichte den hohen, hehren Zinnen von Ravenstow zu opfern? Es geht da um Macht, Rhosyn, und du halte dich da heraus, so gut es geht. Wenn dein Vater seine Geschäfte hier in Heresford oder wo auch immer erledigt hat, dann geh nach Hause mit ihm, setz dich an den Ofen und vergiss, dass du jemals auf der anderen Seite der Grenze warst, es sei denn, du hast eine Armee zu deinem Schutz und deiner Bewachung. Robert de Belleme und seine Leute werden die Marken für jemanden wie deinen Vater sehr bald in eine Hölle verwandeln.«
Rhosyn schauderte, wollte glauben, dass er übertreibe, doch sie versagte sich diesen Trost. Seine Zunge mochte lügen, aber der Ausdruck in seinen Augen sprach die reine Wahrheit.
»Ich rede morgen mit deinem Vater, ehe sich für uns die Wege trennen, und schärfe ihm ein, dass er nur auf unserem Land reisen und keine Abkürzungen über die Domäne von Shrewsbury machen darf.«
»Ist es wirklich so gefährlich?«
»Ja. Ich meine, was ich sage, Rhosyn. Entweder ihr geht ins Herz von Wales und kommt nicht wieder her, oder ihr bleibt bei mir, in der Sicherheit von einem meiner Besitztümer. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht.«
Sie schüttelte wie betäubt den Kopf. Er berührte ihren Arm und bemerkte, wie kalt sie war, zog sie zu sich her und nahm sie in seinen Arm, dazu legte er die Decke über beide. Sie drückte sich an ihn und fühlte diese Mauer aus Muskeln, die ihr wenigstens eine Illusion von Sicherheit vermittelte.
Das also war das Ende. Sie konnte nicht auf Dauer in einer dieser großen, grimmigen Normannenburgen wohnen. Sie brauchte ihr Maß an Freiheit. Wenn er sie und ihr Kind sehen wollte, musste er sich schon nach Wales bemühen.
»Ffarwel fy llewpart du«, murmelte sie an seinem Hals und küsste ihn, erst auf das dunkle Grübchen, dann auf die Lippen. »R wy’n dy garu di.«
Guyons Arme schlangen sich um sie, als ihr Kuss leidenschaftlicher wurde, und ihre Körper fingen erneut Feuer; zugleich fühlte Guyon das prickelnde Brennen unvergossener Tränen hinter den Lidern. »Ich liebe dich auch, cariad«, murmelte er mit belegter Stimme, und dann verfluchte er stumm den Clan der Montgomerys und wünschte sie alle in die tiefste Hölle.
Drittes Kapitel
Judith biss die Zähne zusammen und sog die Luft ein, als Agnes, die Zofe ihrer Mutter, den Elfenbeinkamm durch das hüftlange, hell bronzefarbene Haar zog und dabei auf eine bis dahin nicht entdeckte Verfilzung stieß.
»Steh still, Liebes, dann tut es nicht so weh«, sagte die Zofe, einen Hauch von Verzweiflung in der Stimme, während ihr der Schweiß über die drei wabbelnden Kinne lief. »Wir sind schon fast fertig.«
»Du sollst mich nicht wie einen Säugling behandeln!«, fuhr ihr Schützling sie an. Judith trat von einem Fuß auf den anderen wie ein Pferd, das nervös unter dem Sattel zappelt. Sie hatte sich so wenig unter Gewalt, dass man befürchten konnte, sie würde weiß Gott was anstellen, wenn sie sich nicht zügelte, bevor sie ihrem zukünftigen Ehemann entgegentrat.
Judith blickte hinunter auf ihr Hochzeitskleid: ein blassgrüner Unterrock aus Leinen, der glatt auf ihrem schlanken, fast mageren Körper lag, und ein Überrock aus einem schweren Seidendamast, der dunkler grün war als der Unterrock, dazu üppig bestickt mit Goldfäden oben am Kragen, unten am Saum und an den Ärmeln. Um die Taille trug sie einen Gürtel aus Bronzegliedern, die mit Schmucksteinen besetzt waren. Sie kam sich vor wie der Hauptgang bei einer Mahlzeit, mit großer Mühe herausgeputzt, um anschließend verschlungen zu werden.
In ein paar Stunden würde sie in der Kapelle einem Mann das Jawort geben, den sie nie zuvor von Angesicht gesehen hatte. Sie würde ihr Heim verlassen und mit ihm gehen, sein Eigentum mit ihm teilen, wie es ihm beliebte, von ihm abends ins Bett gebracht werden und vielleicht in neun Monden sein Kind gebären. In einer Woche erst wurde sie sechzehn, und sie hatte Angst. Sie wusste, wie viel ihre Mutter hatte erdulden müssen von den Händen ihres Vaters, bevor er im September gestorben war. Das Knurren, die Flüche, die häufigen Schläge, die Prügel, wenn er betrunken war, die Verachtung, die an den Grundfesten des Vertrauens rüttelte. Ihre Mutter hatte versucht, das Schlimmste von der Tochter abzuwenden, aber Judith hatte es gewusst, hatte diese Hölle genau beobachtet und konnte den Gedanken nicht ertragen, dass dies nun auch ihr Geschick sein würde.
»Steh still, Liebes«, sagte Agnes. »Lass mich das hier in dein Haar stecken, sei ein gutes Mädchen.«
Die Finger der Zofe zupften und zerrten, während sie versuchte, die Nadel zu befestigen. Wut flammte auf in Judiths Brust, nicht nur auf Agnes, sondern auf alles. Sie hob ihre Hand und schlug die Hand von Agnes zur Seite. »Du hättest eine Schlachtersfrau werden sollen, nicht die Zofe einer Lady!«, fuhr sie sie an.
Beleidigt begann Agnes sich aufzuplustern und zu gackern wie eine Henne.
Der Vorhang klickte sachte an den Ringen, und Alicia de Montgomery betrat den Raum. Ihr Gang hatte immer noch das elegante Gleiten aus ihrer Jugendzeit. Sie überblickte die Szene und die gespannte Atmosphäre, und die leichten vertikalen Falten zwischen ihren Brauen wurden deutlicher.
»Danke, Agnes, du hast Wunder vollbracht. Aus unserem Entchen ist ein Schwan geworden. Gehst du jetzt hinunter und lässt für heute Abend von einem der Mädchen frische Kerzen nachstecken?«
Die Zofe wusste, wann sie überflüssig war, und sie bedauerte es nicht, gehen zu müssen. So gern sie Lady Judith mochte, war Agnes auch klar, dass der Umgang mit ihr in letzter Zeit schwierig war, in diesem unangenehmen Stadium zwischen Kind und Frau – wobei sie die eine wie die andere Identität mit Unwohlsein betrachtete.
»Agnes ist manchmal ein alter Besen«, sagte Alicia, als die beiden Frauen allein waren, »aber trotzdem darfst du sie nicht so hart behandeln. Habe ich dir das nicht oft genug gesagt? Eines Tages wirst du genauso schlimm sein wie dein Vater.«
Judith biss sich auf die Unterlippe, hielt das Kinn hoch, um nicht zu zittern, und blinzelte heftig. »Entschuldige, Mama«, sagte sie etwas unsicher, »aber sie hat mir wehgetan, und ich bin mir vorgekommen wie ein Fohlen, das für eine Pferdeschau gestriegelt wird.«
Alicias Mundwinkel zuckten. In Anwesenheit ihres Vaters, der an die Unterwerfung des Weibes geglaubt hatte, wäre sie sanft gewesen wie Butter, doch Alicia war sich voll ihres rebellischen Geistes bewusst, der unter der pflichtgebotenen Unterwürfigkeit schlummerte.
Alicia küsste ihre Tochter, strich ihr sachte übers Haar, trat dann einen Schritt zurück, schaute in die Augen ihres Kindes – und sah darin das hoffnungslose Elend eines gejagten Tiers, das schließlich in die Enge getrieben worden ist.
»Diese Heirat ist zu politischen Zwecken von Männern bestimmt worden, aber sie ist ein Segen für dich, den du vielleicht erst später verstehen wirst. Der Mann, dessen Sohn du heiraten wirst ... Ich wäre selbst beinahe einmal seine Braut geworden. Und ich wünschte, ich wäre so glücklich gewesen.«
Judith schaute ihre Mutter aus großen, runden Augen an.
»Er war schon verheiratet«, sagte Alicia, wandte sich um und glättete eine Falte an ihrem Kleid. »Dein Großvater FitzOsbern hat mich ihm angeboten, als seine eigene Frau bei einem Überfall der Waliser verschleppt worden war, aber Miles ist über die Grenze gegangen und hat sie sich zurückgeholt. Dein Großvater war wütend, dass seine Pläne so durchkreuzt worden waren. Ich war glücklich für Miles – er hat Christen sehr geliebt –, aber ich habe mich danach wochenlang in den Schlaf geweint.« Sie nahm ihren Spiegel mit dem Elfenbeinrücken und schaute in das schimmernde Glas. Was sie darin sah, war nicht die schöne, reife Frau von vierundvierzig Jahren, sondern das blühende Mädchen mit fünfzehn und den dunklen, düster dreinschauenden Herrn von Milnham, der nur Augen hatte für seine flachsblonde, englische Frau.
Sie hatte sich nie erholt von diesem ersten Stich des Herzens in ihrer frühen Mädchenzeit, der umso schlimmer wurde, als sie mit sechzehn Maurice de Montgomery heiraten musste, einen Mann, der sie bei der kleinsten Übertretung verprügelte und gegenüber seiner jungen Frau insgesamt die Brutalität eines stinkenden, verkommenen wilden Ebers an den Tag legte.
»Ich weiß nicht sehr viel über Guyon«, sagte sie, »aber mit Miles und Christen als Vorbilder dürfte deine Ehe jedenfalls leichter zu ertragen sein als die meine.« Dazu zuckte sie mit den Schultern. »Wären die Umstände anders gewesen, dann hätte man euch Zeit gelassen, euch vor der Hochzeit kennenzulernen, aber so, wie die Sache steht, ist es besser, du hast einen starken Beschützer, wenn dein Onkel Robert kommt, um seine Grafschaft zu reklamieren. Es ist so weit – schon sammeln sich die Geier.«
Judith schaute von der Seite auf ihre Mutter, deren Ausdruck gar nichts verriet. Sie kannte die Gerüchte um Robert de Belleme. Die Mädchen erschreckten einander abends mit Schauergeschichten über seine Brutalität, und Judith verstand mehr Englisch und Walisisch, als für ein Mädchen ihrer hohen Bildung schicklich war. Sie sagten, er quäle die Menschen zum Spaß und sei ein gewissenloser Räuber und Mörder. Sie sagten auch, dass er einen gespaltenen Schweif habe und einen Pferdefuß, aber Judith glaubte den Gerüchten nicht. Was brauchte man Dinge zu erfinden, wenn die Wahrheit schon schlimm genug war?
Robert de Belleme hatte Ravenstow selbst entworfen und ihrem Vater das Geld geborgt, damit die Burg gebaut werden konnte. Ihre Familie war bis zu diesem Tag bei den de Bellemes mit mehreren Hundert Silbermark verschuldet. Judith wusste, dass ihre Mutter befürchtete, er würde kommen und es zurückfordern, nachdem er selbst dem König Geld schuldete. Das war überhaupt der Grund, weshalb diese Heirat so schnell arrangiert worden war – bevor de Belleme die Gelegenheit bekam, die Hand auszustrecken, den Rest auf einmal einzustreichen oder ihnen die Daumenschrauben anzulegen.
Judith schauderte. Die Hochzeit war als kleine, private Feier geplant gewesen, mit einer bescheidenen Auswahl von Gästen und Vasallen, aber de Bellemes Bruder Arnolf von Pembroke war am vergangenen Abend eingetroffen und mit ihm Walter de Lacey, ein mächtiger Vasall von de Belleme, Jagdgenosse ihres Vaters und früher Anwärter auf ihre Hand und den Besitz von Ravenstow. Ihre Mutter war in Verlegenheit, als sie für die beiden Plätze zum Übernachten bereitstellen und sie freundschaftlich willkommen heißen sollte, denn es schien klar, dass sie nicht als Gäste gekommen waren, die ihnen zur Hochzeit gratulieren wollten. Andererseits war es unmöglich, sie abzuweisen, und ihre Mutter hatte Mühe, die offiziell Eingeladenen wie Hugh d’Avrenches, den Earl von Chester, und FitzHamon, den Lord von Gloucester, standesgemäß unterzubringen.
Der Vorhang raschelte, und Agnes kam zurück, gefolgt von einem Mädchen, das einen Korb mit neuen Kerzen bei sich hatte. »Sie sind schon gesichtet worden, M’lady. Sie treffen noch diese Stunde hier ein, sagt de Bec«, verkündete Agnes und gab dann mit einem dicken, warnenden Finger ihre Befehle an das junge Mädchen weiter.
Der ganze Raum schwamm vor Judiths Augen, und die Wände schienen auf sie zu zukommen, sodass sie kaum noch Luft zum Atmen hatte. Ihr war heiß, aber ihre Hände fühlten sich kalt an wie Eis. »Agnes, es tut mir leid, ich hätte dich nicht schlagen dürfen ...« Sie verstummte und streckte die Hand aus. Dann drehte sie sich rasch um und lief davon.
Alicia und Agnes riefen ihr nach, doch Judith war schon davon, rannte die gefährlichen, engen Stufen hinunter.
»Soll ich ihr nachlaufen, Mylady?«
Alicia überlegte und warf einen Blick auf den erst jetzt wieder ruhig gewordenen Vorhang. »Nein, Agnes«, sagte sie langsam. »Wir haben ihr heute ohnehin genug zugemutet. Sie soll ruhig eine Weile allein sein. Es wird ohnehin ihre letzte Chance sein.«
»Sie ist einfach noch nicht bereit«, sagte Agnes grimmig. »Man sagt, er kennt sich aus bei den Frauen vom Hof und spielt mit den Gattinnen anderer Männer.«
»Alles Gerüchte«, fuhr Alicia sie an. »Und du solltest so etwas nicht anhören, Agnes. Schau mich nicht so bedauernd an. Ich bin nicht so naiv, dass ich dem Geschwätz der Dienstboten glaube. Natürlich hat er ein paar Geliebte gehabt, aber diese Geschichten werden immer furchtbar aufgebauscht, und ich glaube ihm und seiner Herkunft mehr als dem ganzen Geschwätz aus dritter Hand. Außerdem, wie auch seine Ehe mit Judith sein wird, sie wird bestimmt nicht schlimmer als das Schicksal der Frau seines Onkels Robert oder auch der von Walter de Lacey. Also muss sie eben dazu bereit sein.« Und Alicia wandte sich von ihrer Zofe ab, auch wenn ihr Blick ihre Zuversicht Lügen strafte.
Als Judith wieder zu Sinnen kam, hatte sie Seitenstechen und lehnte sich gegen einen Felsklumpen; der Atem rasselte in ihrer Kehle, ihr Haar war zerwühlt, und ihr Kleid wies einen dunklen Fleck auf, der sich vom Saum aus nach oben ausbreitete, wo sie kopflos durch eine Pfütze im Burghof gelaufen war. Die vergoldeten Schuhe waren durchnässt, und ihre Zehen klebten zusammen.
Der Eiswind wehte ihr um den Kopf. Judith begann zu frösteln. Ihr neuer Mantel mit dem warmen Biberpelzfutter hing an seiner Stange in der Kammer, aus der sie geflohen war, und nichts auf der Welt brachte sie dorthin zurück.
»Ich kann es nicht tun«, flüsterte sie zu sich selbst und wusste zugleich, dass es nichts als leere Worte waren. Wenn sie dieser Heirat nicht zustimmte, waren sie alle der Drohung ihres Onkels Robert ausgesetzt. Und früher oder später würde sie dann doch einem Ehevertrag unterworfen, wahrscheinlich mit Walter de Lacey. Nichts konnte schlimmer sein als das, sagte sie sich, als sie hinausstarrte über das graue, mit kleinen Wellen gekräuselte Wasser des Flusses unter der Burg.
Also Guyon FitzMiles, der Herr von Oxley und Ledworth. Sie sprach den Namen, erprobte ihn auf der Zunge und versuchte, sich den Mann vorzustellen, aber das Einzige, was herauskam, war ein Übelkeit erregendes Gefühl im Magen. Was, wenn seine Zähne verfault waren und er aus dem Munde stank? Wenn er fett war, mit einer Glatze, wie Hugh, der Earl von Chester? Diese Bilder erfüllten ihre Gedanken, überfluteten sie für einen Augenblick, und sie überlegte einen wilden Moment lang, ob sie sich von einem Mauervorsprung in die Tiefe stürzen sollte wie die Gischt auf die Felsen unter ihr.
Die Vorstellung ängstigte sie, und sie zog sich vom gefährlichen Rand zurück, wobei der Wind an ihrem Haar zerrte und sie stoßweise und schluchzend atmete.
Ein dünnes, klagendes Miauen ließ sie umschauen, dann bückte sie sich zu einer golden getigerten Katze, die ihr um die Röcke strich, mit hoch erhobenem Schwanz, und den runden Kopf an ihren Beinen rieb.
»Melyn!«, schalt Judith, die momentan von ihrem eigenen Kummer abgelenkt war, und hob die Katze hoch. »Wo, bei allen Heiligen, bist du gewesen?«
Die Katze, die seit drei Tagen verschwunden gewesen war, schnurrte nur und schaute sie von der Seite mit schlauem Blick und katzenhafter Herablassung an.
Es war ungewöhnlich, Katzen als Haustiere zu halten. Meistens strichen sie in den Scheunen herum und wurden toleriert, weil sie die Schädlinge im Zaum hielten. Judith hatte Melyn vor zwei Jahren auf dem Hochland entdeckt, ein kleines Kätzchen mit einer schwer verletzten Pfote, und Lord Maurice war nicht zu Hause gewesen; er hätte das Tier sofort erschlagen lassen. Als er zurückkam, hatte sich Melyn bereits wieder völlig erholt, sich an das Leben im Frauengemach gewöhnt und die entsprechenden Manieren gelernt. Ihr katzeneigener Sinn für Selbsterhaltung schickte sie in ihr Versteck, wann immer Maurice in der Nähe war.
Nach seinem Tod war Melyn wie eine Königin durch ihren Herrschaftsbereich geschritten, hochmütig und unangreifbar. Ihr Verschwinden vor drei Tagen war für Judith ein schlimmes Omen gewesen. Es war, als wüsste das Tier, dass ein neuer Tyrann nach Ravenstow kam, und als ob Melyn nichts damit zu tun haben wollte ... Doch jetzt, als seine Ankunft unmittelbar bevorstand, hatte sich Melyn offenbar entschlossen, wieder aufzutauchen.
Sie starrten einander an. Dann legte Melyn plötzlich und schmerzhaft ihre Hinterbeine in Judiths Armbeuge und klammerte sich fest, bis sie auf ihrem Lieblingsplatz saß, auf der Schulter ihrer Herrin. Judith schrie auf und protestierte, ertrug aber die Unbequemlichkeit. Sie hatte nicht gewusst, wie sehr das Verschwinden der Katze an ihrem Seelenfrieden genagt hatte – bis sie es eben erst, bei ihrer Rückkehr, entdeckte.
Judith strich sich das Haar aus dem Gesicht. Melyn stieß ein leises Knurren aus, und ihre Klauen gruben sich in den Hals ihrer Herrin. In diesem Moment kam eine zweite Katze aus dem dunklen, feuchten Gras und näherte sich ohne Hast den Pfad entlang. Ein Kater, glatt und pechschwarz, schlank und elegant.
»O Jesus!«, rief Judith und wusste nicht, ob sie verärgert oder amüsiert sein sollte. Aber natürlich machte sie die Sache betroffen. Gott allein wusste, wie ihr zukünftiger Mann auf ein Zimmer voll junger Kätzchen reagieren würde. Und Gott allein wusste, wie ihr zukünftiger Mann überhaupt auf irgendetwas reagierte.
Viertes Kapitel
Guyon straffte die Zügel, und während der Herold vorausritt, um ihn formell anzukündigen, schaute er an der sandsteinweißen Burg empor, die sich hell gegen die grauen Wolken und die windgepeitschten Felsen der Anhöhe abhob.
»Ich muss verrückt sein«, murmelte er, als die Zugbrücke heruntergelassen wurde, damit er den Burggraben überqueren konnte, und dahinter die Wächter in der Torstube die schwarzen Fänge des Zuggitters zur Hölle öffneten. Guyon lief ein Schauer böser Vorahnungen über den Rücken. Ravenstow mochte eine der uneinnehmbarsten Burgen in den nördlichen Marken sein, was bei den Überfällen der Feinde durchaus erwünscht war, aber er wäre für zwei Pennys umgedreht und wieder zurückgeritten. Allerdings ging es um mehr als zwei Pennys, daher zog er leicht an Arians Zügeln, und der Hengst trabte vorsichtig über die Planken. Cadi legte keine solche Zurückhaltung an den Tag, und Guyon musste die Hündin streng zurückpfeifen.
»So schnell geht es bei den Walisern nicht«, sagte Miles, als sie zwischen der ersten Mauer und der Palisade des inneren Burghofs ritten, ehe sie durch das massive Tor kamen.
Guyon warf ein neidisches Auge auf die großartigen Verteidigungsanlagen. Wenn es nicht ausgerechnet Robert de Belleme gewesen wäre, der so eng mit der Burg in Verbindung stand, hätte er sich wenig Sorgen zu machen brauchen.
Beim Absteigen wurden sie von einem pflichtbewussten kleinen Mann in einer scharlachroten Seidenrobe in Empfang genommen, die an seinem Bauch klebte, als ob er im fünften Monat schwanger wäre. Hinter ihm stand ein größerer Graubart mit eisernen Muskeln und in voller Rüstung, dazu eine Gefolgschaft, die aussah, als handelte es sich dabei um die prominenteren Angehörigen der Wache und der höheren Hausangestellten.
»Gott zum Gruße, Mylords, und seid uns willkommen«, sagte der mit dem Hängebauch und verschränkte die Hände wie ein Bittsteller. »Ich bin Richard FitzWarren, der Haushofmeister von Ravenstow, und das ist unser Burgaufseher, Michel de Bec ...«
Guyon presste die Lippen zusammen, zwang sich aber, zuzuhören und höflich dreinzuschauen, als er einem Mitglied der Gruppe nach dem anderen vorgestellt wurde. Während er seinen Blick in der Runde schweifen ließ und ihn dann über die Männer hinaus richtete, sah er eine Frau, die vom Hauptgebäude auf sie zugeeilt kam und offensichtlich aufgeregt war. Ihr Mantel war mit Pelz besetzt, und ihr rosenfarbenes Kleid schimmerte, während sie sich bewegte. Ihre Zöpfe waren so dick wie ihr Handgelenk und pechschwarz.
»Das ist Lady Alicia«, sagte sein Vater leise und lenkte den Sohn von dem Vorstellungsmanöver ab.
»Danke, FitzWarren«, sagte sie, sobald sie angekommen war. »Ich weiß, dass Ihr Euer Bestes getan habt, aber es wäre vielleicht noch besser, wenn Ihr unsere Gäste hineinführt zu warmem Gewürzwein, statt dass sie sich hier draußen zu Tode frieren während Eurer Ansprachen.« Dann wandte sie sich Miles und Guyon zu und lächelte mit dem Mund, aber nicht mit den Augen. »Ich muss mich entschuldigen für unsere Pechsträhne. Je mehr ich mich bemühe, desto mehr Knüppel wirft man mir in den Weg. Kommt doch hinein, ich bitte Euch.«
»Ist etwas nicht so, wie es sein sollte, Mylady?«, fragte Miles, denn man konnte deutlich sehen, dass ihre Gedanken mit etwas anderem beschäftigt waren, und dass es nicht nur die Kälte war, die ihr Gesicht weiß erscheinen ließ.
Alicia holte Luft, um es zu bestreiten, entschied sich dann aber anders und stieß einen entwaffnenden Seufzer aus. »Nichts von Bedeutung, Mylords. Die Gäste zanken sich, der Koch hat gerade das kochende Fett über den Küchenjungen gegossen, und das Sauerteigbrot ist verbrannt; die Mädchen kennen sich überhaupt nicht mehr aus, mein Haushofmeister lässt Euch im Eisregen stehen, wie ich selbst jetzt ebenfalls, und um dem Ganzen noch die rechte Würde zu geben, hat meine Tochter es mit der Angst zu tun bekommen und ist davongerannt, der Himmel weiß, wohin. Ansonsten ist alles völlig normal, so, wie man es bei einer kurzfristig anberaumten Hochzeit erwarten kann.«
Miles unterdrückte ein Grinsen über diese sarkastische Zusammenfassung. Guyon wollte eine Frage stellen, aber die Worte wurden aus seinen Gedanken verscheucht, als sein weißer Windhund ein Freudengebell von sich gab und über den Burghof jagte, zu einem Mädchen, das versuchte, unbemerkt das Haus durch einen Seiteneingang zu betreten. Sie verlor die Balance und setzte sich auf den schmutzigen, harten Kies. Eine Katzenpfote mit weißer Spitze wurde sichtbar. Blut war zu sehen, begleitet von einem entsetzten Jaulen. Die Katze sprang über den Hund, entkam dadurch dem verspäteten Schnappen seiner Zähne, sauste auf das Wohngebäude zu, zwischen den Beinen eines erschreckten Wächters hindurch und in die Sicherheit der Burg.
Behindert durch ihr Kleid, hatte Judith Mühe, sich zu erheben. Ein kurzer Blick in die Runde, und sie wünschte sich, sie wäre ohnmächtig geworden. Die Diener, die auf dem Hof versammelt waren, die Wachen und die Küchenmädchen rissen die Mäuler auf und betrachteten die Szene mit unverhülltem Vergnügen. FitzWarrens Blick war eine Studie in Sachen Schock: sehenswert, wie er den Mund aufriss und ihm die Augen aus den Höhlen zu fallen drohten. Das Gesicht ihrer Mutter, als sie sich zu ihr herunterbeugte, war hart wie Stein. Jemand kicherte. Sie schloss die Augen, merkte aber, dass die Situation damit noch nicht bereinigt war, öffnete sie wieder und sah einen gut gebauten, ergrauenden Mann in mittleren Jahren, der Alicias Arm genommen hatte, um sie für alle Fälle zu stützen.
»Ich nehme das als ein Omen. Ihr und mein Sohn werdet kämpfen wie Katze und Hund und die ganze Umgebung schockieren!« Miles lachte.
Judith schaute ihn ebenfalls mit aufgerissenem Mund an und wusste nicht, was sie erwidern sollte. Ihr Vater hätte sie in dieser Situation mit der Schließe seines Gürtels geschlagen, bis sie das Bewusstsein verloren hätte.
»Nicht mehr als du und Mama!«, erwiderte ein junger Mann, der ihr liebenswürdig zu Hilfe kam und den weißen, schlanken Hund am Halsband fasste, der versuchte, seine Beute notfalls bis ins Haus zu verfolgen. »Es ist meine Schuld«, sagte er mit einem Lächeln. »Cadi ist fast noch ein Welpe und muss erst Benehmen lernen.«
Judith senkte die Lider. Der Mann war schön und unwirklich. Ein Höfling, ein goldener Ritter mit einer Stimme, so glatt wie dunkler Met. Auch ihr Onkel Robert sah gut aus und war glatt, aber verdorben bis in den Kern unter der Vergoldung. Sie zitterte, und ihre Mutter kam auf sie zu, schickte FitzWarren an seine Dienste und ihre Tochter hinauf in ihr Zimmer, wo Agnes die Schäden ihrer Flucht ausbessern sollte.
Miles lächelte milde über Alicias Kummer, als sie zurückkehrte in die Halle, um sich dort um die Bequemlichkeit ihrer Gäste zu kümmern. »Es ist schon jetzt eine höchst ungewöhnliche Hochzeit. Ich bin sicher, Guyons Erinnerung an ihre erste Begegnung wird sich für den Rest seines Lebens in sein Gedächtnis eingebrannt haben.«
Alicia warf einen Blick über die Schulter, wo Guyon dabei war, den Hund vorläufig in die Obhut von einem seiner Knappen zu geben, dann wandte sie sich wieder an Miles. »Ich glaube, Sie lachen über mich, Mylord.«
»Ja.«
Ihre Lippen begannen zu zucken. Sie zog sie wieder gerade. »Judith ist schrecklich nervös. Heute Morgen war sie noch ein Kind, heute Abend wird sie eine Frau sein.«
Miles dämpfte seinen Humor. Er sah, dass Alicia sich Sorgen machte. »Guyon hat eine Schwester und Nichten und kennt sich ohne Zweifel mit Frauen aus«, sagte er.
»Das haben wir gehört«, erwiderte Alicia ein bisschen steif und zog dann die Schultern hoch. »Und das ist kein Wunder, wenn man sein prächtiges Aussehen in Betracht zieht, die gute Figur, die er bei Hofe macht.«
»Aber ich bin jetzt nicht bei Hof, Mylady«, sagte ihr Guyon ins Ohr.
Alicia wirbelte herum, unterdrückte einen Aufschrei und musste den Hals verrenken, um ihm ins Gesicht schauen zu können. Er lächelte, aber seine Augen waren kühl.
»Macht Euch keine Sorgen. Ich verspreche, dass ich Eure Tochter stets mit vollem Respekt und vollendeter Höflichkeit behandeln werde.«
»Judith ist jung, aber sie lernt schnell und ist durchaus imstande, einen Haushalt zu führen. Wenn sie sich jetzt in einem ungünstigen Licht gezeigt hat, so kommt das vor allem daher, dass sie immer noch erschüttert ist durch den Tod ihres Vaters und diese plötzliche Veränderung ihrer Situation.«
Mit anderen Worten, dachte Guyon gequält, sie ist ein empfindsames, erschrecktes kleines Mädchen, das sehr vorsichtig und behutsam behandelt werden musste, wenn man es aus ihrer schwierigen Lage befreien wollte.
Der Wein kam, und mit ihm Hugh d’Avrenches, der Earl von Chester, der Guyon von der Pflicht entband, Alicia eine Antwort zu geben.
»Es wird anfangs sicher schwierig sein«, murmelte ihr Miles leise zu, während Guyon seinem Nachbarn ein Ohr lieh für das, was der Earl von Chester über die walisischen Clans dieser Region zu sagen hatte. »Bei einer vernünftigen Vereinbarung hätten wir alle die Zeit gehabt, die wir brauchten«, sagte er zu Alicia.
»Ich fürchte, dann hätte es wohl gar keine vernünftige Vereinbarung gegeben, nicht wahr?«
Miles, dem darauf keine Antwort einfiel, hob seinen Becher und trank.
Guyon betrachtete das Mädchen, an das er sich eben durch sein Gelöbnis in der eiskalten, dunklen Kapelle für den Rest seines Lebens gebunden hatte, wie lang oder kurz das auch sein mochte. Die Antworten, die sie gegeben hatte, waren schwach und zitternd gewesen, und mehr als einmal tränenerstickt.
Er war sich der Dolche in den Augen der Männer bewusst, die sich ihm in das feine, wollene Tuch seines Hochzeitsrocks bohrten. Arnolf von Pembroke hatte ihn kaum gegrüßt; Walter de Lacey war offen feindselig gewesen und hatte sich um Guyon herumgeschlichen wie ein einsamer Wolf.
Jetzt hatte sich ihm Judith gehorsam zugewendet und erwartete den traditionellen Kuss. Er schaute auf das sommersprossige, blasse Oval ihres Gesichts, das deutlich an das einer Katze erinnerte, vor allem die Augen, die sich nach oben kehrten in ihrer seltsamen Mischung aus Braun und Grau, wie dunkles Wasser.
Er küsste sie auf die Wange, wie er eine Untergebene küssen würde, kurz und unpersönlich. Ihre Haut roch leicht nach Kräuterseife, ihr Haar nach Rosmarin und Kamille, Kräutertinkturen, in denen es zur Hochzeit gewaschen worden war.
Judith schauderte bei dem leichten Kontakt, und Guyon ließ sie augenblicklich los. Sie schluckte ihre Angst hinunter und wandte sich zusammen mit ihm zu den Gästen und den Trauzeugen um, die ihnen zur Hochzeit gratulierten.
Das Ganze war ein Albtraum, den sie wie in einem Nebel erlebte. Hier und da hob sich dieser Nebel und enthüllte ein deutliches, buntes Tableau, in dessen Mitte sie stand, hilflos und erschreckt. Jetzt war sie sein Besitz, genau wie sein Pferd oder sein Hund, konnte nach seinen Wünschen gebraucht oder auch missbraucht werden.
Der Nebel senkte sich wieder. Sie gab die erwarteten Antworten, nahm die Glückwünsche mit einem aufgesetzten Lächeln entgegen, und ihre blinden Augen sahen nicht den Blick, mit dem Walter de Lacey sie bedachte, als sie mit Guyon weiterging.