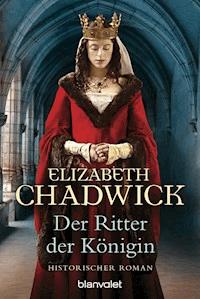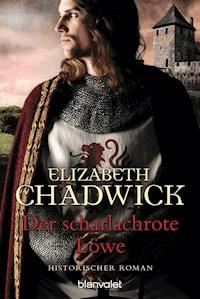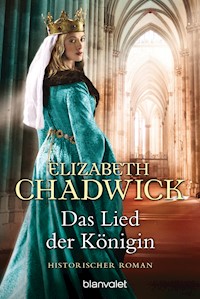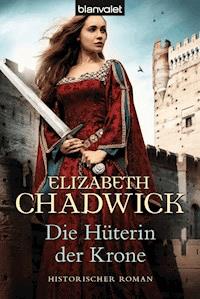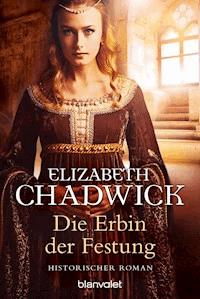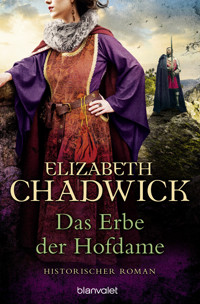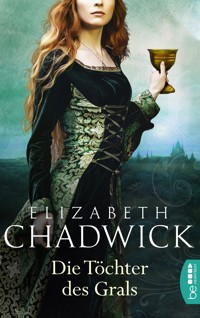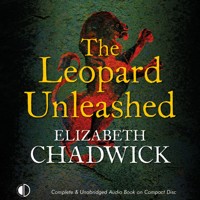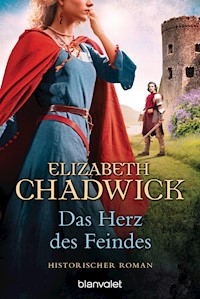7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
England, 1184. Fulke FitzWarin wird als Schildknappe an den Hof von König Henry gesandt. Doch eine Schachpartie, die Prinz John gegen Fulke verliert, wird zum Auslöser einer lebenslangen Rivalität: Der junge Knappe muss den Königshof verlassen. In Theobald Walter findet Fulke zum Glück einen gerechteren Herrn. Doch er gerät in seelische Bedrängnis, als er erfährt, dass die zauberhafte Maud le Vavasour Theobald heiraten wird. Als dieser stirbt, erhält Fulkes Liebe eine zweite Chance, nur – was kann er der schönen Maud bieten, nachdem der inzwischen zum König gekrönte John ihn für vogelfrei erklärt hat?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1054
Sammlungen
Ähnliche
Buch
England, 1184. Fulke FitzWarin wird als Schildknappe an den Hof von König Henry gesandt. Doch eine Schachpartie, die Prinz John gegen Fulke verliert, wird zum Auslöser einer lebenslangen Rivalität: Der junge Knappe muss den Königshof verlassen. In Theobald Walter findet Fulke zum Glück einen gerechteren Herrn. Doch er gerät in seelische Bedrängnis, als er erfährt, dass die zauberhafte Maud le Vavasour Theobald heiraten wird. Als dieser stirbt, erhält Fulkes Liebe eine zweite Chance, nur – was kann er der schönen Maud bieten, nachdem der inzwischen zum König gekrönte John ihn für vogelfrei erklärt hat?
Autorin
Elizabeth Chadwick lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in Nottingham. Sie hat zahlreiche historische Romane geschrieben, die allesamt im Mittelalter spielen. Vieles von ihrem Wissen über diese Epoche resultiert aus ihren Recherchen als Mitglied von Regia Anglorum, einem Verein, der das Leben und Wirken der Menschen im frühen Mittelalter nachspielt und so Geschichte lebendig werden lässt.
Elizabeth Chadwick
Die Braut des Ritters
Roman
Aus dem Englischenvon Monika Koch
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2006 unter dem Titel »Lords oft he White Castle« bei Little, Brown and Company, London.
E-Book-Ausgabe 2015 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Copyright © der Originalausgabe 2000 by Elizabeth Chadwick by Blanvalet Verlag, München
Covergestaltung: Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign,
unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
ISBN: 978-3-641-16446-1 V002
www.blanvalet.de
Danksagung
Wie immer möchte ich auch diesmal den zahlreichen Helfern danken, deren Namen so gut wie nie in die Öffentlichkeit gelangen – sprich allen Mitarbeitern der Blake Friedmann Literary Agency und ganz besonders meiner wunderbaren Agentin Carole Blake. Sie hat sich inzwischen ebenfalls unter die Autoren eingereiht und beschreibt in ihrem Buch From Pitch to Publication, wie man ein Manuskript unter die Leute bringt.
Dank gebührt natürlich auch allen Mitarbeitern von Little, Brown and Company – vor allem meiner Lektorin Barbara Boote, die mir zu meinem großen Entzücken immer die Stellen aufzählt, an denen sie weinen musste! Ein besonderer Dank gebührt außerdem Emma Gibb und Richenda Todd für die minutiöse Korrektur – vom Entwirren und Sortieren des Knäuels aus Daten und Jahreszahlen, das die verschiedenen Entwürfe der Lords erzeugt haben, gar nicht zu reden.
Außerdem danke ich meiner Familie, dass sie es mit mir aushalten (wobei ich es ja auch mit ihr aushalten muss!), und natürlich den Mitgliedern von Regia Anglorum, Conquest und Conroi de Burm, die bereitwillig ihr Wissen mit mir teilen und mir immer wieder neue Anregungen geben. Nicht zuletzt geht mein Dank an die Mitglieder des Nottingham Writers’s Contact für sehr viel Spaß und ebenso viel Unterstützung (wer könnte schon Annabel’s Antics vergessen?) und an sämtliche Teilnehmer von [email protected] und [email protected] für alle Chats über mein Lieblingsthema!
1
Palast von Westminster,Dezember 1184
Die Mittagszeit war noch nicht lange vorüber, als es an dem trüben Winternachmittag bereits zu dämmern begann. Heftige Graupelschauer hatten den Waffenübungen im Freien ein Ende gesetzt, und nun prasselte der eisdurchsetzte Regen wie gläserne Nadeln gegen die geschlossenen Fensterläden. Alle Fackeln und Wandleuchter brannten, und überall in den Räumen waren Holzkohlenbecken im Einsatz. Doch außerhalb der Lichtkreise und wärmenden Inseln, draußen in den Gängen und auf den dunklen Wegen zwischen den einzelnen Gebäuden des weitläufigen Palastes, lauerte die klamme Winterkälte, um sich derer zu bemächtigen, die sich leichtfertig ohne schützenden Mantel nach draußen wagten.
Fulke FitzWarin saß in einer der tiefen Fensternischen der White Hall und lauschte dem Heulen des Windes, während er seinen Schild bearbeitete, um die Scharten und Kratzer der morgendlichen Kampfübungen auszuwetzen. An Martini hatte ihm sein Vater diesen Schild mit dem Wappen der FitzWarins, einem Wolfshaupt mit zwölf Zähnen auf leuchtend rotem Grund, als Zeichen erster Manneswürde zum fünfzehnten Geburtstag geschenkt.
»Ha, ein Sechser! Ich gewinne!«, schrie eine Stimme triumphierend.
Fulke hob den Kopf und sah zum großen Tisch hinüber, wo sich Prinz Johann und die Knappen aus Ranulf de Glanvilles Gefolge mit einem Würfelspiel die Zeit vertrieben. Der Tisch bestand aus einer Holzplatte, die man auf zwei Böcke gelegt hatte. Es klimperte, als ein junger Mann mit Lockenkopf einen kleineren Haufen Münzen vom Tisch auf seine Handfläche kehrte. Prinz Johann, der am kommenden Weihnachtstag siebzehn werden würde, griff mit gerunzelter Stirn in den Lederbeutel an seinem vergoldeten Gürtel und warf weitere Silbermünzen auf den Tisch. Die Tunika aus kostbarem dunkelblauem Tuch verlieh seiner untersetzten Gestalt zwar eine gewisse Eleganz, doch dieser Eindruck wurde durch seine nachlässige Haltung und den missmutigen Ausdruck im Gesicht sofort wieder getrübt.
Fulke hätte seinen Kameraden beim Spiel gerne Gesellschaft geleistet, wenn ihn nicht nur ein halber Silberpenny von einem leeren Beutel getrennt hätte. Wenn sich die jungen Männer aber im Armdrücken gemessen hätten, dann hätte er ganz bestimmt nicht abseits gestanden. Im Gegensatz zu Göttin Fortuna waren Wendigkeit und Muskelkraft nämlich verlässliche Größen, und beide besaß er im Übermaß.
Als Fulke neun Monate zuvor aus dem walisischen Grenzgebiet in den Palast von Westminster gekommen war, hatten ihn die anderen Knappen anfangs als Landei und Tollpatsch verspottet. Sie hatten ihm die Kleider gestohlen, ihm auf der Treppe ein Bein gestellt und sogar einen Nachttopf über ihm ausgeleert, während er schlief. Es hatte eine geschlagene Woche gedauert, bis seine Peiniger auf die unsanfte Art gelernt hatten, dass dieser Fulke FitzWarin alles, was man ihm antat, mit doppelter Münze heimzahlte. Dieser Tage nannten sie ihn zwar immer noch Tollpatsch, aber inzwischen war das sein Spitzname und eher ein Zeichen dafür, dass er unter den Knappen etwas galt, wenn nicht sogar ihr Anführer war.
Dass der junge Mann überhaupt in Prinz Johanns Gefolge dienen durfte, war allein König Heinrich zu danken, der die unbedingte Treue der Familie FitzWarin zu schätzen gelernt hatte. Der Prinz selbst hätte sich Fulke niemals zum Gefährten ausgesucht, und umgekehrt wäre das sicher nicht anders gewesen, denn eigentlich verband die beiden jungen Männer nichts als das annähernd gleiche Alter.
Wieder wanderte Fulkes Blick zu den Spielern hinüber. Als der Prinz ihn auffing, verfinsterte sich seine Miene. »In Christi Namen, hör endlich auf, diesen verdammten Schild zu liebkosen, und schenke mir Wein ein.« Er streckte Fulke ungeduldig seinen leeren Becher entgegen. Am Mittelfinger seiner Hand blitzte ein Amethyst, und ein weiterer schwerer Goldring zierte seinen Daumen.
»Hoheit.« Behutsam legte Fulke seinen Schild auf die Bank neben sich. Dann holte er den bauchigen Weinkrug von einem schmalen Tisch an der Wand und trat zu den Spielern.
»Na, Tollpatsch, willst du auch einmal dein Glück versuchen?«, fragte der Knappe mit dem Lockenkopf.
Fulke lächelte, und seine graubraunen Augen blitzten. »Viel lieber würde ich dir deinen Gewinn abknöpfen, Girard.« Er nickte in Richtung des Münzenbergs auf dem Tisch. »Wenn du magst, können wir uns sofort im Armdrücken messen.« Er füllte Prinz Johanns Becher und ließ den Krug auf dem Spieltisch stehen, damit die anderen sich nach Belieben bedienen konnten.
Girard schnaubte. »Auf dieses Angebot falle ich nicht noch einmal herein!«
Fulkes Lächeln verbreiterte sich zu einem Grinsen, als er seinen Unterarm anwinkelte und die schwellenden Muskeln den Stoff seines Hemdes spannten. »Jammerschade.«
Girard vollführte eine ungehobelte Geste und griff nach den Würfeln. Fulke sah noch, wie er eine Drei warf und damit all seine Gewinne wieder verlor. Dann kehrte er zu seiner Arbeit am Schild zurück. Zu beiden Seiten der Fensternische standen gepolsterte Bänke, und auf dem kleinen Tisch in ihrer Mitte lag Master Glanvilles schweres hölzernes Schachbrett.
Auf den Schild gestützt, betrachtete Fulke die Elfenbeinfiguren mit einer gewissen Wehmut, fast mit Sehnsucht. Die Figuren beschworen das Bild von Lambourn Manor in ihm herauf und die Gesichter seiner Brüder, deren Profile sich scharf vor dem lodernden Kaminfeuer abzeichneten. Er sah seine Mutter, wie sie beim Schein einer Kerze las und dabei stumm die Worte mit den Lippen formte. Und dann sah er sich selbst, wie er mit seinem Vater in einer Fensternische, ähnlich wie dieser hier, saß und Schach spielte. Er sah, wie sein Vater die Brauen runzelte und einen gewonnenen Bauern in der Hand wog, während er den nächsten Zug überdachte. Natürlich wusste Fulke, dass er die Erinnerung an seine Familie in Gedanken vergoldete, weil sie ihn dann umso mehr tröstete, aber auch ohne Beschönigung enthielt dieses Bild sehr viel Wahrheit. Fulke verging nicht unbedingt vor Heimweh, aber er vermisste die Wärme und das Vertrauen, das in seiner Familie herrschte, und bedauerte des Öfteren, dass der nächste Schachzug seines Vaters ausgerechnet darin bestanden hatte, ihn hierher in den Palast von Westminster zu entsenden, damit er unter den Vornehmen des Landes die ritterlichen Tugenden und Fertigkeiten erlernte.
Im vergangenen Frühling war Fulke le Brun eines Tages vom Hof nach Lambourn Manor zurückgekehrt und war, ohne auch nur einen Gedanken an seine schmutzige Reisekleidung zu verschwenden, auf direktem Weg ins Privatgemach der Familie geeilt, um die Neuigkeit zu verkünden. »Es ist eine sehr große Ehre, die König Heinrich unserer Familie erweist. Fulke wird nicht nur Schüler von Ranulf de Glanville, dem Obersten Richter, er wird während seines Aufenthalts am Hof auch eine Menge einflussreicher Männer kennen lernen, was sich eines Tages als hilfreich erweisen könnte.« Fulke erinnerte sich deutlich an die leichte Röte, die das sonst so fahle Gesicht seines Vaters bei diesen Worten belebt hatte, und an das Funkeln in seinen dunkelbraunen Augen. »Eines Tages könnte Whittington wieder uns gehören.«
»Was ist Whittington?«, hatte sich Fulkes jüngster Bruder Alain mit Piepsstimmchen zu Wort gemeldet. Er war gerade erst vier, und im Gegensatz zu den älteren Brüdern musste ihm der cause célèbre der FitzWarins erst noch beigebracht werden, bis er zum Dreh- und Angelpunkt seines Lebens wurde.
»Whittington ist eine Burg mit großen Ländereien«, hatte seine Mutter erklärt und Alain dabei in die Arme genommen. »Zu Lebzeiten des ersten König Heinrich hat die Burg der Familie deines Vaters gehört, doch während eines Krieges wurde sie uns weggenommen und nie mehr zurückgegeben. Seit langem versucht dein Vater nun schon, Whittington zurückzubekommen.« Sie hatte die Geschichte in so einfachen Worten erzählt, dass auch ein kleiner Junge sie verstehen konnte. Dabei war ihrer freundlichen Stimme nichts von all der Feindseligkeit und Bitterkeit anzuhören, die sich infolge der jahrelangen vergeblichen Bemühungen gebildet hatten.
»Schon viel zu lange«, hatte Brunin ergänzt und vernehmlich geseufzt. »Zu Lebzeiten meines Großvaters gehörte Whittington noch unserer Familie. Seitdem beansprucht Roger de Powys das Lehen für sich, obwohl er dazu kein Recht hat.«
»Wenn König Heinrich Euch so sehr schätzt, dass er mich sogar in Prinz Johanns Gefolge aufnimmt, warum gibt er Euch Whittington dann nicht einfach zurück?«, hatte Fulke wissen wollen.
»Eine so heikle Angelegenheit ist nicht allein die Sache des Königs«, hatte ihm sein Vater erklärt. »Vor seiner Entscheidung müssen wir unser Anrecht vor Gericht beweisen. Wenn ein Fall jedoch so verzwickt ist wie dieser, wird er gern wegen dringenderer Anliegen auf die lange Bank geschoben. Gott weiß, dass ich mich immer wieder bemüht habe. König Heinrich hat mir auch schon oft Versprechungen gemacht, aber ich verstehe natürlich, dass ihm die Sache nicht so wichtig ist wie mir.« Eindringlich hatte sein Vater ihn angesehen und ihn dann wie einen Gleichaltrigen bei den Schultern genommen. »Ranulf de Glanville bekleidet das Amt, vor dem über unser Anliegen entschieden wird. Und ebendieser Mann wird dein Lehrer sein. Tu dein Bestes für ihn, mein Sohn. Womöglich wird er dann eines Tages genau das auch für dich tun.«
Und Fulke gab sein Bestes, denn es war nicht seine Art, sich vor seinen Pflichten zu drücken. Außerdem war er ebenso stolz wie sein Vater. Unter den Fittichen des Obersten Richters lernte er es, zu rechnen und Buch zu führen, und auch seine Kenntnisse in Latein und im Rechtswesen erweiterten sich beständig. Was Master Glanville jedoch von seinem Schüler hielt, wusste Fulke nicht zu sagen. Sein Lehrer war ein ernster Mann in mittlerem Alter, der mit Lob sehr sparsam umging.
Fulke strich sich das Haar aus der Stirn und zog eine Grimasse. Zuweilen fragte er sich wirklich, ob die Erziehung bei Hofe ein solch großes Privileg war. Ständig nach Prinz Johanns Pfeife tanzen zu müssen war jedenfalls keine Freude. In Lambourn hatte er als zukünftiger Erbe eine geachtete und bevorzugte Stellung inne und diente seinen jüngeren Brüdern als leuchtendes Vorbild. Bei Hofe jedoch musste er sich unterordnen und war als kleiner Niemand jeder Laune des Prinzen hilflos ausgeliefert. Launen, denen dieser schon mehr als einmal mit dem Stock Nachdruck verliehen hatte.
Als der Prinz unvermittelt aufsprang, entstand ein erhebliches Durcheinander. Scheppernd fiel der Weinkrug, den Fulke auf dem Tisch abgestellt hatte, zu Boden. »Ihr Hurensöhne! Hinaus mit euch! Und zwar alle!« Wild gestikulierte Johann in Richtung der Tür. »Die reinsten Blutsauger seid ihr! Ihr verdient nicht einmal, dass man seinen Pisspott über euch ausleert.«
Fulke trat aus der Nische hervor, um sich unauffällig den anderen Knappen anzuschließen.
»Du nicht, Tollpatsch«, knurrte Johann wütend. »Du holst mir mehr Wein!«
»Hoheit!« Mit ausdrucksloser Miene bückte sich Fulke nach dem silbernen Krug, der in den Binsen nahe bei Prinz Johanns Füßen gelandet war. Eine hässliche Delle verunzierte den gewölbten Bauch.
»Du hättest ihn eben nicht auf dem Tisch stehen lassen sollen«, maulte der Prinz. »Das ist nur deine Schuld. Du musst mir einen neuen kaufen.«
Es wäre sicher klüger gewesen, einfach den Mund zu halten, doch das war nicht Fulkes Art. »Das ist nicht gerecht, Hoheit.«
Johann kniff die Lider zusammen. »Willst du etwa mit mir streiten?«
Mit dem beschädigten Krug in der Hand richtete sich Fulke zu voller Größe auf und sah dem Prinzen direkt in die Augen. »Es ist richtig, dass ich den Krug auf dem Tisch habe stehen lassen, obwohl ich ihn vielleicht besser hätte zurückbringen sollen – aber ich habe ihn nicht auf den Boden geworfen.«
Warnend stieß der Prinz den Zeigefinger gegen Fulkes Brust. »Du wirst ihn mir bezahlen. Und damit Schluss. Und jetzt spute dich, und hol endlich neuen Wein.«
Fulke nahm sich kaum Zeit für eine richtige Verbeugung, so hastig stürzte er aus dem Zimmer. Trotz der Winterkälte glühte er vor Zorn. »Nicht einen einzigen Viertelpenny zahle ich dem«, brummte er vor sich hin, während er den großen Saal durchquerte und auf den Tisch des Kellermeisters am anderen Ende zusteuerte.
»Für Prinz Johann«, verlangte er mit gleichmütiger Miene.
Stirnrunzelnd besah sich der Kellermeister die Delle. »Wie ist denn das passiert?«
»Das war ein Missgeschick.« Obwohl Fulke den Prinzen am liebsten erwürgt hätte, erforderte es der Anstand, die Zunge im Zaum zu halten. Doch das fachte seine Wut erst recht an.
»Das ist nun schon das dritte ›Missgeschick‹ in diesem Monat«, meinte der Kellermeister kopfschüttelnd. Er stellte den Krug unter das Fass und drehte den Hahn auf. »Wie du sicher weißt, wachsen solche Krüge nicht auf Bäumen. Einer wie der ist gut seine vier Silberunzen wert.«
Beinahe sieben Shilling, dachte Fulke verzweifelt: der Wochenlohn eines berittenen Sergeanten und völlig außerhalb seiner Reichweite – außer er bat seinen Vater um Hilfe oder maß sich eine geschlagene Woche lang im Armdrücken, um seinen Beutel zu füllen.
Obgleich der Prinz ihn zur Eile gemahnt hatte, ließ Fulke sich Zeit, in der Hoffnung, seine Wut würde verrauchen. Aber ganz schaffte er es nicht. Als er nach geraumer Zeit anklopfte und den Raum betrat, schwelte sein Zorn noch immer leise vor sich hin.
In Fulkes Abwesenheit hatte Johann in der Nische, wo das Schachbrett stand, die Fensterläden entriegelt. Er lehnte an der Brüstung und starrte in die stürmische Nacht hinaus, während der Wind kleine Eiskristalle an ihm vorbei in den Raum fegte. Die Höfe und Durchgänge des Palasts lagen im Dunkel, da jede Fackel in einem solchen Unwetter erlosch. Doch in allen Gebäuden, in denen sich jemand aufhielt, glomm und flackerte vereinzelter Lichtschein, und in einer geschützten Ecke des Zwingers hatten Wachleute sogar eine Holzkohlenpfanne aufgestellt, um sich ein wenig zu wärmen. In einiger Entfernung schimmerten die schwach erleuchteten Fenster der großen Abteikirche in der Dunkelheit wie matte Juwelen.
In hoheitsvoller Haltung drehte sich Prinz Johann zu Fulke um, die eine Hand am Gürtel, während die andere noch immer auf der Fensterlaibung ruhte. »Das hat eine Weile gedauert.«
»Am Schanktisch haben noch andere gewartet, Hoheit«, log Fulke und füllte den Becher. »Wünscht Ihr, dass ich mich entferne?« Er gab sich alle Mühe, nicht zu hoffnungsvoll zu klingen, doch als der Prinz plötzlich verkniffen dreinsah, war ihm klar, dass der Versuch fehlgeschlagen war.
»Nein, du bleibst hier und leistest mir Gesellschaft. Du tust ohnehin nicht genug, um dein Brot zu verdienen.« Der Prinz deutete auf den verbeulten Krug. »Gieß dir auch einen Becher ein. Ich trink nicht gern allein.«
Widerstrebend goss Fulke ein paar Schlucke in einen der geleerten Becher, die noch auf dem Tisch standen. Ein heftiger Windstoß fuhr in die Wandbehänge, und die Kerzen in den Leuchtern flackerten bedrohlich.
»Wie viele Brüder hast du eigentlich?«
Fulke sah ihn misstrauisch an, weil er nicht wusste, wie er die Laune des Prinzen einschätzen sollte. Übel war sie auf jeden Fall. »Fünf, Hoheit.«
»Und was erben die einmal?«
»Das weiß ich nicht. Das zu entscheiden ist allein Sache meines Vaters«, antwortete er vorsichtig.
»So ein Unsinn. Du bist der Erbe. Eines Tages bekommst du alles.«
Fulke zuckte die Achseln. »Mag sein, aber deshalb wird keiner meiner Brüder mittellos sein.«
»Glaubst du nicht, dass sie es dir verübeln werden, wenn du den Löwenanteil bekommst?« Gedankenverloren strich Prinz Johann über den mit Leder bezogenen Schild, der noch immer auf der Bank lag.
»Jedenfalls nicht so sehr, damit auf Dauer ein Keil zwischen uns getrieben wäre«, versicherte Fulke. »Selbst wenn ich mit meinen Brüdern einmal uneins sein sollte, so ist Blut doch immer dicker als Wasser.«
Der Prinz lachte säuerlich. »Ach, wirklich?«
»Für unsere Familie gilt das auf jeden Fall.« Fulke trank einen Schluck. Er wusste, dass er sich mit dieser Bemerkung auf gefährlichen Grund begeben hatte. Prinz Johann war König Heinrichs jüngstes Kind und erst zur Welt gekommen, als das Erbe des Königs bereits unter den anderen Söhnen aufgeteilt war. Dass keiner der Brüder gewillt war, dem Jüngsten auch nur ein Jota von dem abzugeben, was ihm gehörte, hatte dem Prinzen den Spitznamen Johann Ohneland eingetragen. Während Fulke in die tosende Finsternis hinausstarrte und die Stiche der Eiskristalle auf seiner Haut spürte, dämmerte ihm, dass er nur wegen seiner bevorzugten Stellung als ältester Sohn mit gesicherter Erbschaft für den Prinzen ein Dorn im Auge war. »Mein Vater sagt immer, dass die Familie eine Einheit ist. Gewissermaßen ein Körper. Der Kopf kann allein nicht leben und ist auf den Leib und seine Glieder angewiesen. Was man dem einen tut, das fügt man auch allen anderen zu.«
»›Mein Vater sagt immer‹«, äffte der Prinz seinen Knappen nach. »Guter Gott, weißt du eigentlich, wie oft du diesen Satz im Mund führst?«
Fulke errötete. »Wenn ich das tue, so doch nur, weil mein Vater viele vernünftige Sachen sagt.«
»Oder weil du noch ein Kind bist, das nicht selbstständig denken kann.« Er warf Fulke einen verächtlichen Blick zu und schloss die Läden vor dem unwirtlichen Wetter. Die Kerzen flackerten nicht länger, und die plötzliche Stille duftete nach verbranntem Wachs. Ganz in Gedanken sank Johann auf die Bank beim Schachbrett nieder und spielte sichtlich schlecht gelaunt mit einem der Läufer herum.
Inzwischen fragte sich Fulke verzweifelt, wie lange es wohl noch dauern würde, bis das Horn sie endlich zum Abendessen rief. Nachdem es schon vor einer Weile dunkel zu werden begonnen hatte, musste es jeden Augenblick so weit sein.
Der Prinz deutete auf das Schachbrett. »Wie wäre es mit einer kleinen Partie, Tollpatsch?«
»Einer Partie?« Fulkes Herz sank. Er zog den Schild zu sich heran und fuhr mit der Hand über die lederne Bespannung des Lindenholzes, als ob er damit Prinz Johanns Berührung auslöschen könnte.
»Wenn du gewinnst, erlasse ich dir das Silber für den Krug.«
Der höhnische Unterton entging Fulke keineswegs. Prinz Johann war ein ausgezeichneter Schachspieler, was er einzig und allein dem messerscharfen Verstand ihres gemeinsamen Lehrers verdankte. Schließlich hatte ebendieser Verstand Master Glanville auch seine Ernennung zum Obersten Richter eingetragen. Fulke dagegen war sehr viel sprunghafter, und seine Stärke beruhte weniger auf Logik und Erlerntem, sondern vielmehr auf rascher Auffassungsgabe und der Freude am Spiel.
»Wenn Ihr darauf besteht, Hoheit.« Ergeben setzte sich Fulke auf die Bank gegenüber.
Prinz Johann bedachte seinen Knappen mit abschätzigem Grinsen und drehte dann das Brett so herum, dass die weißen Figuren auf seiner Seite standen. »Ich fange an«, erklärte er.
Wieder glitt Fulkes Hand über den Schild, als ob er sein Glück beschwören wollte. Ganz gleich, wie er es anstellte – er konnte nicht gewinnen. Wenn er verlor, musste er das Geld für den Krug irgendwo auftreiben. Und wenn er gewann, würde Johann ihn sofort mit neuen, weit schlimmeren Gemeinheiten traktieren, um sich an ihm zu rächen. Am besten verlor er so schnell wie möglich und stimmte anschließend den Prinzen mit Schmeicheleien gnädig. So jedenfalls würden die anderen Knappen das Problem lösen.
In der besten Absicht, Johann gewinnen zu lassen, griff Fulke nach einem Springer, doch dann machte er entgegen seinem ursprünglichen Plan einen Zug, der einer offenen Herausforderung gleichkam.
Johann runzelte die Brauen. »Von wem hast du denn diesen Zug gelernt?«
»Von meinem Vater«, erwiderte Fulke in aufreizendem Ton. Es war seltsam, aber seit der Kampf eröffnet war, wuchsen seine Sicherheit und sein Trotz. Er spielte mindestens ebenso gut wie der Prinz, wenn auch auf andere Art. Das war der einzige Unterschied. Wenn er Johanns Taktik folgte, würde er unterliegen – ganz gleich, wie die Partie endete. Doch wenn er nach seinem eigenen Gespür spielte, war er frei und konnte auf die Konsequenzen pfeifen.
Der Prinz versuchte, die schwarzen Figuren in eine Ecke des Spielfelds zu manövrieren, doch Fulke hielt stets auf Distanz und verdarb die Strategie seines Gegners mit immer neuen Ausfällen. Johann wurde zusehends ungeduldiger, was auf Fulkes wagemutige Angriffe zurückzuführen war und darauf, dass der Prinz seinen Gegner nicht festnageln konnte. Er schüttete zwei weitere Becher Wein in sich hinein, fummelte an seinen Ringen herum, zerrte an seinem spärlichen schwarzen Bartwuchs und wurde von Minute zu Minute wütender.
Fulke zog mit einem Läufer quer über das Brett. »Schach!«, sagte er. Zwei Züge später würde unweigerlich das Matt folgen, ohne dass sein Gegner noch etwas daran ändern konnte.
Ungläubig und voller Zorn sperrte Prinz Johann den Mund auf, dann überdachte er mit zusammengekniffenen Augen seine Möglichkeiten. Die Muskeln an seinem Kinn spannten sich. »Offenbar hat dir dein Vater auch beigebracht, wie man betrügt.« Abscheu schien seine Stimme zu ersticken.
Fulke ballte die Fäuste und hielt sich nur mühsam zurück, um Johann nicht auf der Stelle die Zähne einzuschlagen. »Ich habe eine ehrliche Partie gespielt und verdient gewonnen. Ihr habt nicht das Recht, meine Familie zu beleidigen, nur weil Ihr verloren habt.«
Der Prinz sprang auf und fegte mit ausholender Bewegung die Schachfiguren vom Brett. »Ich habe jedes Recht, und ich mache, was immer ich will!«
Fulke sprang ebenfalls auf. »Aber nicht mit mir und den Meinen!« Seine Augen waren schwarz vor Zorn. »Ihr mögt königlicher Abkunft sein, aber im Moment verdient selbst der Kehricht in der Gosse mehr Respekt als Ihr!«
Vor Wut heulte Johann laut auf. Dann packte er das Schachbrett mit beiden Händen und schlug es Fulke mit aller Kraft ins Gesicht.
Fulkes Nasenbein splitterte, und ihm wurde beinahe schwarz vor Augen. Gefühllosigkeit breitete sich in seinem Gesicht aus, und dann schoss heißes Blut hervor. Er fuhr sich mit der Hand über den Mund und betrachtete erstaunt seine blutigen Finger.
Wieder schlug der Prinz mit dem Brett nach ihm, doch dieses Mal duckte Fulke sich rechtzeitig und trat mit den Füßen um sich. Johann kämpfte um sein Gleichgewicht. Er glitt mit dem Fuß auf einer der Schachfiguren aus, fiel hin und krachte mit dem Kopf gegen die Wand. Seine Knie gaben nach, dann stürzte er wie ein geschlachteter Ochse zu Boden.
»Jesus Christus!«, keuchte Fulke. Er presste sich den Hemdsärmel gegen die Nase und beugte sich über den reglosen Körper. Im ersten Moment dachte er, dass er Johann umgebracht hatte. Dann jedoch sah er, dass sich der Brustkorb hob und senkte, und ertastete einen kräftigen Pulsschlag unter dem Spitzenkragen.
Wut und Angst engten Fulkes Kehle ein, bis ihm übel wurde. »Wacht auf, Hoheit!« Mit wachsender Furcht rüttelte er Johann an der Schulter. Dabei tropfte das Blut aus seiner Nase auf die blaue Tunika und versickerte in dem kostbaren Tuch.
Der Prinz stöhnte zwar, öffnete aber nicht die Augen. Hastig stolperte Fulke zur Anrichte hinüber und goss sich einen Becher Wein ein. Als er trank, schmeckte er nur Blut. Er füllte den Becher erneut und eilte zu Johann zurück. Er stützte ihn an den Schultern in die Höhe und benetzte seine Lippen mit Wein.
In diesem Augenblick schnappte der Riegel zurück, und die Tür schwang auf. Wie angewurzelt blieben Ranulf de Glanville und sein Neffe Theobald Walter, der Fechtlehrer des Prinzen, auf der Schwelle stehen und starrten auf das Bild, das sich ihnen bot.
»Bei den Gebeinen unseres Herrn!«, rief Theobald Walter. »Was geht hier vor?«
Fulke schluckte. »Seine Hoheit, Prinz Johann, hat sich den Kopf angeschlagen, und ich kann ihn nicht wieder aufrichten.« Seine Stimme hallte in seinen Ohren wider, doch wegen des geronnenen und verklumpten Bluts in seiner Nase klang sie seltsam dumpf.
»Wie ist es dazu gekommen?«, wollte Lord Walter wissen, während er in Respekt heischender Haltung mit festem Schritt den Raum betrat. Das gefütterte Wams, das er während der morgendlichen Fechtübungen getragen hatte, hatte er gegen eine knöchellange Tunika aus rotem Tuch mit üppiger Goldstickerei vertauscht, wie man sie üblicherweise bei Hofe trug. Sein Schwertgurt lag noch immer um seine Hüften, allerdings nur als Abzeichen seines Rangs. Leise schloss Ranulf de Glanville die Tür.
»Ich … wir … es gab einen Streit, und wir haben gekämpft«, stotterte Fulke und fühlte sich dabei ziemlich jämmerlich. Ein heftiger Schmerz hämmerte hinter seiner Stirn.
Lord Walter musterte Fulke mit dem gleichen durchdringenden Blick, mit dem er seine Schüler auf dem Übungsgelände beobachtete. »Gekämpft?«, wiederholte er. Seine Stimme klang so sanft wie immer, Theobald Walter wurde niemals laut. Für gewöhnlich genügten ein Zucken seiner Brauen und ein eindringlicher Blick, um seine Schüler zur Raison zu bringen. »Aus welchem Grund?« Als er neben Fulke niederkniete, knackten seine Gelenke ein wenig. Für seine neununddreißig Jahre war Lord Theobald zwar noch bei bester Gesundheit, aber die englischen Winter forderten von ihm wie von allen anderen ihren Tribut.
Fulke presste die Lippen aufeinander.
»Verbirg uns bloß nichts«, beschwor Lord Walter den Knappen in scharfem Ton. »In einem Fall wie diesem hilft nur die Wahrheit.« Sanft drehte er Johanns Kopf zur Seite und ertastete eine größere Schwellung unter dem Haar. Dann schnupperte er am Atem des Prinzen und zuckte mit einer Grimasse zurück.
Fulke begegnete Lord Theobald voller Vertrauen, er kannte ihn als geduldigen und gerechten Mann. »Prinz Johann hat mich beschuldigt, beim Spiel betrogen zu haben. Als ich das abstritt, hat er mir das Schachbrett auf die Nase geschlagen. Ich …« Fulke reckte sein Kinn empor. »Ich habe um mich getreten, weil ich mich vor ihm schützen wollte. Dabei ist der Prinz nach hinten gefallen und hat sich den Kopf angeschlagen.«
»Wie schlimm steht es um ihn?« De Glanville näherte sich ihnen und blieb an den Füßen des Prinzen stehen. Nachdenklich strich er sich über seinen gepflegten grauen Bart. Dabei malten sich Sorge und Abscheu auf seinem Gesicht.
»Am Hinterkopf hat sich zwar eine beträchtliche Beule gebildet, aber ich glaube nicht, dass wir nach dem Priester schicken müssen«, antwortete Theobald. »Die Bewusstlosigkeit rührt eher daher, dass er voll ist wie ein frisch gezapfter Krug.« Dann sah er Fulke an. »Dagegen wird die Nase dieses jungen Mannes nie wieder so hübsch in seinem Gesicht sitzen wie noch heute Morgen.«
De Glanville hob das schwere Schachbrett vom Boden auf und betrachtete den tiefen Riss, der sich mitten durch das Holz zog. »Wo sind eigentlich die anderen Knappen?« Seine blauen Augen blickten kalt wie blankes Eis.
»Der Prinz hat sie fortgeschickt, Mylord.« Unter den Augen des Obersten Richters fühlte sich Fulke wie eine verirrte Seele vor dem Thron Gottes beim Jüngsten Gericht. »Ich wollte mitgehen, doch der Prinz verlangte mehr Wein … und dann wollte er auf einmal eine Partie Schach mit mir spielen.«
Stöhnend öffnete Prinz Johann die Augen. Sofort richteten sie sich auf Fulke, der sich noch immer über ihn beugte. »Du missgeborener Sohn einer missgeborenen Hure!«, japste er. Dann rollte er zur Seite und erbrach den restlichen Wein des nachmittäglichen Gelages in die Binsen auf dem Fußboden. »Dafür werde ich dir das Fell gerben!«
»Dabei handelt Ihr Euch höchstens einen Schädelbruch ein, Master Johann«, stellte de Glanville mit kühler Stimme fest. Dann wandte er sich an Theobald. »Bring FitzWarin von hier weg und versorge ihn. Dabei könntest du vielleicht die anderen Knappen Seiner Hoheit ausfindig machen. Den Sachverhalt klären wir später.« Da de Glanville zwanzig Jahre älter als sein Neffe war, kniete er sich nicht neben dem Prinzen nieder, sondern nahm lieber auf einer der gepolsterten Bänke Platz und starrte bekümmert wie eine Eule von ihrem Baum auf den der Länge nach ausgestreckt daliegenden jungen Mann hinunter.
Theobald erhob sich und zog Fulke mit sich fort. »Komm«, sagte er streng, aber keineswegs unfreundlich.
»Ich will meinen Vater sprechen!«, forderte Prinz Johann in gereiztem Ton.
Fulke überlief ein Schauder, als sein Lehrer ihn aus der Kammer in den großen Saal führte. Heiß pochte der Schmerz zwischen seinen Augen, und er konnte nur durch den Mund atmen, weil ein metallisch schmeckender Blutklumpen seine Nase verstopfte. »Wird er tatsächlich zum König gehen?«
Lord Theobald konnte ihm nichts Tröstliches sagen. »Nachdem wie ich Johann kenne, ist daran wohl nicht zu zweifeln.«
Fulke drückte den Handrücken sacht gegen seine Nase und besah sich den blutroten Schmierer. »Ich fürchte, man wird mich aus seinem Gefolge entfernen«, orakelte er düster.
»Höchstwahrscheinlich.« Theobald sah Fulke von der Seite her an. »Aber würdest du nach diesem Vorfall denn bleiben wollen?«
»Mein Vater sagt immer, dass die Erziehung am Hof eine unvergleichliche Gelegenheit für mich bedeutet und außerdem eine große Ehre für unsere Familie ist.« Noch während Fulke das sagte, fiel ihm auf, dass er seinen Vater tatsächlich ständig zitierte.
»Da muss ich deinem Vater Recht geben«, bekräftigte der Baron. »Allerdings ist der Preis dafür recht hoch.«
»Mylord?«
»Ach, nichts.« Abrupt blieb Theobald Walter stehen und wandte sich mit ärgerlichem Schnauben nach links.
Erst jetzt bemerkte Fulke, dass das Würfelspiel in einer der vielen Nischen zwischen den Säulen, die die Decke der großen Halle trugen, fortgesetzt wurde. Girard de Malfee hatte schon wieder eine Glückssträhne, was ihm die bewundernden Blicke der rehäugigen Kammerfrau einer hochgestellten Lady eintrug.
»Das reicht!« Entschlossen fuhr Lord Theobald mitten in die Gruppe hinein, wobei seine Fäuste seinen Schwertgurt umfassten. »Verschwindet von hier, und kümmert euch um euren Herrn.«
»Aber er hat uns doch fortgeschickt, Mylord«, wandte Girard mit schwerer Zunge ein.
»Dann schicke ich euch eben wieder zurück. So einfach ist das. Lord de Glanville erwartet euch bereits. Na los, bewegt euch, oder ich lasse euch eine ganze Woche lang Helme polieren! Den Krug lasst ihr hier. Es ist schon genug Unheil geschehen. Das gilt auch für dich, Mädchen. Na los, zurück an die Arbeit!«
Die Kammerfrau beäugte Lord Theobald ängstlich und ärgerlich zugleich und entfernte sich dann hastig mit raschelnden Röcken. Missgelaunt strich Girard seinen Gewinn ein. Als er den Kopf hob und erneut zum Protest ansetzte, fiel sein Blick auf Fulke, der hinter dem Baron stand.
»Jesus Christus, Tollpatsch!« Sein Unterkiefer klappte herunter. »Was ist denn mit dir passiert?«
Jetzt folgten auch die anderen Girards Blick.
»Ich bin gestolpert«, antwortete Fulke.
Theobald Walter fuchtelte ungeduldig in der Luft herum. »Na los, beeilt euch!«, bellte er.
Die besäuselten jungen Männer verdrückten sich stolpernd und leise fluchend. Theobald schüttelte wie ein gereizter Bulle den Kopf. »Möge mich der Herr in seiner großen Güte davor bewahren, dass ich jemals auf Tunichtgute wie diese zählen muss!«, brummte er.
2
Als Fulke und Lord Theobald die Wiese zwischen den Gebäuden überquerten, wo sie am Nachmittag noch gefochten hatten, trieb ihnen der Wind vom Fluss her mit aller Macht einen Schwall eisiger Kristalle entgegen. Fulke hatte das Gefühl, als ob sein Gesicht mit tausend Nadeln traktiert würde. Als sie endlich im Schutz der hölzernen Anbauten auf der Rückseite eines der Palastgebäude angelangt waren, bekam er mit, wie Theobald Walter von einigen anderen Lords begrüßt wurde, die ihn mit neugierigen Blicken musterten, doch alle Fragen wurden von Lord Theobald nur knapp, wenn auch höflich beantwortet. Gleich darauf wurde ein dicker Wollvorhang zur Seite gerafft und Fulke in einen kleinen, nur behelfsmäßig eingerichteten Raum geschoben.
Ein wohl gefülltes Holzkohlenbecken verströmte willkommene Wärme. Auf einer eichenen Reisetruhe hockte Lord Theobalds Knappe, den Fulke vom Sehen her kannte, und stimmte die Saiten seiner maurischen Laute. Außerdem befand sich noch ein Bettgestell im Raum, dessen Bettzeug mit einer grünen Tagesdecke aus flämischem Leinen bedeckt war. Darauf thronte ein Prälat in der üppig bestickten Dalmatica eines Erzdiakons und studierte beim Schein einer dicken Wachskerze ein Pergament.
Ungläubig starrte Lord Theobald auf den Mann. »Hubert?«, rief er dann fragend, als ob er seinen eigenen Augen nicht traute.
Der Priester sah auf und lächelte, wobei sich zwei tiefe Grübchen in seinen wohlgenährten Wangen bildeten. »Ich hoffe doch, dass ich mich in dem einen Jahr nicht allzu sehr verändert habe.« Als der Mann aufstand, schien die Umgebung durch dessen Körpergröße und die schiere Masse seines Leibs zusammenzuschrumpfen.
»Aber nein. Natürlich nicht.« Lord Theobald fasste sich rasch. »Ich habe nur nicht erwartet, dich schon heute Abend hier bei mir anzutreffen.« Die Brüder umarmten einander mit großer Herzlichkeit und klopften sich auf die Schultern. Aus der Nähe betrachtet war die Ähnlichkeit zwischen ihnen unübersehbar. Brauen und Nase stimmten völlig überein und ebenso ihr Lächeln.
»Ich bin pünktlich zur Mittagsmesse in der Abtei eingetroffen«, berichtete Hubert Walter. »Dort werde ich auch übernachten. Aber zuvor wollte ich sehen, wie es Onkel Ranulf und dir inmitten dieser Teufelsbrut ergeht. Ich wollte gerade den jungen Jean nach dir schicken.«
Lord Theobald lachte kurz auf. »Teufelsbrut ist der treffende Ausdruck!«, sagte er. »Wer weiß, was noch alles geschehen wird, wenn erst Richard und Gottfried hier eintreffen.«
»Nun, deswegen versammeln wir uns hier, um die Entscheidung über Prinz Johanns Erbteil zu bezeugen.« Der Erzdiakon deutete auf Fulke, der zitternd neben dem Kohlenbecken stand. »Und wer ist das, Theo, und warum sieht er so aus, als ob er geradewegs vom Schlachtfeld käme?«
Lord Theobald schnitt eine Grimasse. »In gewisser Weise stimmt das sogar. Ich unterrichte ihn im Waffenhandwerk und bin deshalb für ihn verantwortlich.« Er winkte Fulke nach vorn. »Erweise dem Erzdiakon von York deine Ehrerbietung«, befahl er. »Das ist Fulke FitzWarin von Lambourn«, wandte er sich dann wieder an seinen Bruder. »Der Sohn von Fulke le Brun. Er dient in Onkel Ranulfs Haushalt, und zwar als Knappe von Prinz Johann.«
»Euer Gnaden«, brachte Fulke mit erstickter Stimme hervor und beugte das Knie, um den Ring des Erzdiakons zu küssen.
»Wie es aussieht, hat er dabei ein gebrochenes Nasenbein und zwei blaue Augen davongetragen«, bemerkte Hubert. Mit seiner großen Hand umfasste er Fulkes Kinn und nahm den Schaden genauer in Augenschein. »Was hast du nur angestellt, um dir das einzufangen?«
»Ich habe Schach gespielt, Euer Gnaden.«
Huberts Augenbrauen reichten fast bis an den braunen Haarkranz seiner Tonsur.
»Mit Prinz Johann«, erläuterte Lord Theobald und machte seinem Knappen ein Zeichen. »Jean, bring uns Wasser und ein Stück Leinen.«
»Sir.« Der junge Mann legte die Laute aus der Hand und stand auf.
»Ach, ja?«, bemerkte der Erzdiakon. »Und darf man fragen, wer gewonnen hat?«
»Ich fürchte, das wird eine größere Versammlung zu entscheiden haben – falls der Prinz seinen Willen bekommt«, bemerkte Theobald voller Abneigung. »Fürs Erste darf ich festhalten, dass der junge Fulke hier ebenso viel ausgeteilt hat, wie er eingesteckt hat.«
»Ich verstehe.« Der Erzdiakon rollte das Pergament zusammen und schob es in seinen Ärmel. »Also eine heikle Angelegenheit.«
»Eigentlich nicht, wenn sie nicht ausgerechnet der Ansicht des Prinzen in die Quere käme, dass er längst die nötige Reife hat, um Anspruch auf eigene Ländereien zu erheben – nun ja, seit den Eskapaden des ältesten Sohnes wissen wir ja, wie so etwas enden kann.« Achtzehn Monate zuvor war König Heinrichs Erbe und Namensvetter, ein kraftloser, seichter junger Mann, während seines jämmerlichen Feldzugs um Macht und Einfluss gegen die eigene Familie in Aquitanien an der Ruhr gestorben. Theobald gab einen ärgerlichen Laut von sich. »Prinz Johann müsste die Schuld ganz allein bei sich suchen.«
»Und genau das tut er nicht. Es sind Männer wie du und ich, mein lieber Theo, die die Auswüchse des angevinischen Charakters mildern und ausgleichen müssen.« Hubert Walter nahm seinen Umhang vom Bett und legte ihn sich um die Schultern. »Willst du mich nicht in die Abtei begleiten?«, schlug er vor. »Jean kann sich doch um den jungen Mann kümmern, und meine Unterkunft ist auf jeden Fall sehr viel annehmlicher als diese hier.«
Lord Theobald überlegte einige Augenblicke und nickte dann. »Bereite noch eine weitere Bettstatt, Jean«, ordnete er an. »Fulke wird heute Nacht hier schlafen.«
»Mylord.« Mit einer Messingschale und einem Leinentuch in der Hand wandte sich der Knappe von den Gepäckkisten ab, in denen er herumgekramt hatte. »Und wie steht es mit dem Essen?«
»Ich werde mit dem Erzdiakon speisen. Am besten holst du etwas für Fulke und für dich aus der Küche und bringst es hierher.«
Das lebhafte Mienenspiel des Knappen spiegelte seine Enttäuschung wider.
»Das ist ein Befehl, Jean«, setzte Lord Theobald ernst hinzu. »Die Wellen sind heute, weiß Gott, schon hoch genug geschlagen, um leicht einen Sturm nach sich zu ziehen. Besser, ihr haltet euch heute Abend von der großen Halle fern.«
»Mylord.« Jeans Enttäuschung war so deutlich zu hören, dass Theobald ihm noch einmal mit dem Finger drohte, bevor er zusammen mit seinem Bruder das Quartier verließ.
Jean fluchte vernehmlich, während der Vorhang noch einige Male hin und her schwang und schließlich zur Ruhe kam.
Fulke räusperte sich. »Meinetwegen kannst du ruhig in die große Halle gehen. Ich komme auch allein zurecht.«
Jean schnaubte. »Hast du schon einmal eine übel zugerichtete Leiche gesehen? Das ist wahrlich kein schöner Anblick.« Dann legte er den Kopf auf die Seite, und seine dunklen Augen leuchteten auf. »Viel besser siehst du im Moment jedenfalls nicht aus.« Er kam mit der Schale und dem Tuch auf Fulke zu. »Habe ich da richtig gehört? Hast du dich tatsächlich mit Prinz Johann geprügelt?«
»Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit«, bestätigte Fulke mit aller Vorsicht, denn seit seiner Ankunft bei Hof war sein argloses Vertrauen mindestens so oft enttäuscht worden wie sein Leib misshandelt.
»Ehrlich gesagt, sieht das nach sehr viel mehr aus.«
Fulke wappnete sich gegen den Schmerz, indem er alle Muskeln anspannte, aber Jean hantierte überraschend geschickt und vorsichtig, als er das getrocknete Blut abwischte und die Nase genauer untersuchte.
»Du wirst wohl einen deutlichen Höcker auf dem Nasenbein zurückbehalten«, prophezeite er. »Ich dachte, Schach ist ein Spiel und keine Leibesübung.«
Behutsam betastete Fulke die Verletzung. Die Nase war angeschwollen, und der Knochen fühlte sich seltsam weich an. Er konnte froh sein, dass es in diesem Raum keinen Spiegel gab, dachte er. »Das ist auch nicht meine Art, Schach zu spielen«, rechtfertigte er sich. »Aber Prinz Johann kann offenbar nicht anders.« Überdeutlich kamen ihm wieder die Einzelheiten des Kampfs in den Sinn: das Knirschen des Nasenknorpels, als ihn das Schachbrett traf, sein wütender Tritt und anschließend Prinz Johanns Sturz.
Wissend verdrehte Jean die Augen. »Auf dem Übungsplatz habe ich seine Durchtriebenheit und Gemeinheit oft genug beobachtet. Lord Theobald ist der Meinung, dass Prinz Johann weder Ehrgefühl noch Disziplin besitzt.«
Damit war Fulke voll und ganz einverstanden, aber er runzelte trotzdem die Stirn. »Hältst du es für klug, deine Meinung mir gegenüber so frei zu äußern, obwohl du mich kaum kennst? Was, wenn ich zu Prinz Johann ginge und ihm deine Worte wiederholte?«
»Guter Gott, ich stünde sicher keinen Tag länger in Lord Theobalds Diensten, wenn ich nicht wüsste, wann ich frei sprechen kann und wann ich mich zügeln muss.« Jeans Grinsen entblößte eine Menge weißer Zähne. »Außerdem habe ich ja auch dich oft genug beim Fechten beobachtet. Du besitzt genau die Eigenschaften, die Prinz Johann fehlen. Hier.« Er drückte Fulke einen Becher in die Hand. »Trink das. Es wird den Schmerz zwar nicht unbedingt betäuben, aber auf jeden Fall tröstet es dich.«
Fulke versuchte ein Lächeln. Dann trank er einen Schluck und spürte, wie die Hitze seinen Gaumen versengte, während die Süße noch einige Augenblicke lang auf seiner Zunge verweilte.
»Der Met aus Galloway wird dir bis morgen Vergessen schenken«, meinte Jean und bediente sich ebenfalls. Er prostete Fulke zu und ließ den Inhalt seines Bechers in einem einzigen Zug durch seine Kehle rinnen. Dann streckte er Fulke die Hand hin.
»Ich weiß, dass du Fulke FitzWarin bist, aber mich hat noch keiner vorgestellt. Ich heiße Jean de Rampaigne und diene Lord Theobald Walter als Knappe und Kampfgefährte. Falls mein Französisch komisch klingt, so liegt das an meinem aquitanischen Akzent. Meine Mutter stammt von dort, hat aber einen englischen Ritter geehelicht – so wie Königin Eleonore einst König Heinrich geheiratet hat.« Ein Lächeln huschte über Jeans Gesicht. »Zum Glück habe ich keine weiteren Brüder, mit denen ich um mein Erbe streiten müsste.« Er legte eine effektvolle Pause ein. »Aber leider gibt es auch kein Erbe.«
Leicht verwundert ergriff Fulke die angebotene Hand und schüttelte sie. Bei den Waffenübungen war ihm nie aufgefallen, wie redselig dieser Jean sein konnte. Er trank noch einen Schluck Met und spürte, wie sich die Wärme wie flüssiges Gold in seinem Körper ausbreitete. Entweder hatte Jean Recht, und das Zeug konnte tatsächlich über den Schmerz hinwegtrösten, oder er gewöhnte sich bereits an das heftige Pochen in seiner misshandelten Nase.
»Ich dagegen habe fünf Brüder«, bemerkte Fulke, »aber so wie Prinz Johann ist keiner von ihnen… Jedenfalls glaube ich das. Über Alain lässt sich allerdings noch nicht viel sagen, er ist gerade erst vier Jahre alt.«
»Wer weiß, wer weiß«, meinte Jean mit verschmitztem Grinsen, »womöglich gibt es mehr Ähnlichkeiten, als du ahnst. Schließlich führt sich der Prinz ja oft genug wie ein Vierjähriger auf.«
Fulke prustete los, doch ein heftiger Schmerz bereitete seinem Lachen sogleich ein Ende. »Sag so etwas nicht!«
»Es ist die Wahrheit. Und Lord Theobald sagt das auch.«
Mein Vater sagt. Fulke schnitt eine Grimasse. Offenbar brauchte jeder Mensch eine höhere Autorität, auf die er sich berufen konnte. Bis hinauf zum Allerhöchsten. Er trank noch einen Schluck und stellte überrascht fest, dass der Becher schon leer war.
»Ich wusste gar nicht, dass Lord Theobalds Bruder der Erzdiakon von York ist«, sagte er dann, um das Thema zu wechseln.
Jean setzte sich wieder auf die Truhe und nahm die Laute zur Hand. »Eines Tages wird er noch sehr viel mehr sein als das«, meinte er, während er die roten und blauen Seidenbänder am Hals der Laute entwirrte. »Ich weiß aus sicherer Quelle, dass ihr gemeinsamer Onkel Ranulf de Glanville sich mit dem Gedanken trägt, den Posten des Obersten Richters zu gegebener Zeit an Hubert Walter weiterzugeben.« Er ließ ein paar kurze Tonfolgen erklingen.
»Ich dachte immer, dass ein solches Amt nicht erblich ist.«
»Das ist es auch nicht, aber für gewöhnlich lernt der Vorgänger seinen Nachfolger an, und das ist in vielen Fällen ein Verwandter, ob einem das nun gefällt oder nicht. Du wirst schon erleben, dass Hubert Walter das Amt bekommt. Er hat die Ausbildung, die dazu nötig ist, und er hat den nötigen Verstand.« Jean tippte sich gegen die Stirn. »Und den wird er brauchen, wenn er mit König Heinrich und seinen Söhnen auskommen will.«
Fulke nickte. »Dazu muss er nicht Erzdiakon sein«, meinte er, »sondern ein Heiliger.« Seine Zunge stolperte ein wenig, und das laute Gurgeln in der Gegend seines Gürtels erinnerte ihn daran, dass er infolge der dramatischen Ereignisse seit dem Frühstück nichts mehr zu sich genommen hatte. Jeans starkes Gebräu hatte nicht nur seinen Kopf, sondern auch seine Magensäfte in Bewegung gebracht.
Jean sprang von der Truhe herunter und nahm Fulke den leeren Becher ab. »Du musst unbedingt etwas essen, sonst hast du bald einen kräftigen Rausch. Na los, komm mit!«
Fulke starrte Jean aus großen Augen an. »Aber Lord Theobald hat doch gesagt, dass wir hierbleiben sollen. Und er hat gedroht, dass er dich in der Luft zerreißen wird, wenn du nicht gehorchst.«
Jean breitete die Arme aus. »Mein Herr hat lediglich gesagt, dass wir uns nicht in der großen Halle blicken lassen sollen. Falls du den Prinzen nicht für immer niedergestreckt hast, wird er nämlich dort zu Abend essen. Wenn du mich fragst, hat Lord Walter sicher nichts gegen einen kleinen Ausflug einzuwenden, solange wir nur dem Prinzen aus dem Weg gehen.«
Fulke hatte zwar seine Zweifel, doch sein Hunger und Jeans Begeisterung ließen ihn sie schnell vergessen. Außerdem war er selbst mit gebrochener Nase jederzeit zu Abenteuern aufgelegt. »Und wohin gehen wir?«
»In die Küche«, gab Jean zurück. »Wohin sonst?«
In der Palastküche war Jean gut bekannt, wie man unschwer an der Begrüßung erkennen konnte. Die schwitzende Oberköchin verscheuchte die beiden jungen Männer mit energischen Gesten von ihrem Herd, wo sie gerade die letzten Vorbereitungen für das Bankett in der großen Halle traf. Aber gleich darauf fanden die beiden in einer Ecke bei einer sehr viel umgänglicheren rotgesichtigen Frau ein neues Plätzchen. Ungeachtet der gehobenen Stellung der jungen Männer stellte die Köchin als Erstes eine Schüssel voll gekochter Eier zum Schälen auf den Tisch – sie waren für die königliche Tafel bestimmt und um diese Jahreszeit eine seltene Köstlichkeit.
»Wenn Ihr essen wollt, müsst Ihr wie alle auch dafür arbeiten«, sagte sie gut gelaunt auf Französisch mit starkem angelsächsischen Akzent. Dann hob sie Fulkes Gesicht mit ihrer nach Zwiebeln duftenden Hand in die Höhe. »Alle Heiligen, junger Herr, was habt Ihr denn angestellt?«
Bevor Fulke eine unverfängliche Antwort geben oder sagen konnte, dass sie sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern sollte, mischte sich ein junger Mann in ihre Unterhaltung ein, der damit beschäftigt war, die Platten für die königliche Tafel zu füllen.
»Von ihm habe ich dir vorhin erzählt, Marjorie. Er hat Prinz Johann fast bewusstlos geschlagen.«
»Das ist nicht wahr«, protestierte Fulke und fragte sich zugleich bestürzt, wie die Neuigkeit nur so schnell die Runde machen konnte.
»Jammerschade«, bemerkte Marjorie bissig. »Jedenfalls sieht es ganz so aus, als ob Ihr auch etwas abbekommen hättet.«
»Ich …«
»Der Prinz hat ihm ein Schachbrett auf die Nase geschlagen«, verkündete der junge Mann genüsslich. Offenbar verbreitete er gar zu gern Schauermärchen.
Grinsend schlug Jean ein Ei gegen den Schüsselrand. »Wie du siehst, muss man nicht unbedingt an Türen horchen, um den neuesten Tratsch zu erfahren. Eine Stunde in der Küche genügt – und schon erzählt man dir, wessen Frau gerade mit wem ins Bett geht, wer in der Gunst ganz oben steht, wer selbige verloren hat und welche Farbe die Morgenpisse König Heinrichs hat.« Er duckte sich hastig, um Marjories Klaps auszuweichen. »Obendrein bekommst du hier besseres Essen als selbst an der königlichen Tafel – auch wenn du dafür ein paar Eier schälen musst.«
»Diese kleine Anstrengung würde dem Prinzen auch nicht schaden«, meinte Marjorie und nickte Fulke aufmunternd zu. »Tut mir leid, dass er Euch so zugerichtet hat, aber es freut mich, dass Ihr es ihm heimgezahlt habt. Man hätte ihm von klein auf mehr Anstand beibringen müssen. Wenn Ihr mich fragt, hat Königin Eleonore ein Kind zu viel zur Welt gebracht.«
»Gerüchten zufolge ist die Königin ganz deiner Meinung«, sagte Jean. »Als sie Prinz Johann erwartete, zählte sie schon fünfundvierzig Jahre, und König Heinrich hat sich mit einer jungen Geliebten amüsiert.«
»Das stimmt. Kein Wunder, dass sich Prinz Johann als fauler Apfel entpuppt hat«, schnaubte Marjorie. »Die Eltern zerstritten, ebenso die Brüder. Da glaubt man doch nur zu gern, was man sich erzählt – dass sie allesamt vom Teufel abstammen.« Sie bekreuzigte sich.
»Was ist denn das für eine Geschichte?«, wollte Fulke wissen.
Marjorie stellte zwei flache Schüsseln vor die jungen Männer auf den Tisch und füllte sie mit einem großzügig bemessenen Stück vom gebratenen Eber. Dazu gab es eine würzige Sauce aus einem Kessel und einen kleinen Laib Weizenbrot. Da es Fulke vor Hunger schon fast übel war, ließ er sich nicht lange bitten und machte sich mit seinem Messer über das Essen her. Die einzige Schwierigkeit war, dass er nicht gleichzeitig Luft holen und kauen konnte.
Marjorie holte eine weitere Schüssel Eier und setzte sich zum Schälen zu den jungen Männern. »Vor langer Zeit«, begann sie, »hat sich einer ihrer Vorfahren, ein früherer Herzog von Anjou, in eine wunderschöne Frau namens Melusine verliebt.« Marjorie sprach so laut und deutlich, dass alle in der Küche sie hören konnten. Lieder und Geschichten waren bei den Leuten sehr beliebt, weil sie den einzigen Zeitvertreib darstellten und die schwere Arbeit versüßten. »Ihr helles Haar schimmerte silbrig, als ob es aus Mondlicht gesponnen wäre, und ihre Augen waren so grün und klar, dass man darin schwimmen konnte – oder ertrinken. Der Herzog heiratete die schöne Melusine, und sie bekamen zwei Kinder. Einen Knaben und ein Mädchen, die beide so schön waren wie ihre Mutter. Alles wäre in bester Ordnung gewesen, wenn nur Melusine nicht so ungern zur Kirche gegangen wäre. Und wenn sie ab und zu doch einmal die Messe besuchte, so blieb sie nie bis zum Ende, sondern schlich sich immer durch eine Seitentür davon, bevor die Hostie am Altar gezeigt wurde. Einige der Höflinge befürchteten, dass Melusines Schönheit und der Bann, den sie auf den Herzog ausübte, nicht natürlichen Ursprungs waren, sondern auf schwarzer Magie beruhten.« Marjorie legte eine kleine Pause ein, um das Gehörte auf ihre Zuhörer wirken zu lassen. Mitten in die Stille hinein musste Fulke leise aufstoßen. Als er sich dann auch noch die Finger ableckte, schlug Marjorie geräuschvoll das nächste Ei gegen die Schüssel.
»Und weiter?«, fragte Fulke.
»Die Gefolgsleute beschlossen also, die schöne Herzogin auf die Probe zu stellen und sie bei der nächsten Messe nicht aus der Kapelle entkommen zu lassen. Sie verbarrikadierten die Türen und stellten überall Wachen auf. Bevor die Monstranz erhoben wurde, wollte die Lady wie immer heimlich verschwinden, aber vergeblich. Der Priester besprengte sie mit heiligem Wasser, worauf ihr ein bestialischer Schrei entfuhr. Im selben Moment verwandelte sich ihr Mantel in die Schwingen einer riesigen Fledermaus, und sie flog durch das Fenster davon und wurde nie mehr gesehen. Doch die Kinder, die sie zurückließ, trugen das Blut des Dämons in ihren Adern. Der Junge wuchs heran und wurde nach dem Tod seines Vaters der nächste Herzog von Anjou, und ebendieser Herzog war der Ururgroßvater unseres Königs.« Bekräftigend nickte Marjorie mit dem Kopf.
»Solche Ammenmärchen glaubst du doch nicht etwa, oder?«, fragte Fulke zweifelnd.
Marjorie kehrte die Eierschalen in ihre Schürze. »Ich weiß nur, was man mir erzählt hat. Ohne Feuer gibt es nun einmal keinen Rauch.«
»In meiner Familie erzählte man sich lange Zeit, dass mein Großvater mit einem Riesen gekämpft hätte. Doch mein Großvater hatte die Geschichte nur zur Unterhaltung meines Vaters erfunden, als dieser noch klein war.«
»Das mag sein, junger Mann, aber so leicht überzeugt Ihr mich nicht. Ihr müsst Euch die Familie doch nur ansehen, um zu spüren, dass sie anders ist. Wenn Prinz Johann nicht von einem Dämon besessen ist, dann fresse ich meine Schürze mitsamt den Eierschalen.«
Während sie zum Abfall ging, nahm Fulke das letzte Stück Fleisch und die Sauce mit dem Rest des kleinen Brotlaibs vom Teller und schob es sich in den Mund.
Jean griff nach der Laute und ließ seine Finger spielerisch über die Saiten gleiten. »Das wäre der geeignete Stoff für eine Ballade«, sagte er. »Die schöne Melusine.« Eine Kaskade perlender Töne strömte aus dem Bauch des Instruments hervor.
Fulke lauschte fasziniert. Er liebte Musik, und die aufreizenden Kriegslieder und walisischen Balladen hatten es ihm besonders angetan, aber mit seinem eigenen Talent brachte er in dieser Hinsicht nichts zustande. Laute spielen konnte er nicht, und sein Stimmbruch war noch nicht lange her, sodass man erst erahnen konnte, welch tiefe und volltönende Stimme er als ausgewachsener Mann einmal haben würde. Im Moment ähnelte sein Gesang eher dem Gejaule eines eingekerkerten Köters.
»Eine Laute kann Türen öffnen, die Stiefeln und Schwertern verschlossen bleiben«, sagte Jean. »Die Männer heißen dich willkommen, weil du Freude und Abwechslung in ihre Häuser bringst, man bezahlt dir dein Essen, und wildfremde Menschen begegnen dir offen und freundlich. Und ab und zu verschaffen dir die Frauen sogar Zugang zu ihrem Allerheiligsten.« Dabei zuckten seine Augenbrauen anzüglich.
Fulke wurde rot. Für einen jungen Mann wie ihn waren Frauen und ihr Allerheiligstes zwar von höchstem Interesse, doch gleichzeitig noch ein Geheimnis. Hochgestellte Frauen hatten ihre Anstandsdamen und lebten bis zu ihrer Hochzeit sehr zurückgezogen. Einfache Mädchen, die auf ihren guten Ruf bedacht waren, hielten sich möglichst von allem und jedem fern, die leichtfertigen strebten eher nach einem königlichen Lager als nach der Bettstatt eines Knappen, und die Kurtisanen am Hof bevorzugten ohnehin Männer mit gesichertem Einkommen. So kam es, dass Fulke außer den grundlegendsten Dingen, die jeder wusste, noch völlig ahnungslos war. Aber es verlangte ihn gewiss nicht danach, sein Unwissen an die große Glocke zu hängen.
Über die Laute gebeugt ließ Jean sozusagen als Entgelt für die köstliche Mahlzeit eine kleine Melodie anklingen. Und als er gleich darauf die Ballade der schönen Melusine zum Besten gab, schallte seine Stimme klar und voll wie der Klang einer Glocke durch den Raum und übertönte sogar das Geklappere der Töpfe und des Geschirrs. Fulke war hingerissen. Dies war eine Gabe, die er nur zu gern selbst besessen hätte. Er sog die Worte und Töne in sich hinein und beobachtete, wie ehrfürchtig Jean seine Laute behandelte, sah, wie seine Finger über die Saiten eilten, und fühlte sich an das Bild seiner eigenen Finger erinnert, die mit ebensolcher Inbrunst die Scharten auf dem Schild auswetzten.
Mit einem Mal war alle Freude verflogen. Und während Jeans Stimme noch auf der letzten Note verweilte, sprang Fulke urplötzlich auf und steuerte auf die Tür zu.
Ohne den lautstarken Applaus mit weiteren Liedern zu belohnen, verbeugte sich Jean hastig und rannte seinem Schützling nach. »Wo willst du hin?«, rief er und packte Fulke am Ärmel.
»Mein Schild! Ich habe ihn in Prinz Johanns Räumen liegen lassen.«
»Aber dort kannst du jetzt unmöglich hingehen!«, rief Jean erregt. »Ein Ausflug in die Küche ist eine Sache, aber Lord Theobald wird uns gehörig die Leviten lesen, wenn wir uns Prinz Johanns Gemächern auch nur nähern!«
»Aber der Schild ist ganz neu!«, widersprach Fulke bockig. »Mein Vater hat ihn mir gerade erst zum Geburtstag geschenkt.«
»Bei den Wunden unseres Herrn! Bist du wirklich so kindisch, dass du den Schild unbedingt heute Abend wiederhaben musst?« Zum ersten Mal huschte ein Anflug von Ärger über Jeans freundliche Züge. »Er wird morgen auch noch dort sein.«
»Du verstehst nicht. Das ist eine Frage der Ehre.«
»Sei kein Narr. Ich …«
»Du kannst mitkommen, oder du kannst es bleiben lassen. Das liegt allein bei dir«, unterbrach ihn Fulke seelenruhig. »Mich wirst du jedenfalls nicht aufhalten.« Damit machte er kehrt und trat in die stürmische Nacht hinaus. Im Lauf des Abends war es immer kälter geworden, und aus Graupeln waren Schneeflocken geworden, die ihn augenblicklich in wirbelndes Weiß einhüllten.
Jean zögerte einen Moment und hastete dann fluchend hinter Fulke her. »Prinz Johann sitzt zwar im Augenblick vermutlich in der Rufus Hall beim Essen, aber das ist noch lange kein Grund, das Schicksal herauszufordern.«
»Ich fordere nichts und niemanden heraus«, entgegnete Fulke kalt. »Ich will nur holen, was mir gehört.« Mit ausgreifenden Schritten ging er davon, und seine Stiefel hinterließen feuchte dunkle Abdrücke auf dem frisch beschneiten Gras.
Jean stieß eine Reihe von Verwünschungen aus, während er mit gesenktem Kopf gegen den Wind ankämpfte, um mit Fulke Schritt zu halten.
Die Tür zu den königlichen Gemächern war geschlossen, und ein Soldat hielt davor Wache. Das flackernde Licht einer Fackel tanzte über den Kettenpanzer und den Helm, sodass die Eisenringe golden schimmerten, und ab und zu blitzte es in der bedrohlich scharfen Lanzenspitze auf.
Mit ernster Miene musterte der Wachsoldat die beiden jungen Männer. »Was habt ihr hier zu suchen?«
Fulke hatte ein gutes Gedächtnis für Gesichter und kannte alle Soldaten, die für gewöhnlich den Wachdienst versahen. Roger bellte zwar, aber beißen war nicht seine Sache. »Ich habe vorhin meinen Schild vergessen, Sir«, erklärte er, »und würde ihn jetzt gern holen.«
»Ich bin über das ›Vorhin‹ sehr wohl im Bilde.« Prüfend betrachtete der Mann Fulkes Verletzung. »Nur gut, dass ich zu dieser Zeit keinen Dienst hatte«, bemerkte er säuerlich. »Mein Kamerad wird sicher ausgepeitscht, weil er den Streit nicht unterbunden hat.«
»Bestimmt konnte er uns nicht hören, denn wir befanden uns nicht in der Nähe der Tür«, erklärte Fulke. »Außerdem war es schon den ganzen Nachmittag über ziemlich laut.«
»Nun, irgendjemand muss wohl büßen, oder nicht?« Der Soldat fuchtelte mit seiner Lanze in der Luft herum. »Na los, verschwindet endlich, bevor es noch mehr Ärger gibt.«
Fulke straffte seine Schultern. Mit seinen fünfzehn Jahren maß er knapp zwei Yards und war damit größer als die meisten erwachsenen Männer. Auch den Wachsoldaten überragte er mit Leichtigkeit. »Ich will nur meinen Schild holen, Sir«, wiederholte er. »Ich gehe erst weg, wenn ich ihn habe.«
»Hört mir gut zu: Ich nehme keine Befehle von einem Grünschnabel entgegen, wie Ihr einer…«
Jean unterbrach den Mann, indem er einen Schritt nach vorn trat. »Mylord Walter hat uns nach dem Schild geschickt. Im Moment befindet sich Master FitzWarin in seiner Obhut.«
»Lord Walter hat euch geschickt?« Der Mann zog die Brauen in die Höhe.
»Ja, Sir. Wie Ihr wisst, ist er für die Waffenübungen von Lord Glanvilles Schülern verantwortlich. Er möchte den Schild sehen.«
»Warum habt Ihr das nicht gleich gesagt?«, brummelte der alte Mann. Er öffnete die Tür und ließ Jean eintreten. »Ihr nicht«, sagte er und vertrat Fulke den Weg. »Dazu ist mir mein Leben zu teuer. Ich habe nicht die Absicht, für derlei Kindereien zu hängen.«
Wenige Augenblicke später kehrte Jean zurück. Er trug den Schild so, dass das Wappen nach innen gekehrt war und man nur die hölzerne Rückseite und die Tragegurte sah.
»Na, zufrieden?« Der Wachsoldat schloss die Tür und nahm wieder mit breit gestellten Beinen seine Stellung ein, um den jungen Männern deutlich zu machen, dass er nicht noch einmal weichen würde.
»Vielen Dank, Mylord«, sagte Jean mit einer Verbeugung, um der Eitelkeit des Soldaten zu schmeicheln. Dann machte er kehrt und ging mit raschen Schritten davon.
Hastig rannte Fulke ihm nach. »Was versteckst du denn da?« Er packte seinen Schild. »Na, los. Gib ihn her!«
Zögernd gab Jean dem ungestümen Drängen nach. »Es hat absolut keinen Sinn, wenn du jetzt wieder die Beherrschung verlierst.« Beschwichtigend legte er Fulke die Hand auf den Arm.
Doch Fulke starrte nur stumm auf den Schild hinunter, den er heute Nachmittag noch so sorgfältig bearbeitet hatte. Das glatte bemalte Leder war mehrmals mit einer Messerspitze durchbohrt worden, sodass das Bild des Wolfskopfs fast völlig zerstört war. Die Stiche waren mit solcher Kraft und Bosheit ausgeführt worden, dass sie tiefe Kerben im darunter liegenden Holz verursacht hatten.