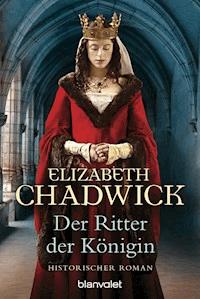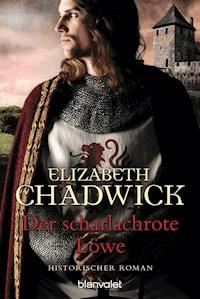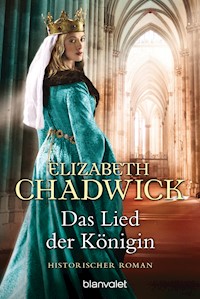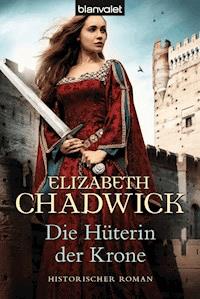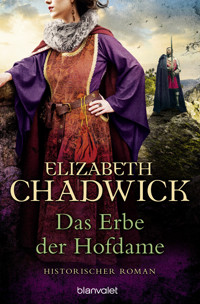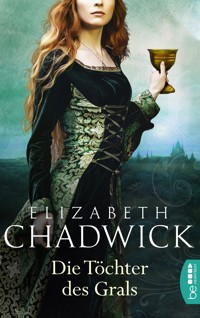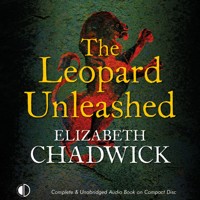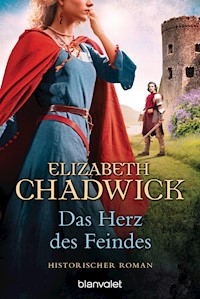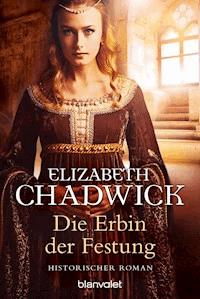
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
England 1148. Brunin FitzWarin ist ein stilles, in sich gekehrtes Kind. Deshalb schickt ihn sein Vater auf die Burg von Ludlow, wo er zu einem starken und unerschrockenen Ritter ausgebildet werden soll. Zwischen Falkenjagden und Kriegszügen verbringt der Junge seine Zeit mit der Tochter des Burgherrn. Der scheue Brunin und die temperamentvolle Hawise freunden sich an. Und eines Tages spüren sie, dass aus ihrer Jugendfreundschaft Liebe geworden ist. Doch ihr Glück ist Gefahren ausgesetzt, denen Brunin mit aller Kraft trotzen muss …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 930
Ähnliche
Buch
England 1148. Brunin FitzWarin ist ein stilles, in sich gekehrtes Kind. Deshalb schickt ihn sein Vater auf die Burg von Ludlow, wo er zu einem starken und unerschrockenen Ritter ausgebildet werden soll.
Zwischen Falkenjagden und Kriegszügen verbringt der Junge seine Zeit mit der Tochter des Burgherrn. Der scheue Brunin und die temperamentvolle Hawise freunden sich an.
Und eines Tages spüren sie, dass aus ihrer Jugendfreundschaft Liebe geworden ist. Doch ihr Glück ist Gefahren ausgesetzt, denen Brunin mit aller Kraft trotzen muss …
Autorin
Elizabeth Chadwick lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in Nottingham. Sie hat zahlreiche historische Romane geschrieben, die allesamt im Mittelalter spielen. Vieles von ihrem Wissen über diese Epoche resultiert aus ihren Recherchen als Mitglied von Regia Anglorum, einem Verein, der das Leben und Wirken der Menschen im frühen Mittelalter nachspielt und so Geschichte lebendig werden lässt.
Inhaltsverzeichnis
Knabe und Mädchen
1
Petersmarkt, Shrewsbury, August 1148
An dem Tag, an dem Brunin FitzWarin den Männern begegnete, die sein Leben verändern und prägen sollten, war er zehn Jahre alt und schlenderte unbeaufsichtigt zwischen den Ständen des Petersmarktes umher.
Mark, der Sergeant seines Vaters, der auf ihn aufpassen sollte, hatte sich von einem randvollen Krug und der drallen Tochter einer Schankwirtin, die an einem der Stände Bier verkaufte, ablenken lassen. Als ihm die Tändelei der beiden zu langweilig wurde, war Brunin davongestromert, um auf eigene Faust die Marktstände zu erkunden. Er war ein schlaksiger Junge mit olivfarbener Haut und so tiefbraunen Augen, dass sie beinahe schwarz wirkten. Von ihnen leitete sich auch sein Spitzname ab, denn eigentlich hieß er Fulke, genau wie sein Vater. Seine fünf Brüder hatten das blonde Haar und die helle Haut der Eltern. Brunin, sagten die Wohlmeinenderen, kam nach seinem Großvater, einem lothringischen Söldner von zweifelhafter Herkunft. Weniger Wohlmeinende behaupteten hinter vorgehaltener Hand, er sei ein Wechselbalg, ein Kuckucksei, welches das Feenvolk von den walisischen Hügeln den Eltern ins Nest gelegt habe.
Er kam an einer Garküche vorbei, an der weiche Haferpfannkuchen auf einem runden Blech flink gewendet und an Vorübergehende verkauft wurden. Eine Frau hatte gerade ein paar davon erstanden und verteilte sie unter ihren aufgeregt um sie herumflatternden Sprösslingen. Ärgerlich wies sie eines der Kinder zurecht, doch schon im nächsten Moment zerzauste sie liebevoll sein Haar. Als sie Brunins sehnsüchtigen Blick bemerkte, lächelte sie, riss ein Stück von einem übrig gebliebenen Haferpfannkuchen ab und hielt es ihm hin, als wolle sie ein scheues Tier anlocken. Brunin schüttelte den Kopf und ging hastig weiter. Es war nicht der Pfannkuchen, dem sein Blick gegolten hatte.
»Krüge und Kannen!«, rief ihm ein Händler entgegen. »Zweiquartpötte und Töpfe! Feinste Ware aus Stamford und Nottingham!« Der Mann schwenkte eine grün glasierte Kanne in der Luft, deren Ausguss wie ein grinsendes Gesicht geformt war. Verbissen und mit geröteten Wangen feilschte eine kiebige Hausfrau mit seinem Gehilfen um den Preis eines Kochgefäßes.
Jeden Sommer kamen die Händler für drei Tage nach Shrewsbury und breiteten ihre Waren im Schatten der großen Benediktinerabtei Sankt Peter und Paul aus. Selbst die Wirren des Bürgerkriegs zwischen den Anhängern von König Stephan und Kaiserin Mathilde konnte die Lust der Menschen am Feilschen und dem Betrachten der Kuriositäten nicht dämpfen. Brunins Vater meinte, dass die unruhigen Zeiten den Jahrmarkt höchstens noch beliebter machten, da die Männer hier Verbündete treffen und ihre Anliegen besprechen konnten, während sie für den unbeteiligten Beobachter nur ganz gewöhnlichen Geschäften nachgingen.
Und eben das tat sein Vater gerade: Er unterhielt sich mit alten Freunden und hatte Brunin deshalb in Marks Obhut gegeben. Sie würden FitzWarin auf dem Rossmarkt treffen, wenn die Glocke der Abtei zur Sext läutete. Brunin sollte ein neues Pony bekommen, da er für den kleinen braunen Waliser, den er seit seinem sechsten Lebensjahr ritt, bald zu groß sein würde. Spinnenbein hatte seine Großmutter ihn letzte Woche genannt, als sei sein plötzliches Wachstum eine Sünde.
Das Geschrei der Händler stürmte von allen Seiten auf ihn ein. Das Latein und Französisch der wohlhabenderen Kaufleute war ihm vertraut. Hier und da erhob sich eine walisische Stimme über das vorherrschend englische Stimmengewirr. Brunin beherrschte auch ein paar Brocken der beiden letzten Sprachen – doch er achtete darauf, dass seine Großmutter ihn so nicht sprechen hörte, es sei denn, er legte es darauf an, sie zu ärgern.
Um die Tuchstände hatten sich ganze Trauben von Frauen versammelt, die beäugten und befingerten, diskutierten, begehrliche Blicke warfen und gelegentlich auch kauften. Brunins Mutter besaß ein seidenes Gewand in dem gleichen rotgolden schimmernden Ton wie der Stoff eines der Ballen, der über einen Warentisch gebreitet lag. Er hatte es in ihrer Kleidertruhe gesehen, doch sie trug es nur selten. Sie hatte ihm einmal mit ausdrucklosem Blick erzählt, dass es ihr Hochzeitskleid gewesen war.
Brunin blieb beim Karren eines Händlers stehen, um einen Wurf gescheckter Jagdhundwelpen zu streicheln. Der Mann hatte auch zwei winzige Hunde mit langem seidigem Fell im Angebot, um deren Hals bunte Bänder geschlungen waren. Ihr Kläffen gellte schrill in Brunins Ohren. Er versuchte, sich solche Schoßhündchen im Haushalt seines Vaters vorzustellen, und musste grinsen. Für FitzWarin gab es ausschließlich Jagdhunde, je größer, desto besser.
Während Brunin in Richtung des Rossmarkts schlenderte, dachte er darüber nach, ob er den Blick seines Vaters diesmal vielleicht auf ein geschecktes oder ein kohlschwarzes Pony lenken könnte – etwas anderes als die üblichen Füchse oder Braunen. Aber natürlich waren ungewöhnliche Farben auch teurer, und wenn der Preis zu hoch war, würde sein Vater sich seinem Ansinnen verschließen.
Der Weg zum Rossmarkt führte Brunin durch die breite Gasse, an der die Waffenschmiede ihre Stände aufgebaut hatten. Die funkelnden Schwertklingen, die Äxte, Dolche, Schilde, Kettenhemden, Helme und andere Stücke, die zur Ausrüstung eines Kriegers gehörten, fesselten seinen Blick und beflügelten seine Fantasie. Hier war ein Messer in einem Futteral aus geprägtem Leder, genau wie das, welches Mark an seiner Hüfte trug, und dort ein Schwert, dessen Griff mit rotem Leder umwickelt war und an dessen Klinge sich eine lateinische Inschrift hinabwand. Brunin konnte sich an all dem gar nicht satt sehen. Manchmal zog er das Schwert seines Vaters aus der Scheide und stellte sich vor, er sei der große Roland, der den Pass von Roncesvalles gegen die Ungläubigen verteidigte. Einmal hatte ihn seine Großmutter dabei ertappt und ihn verprügelt, weil er klebrige Fingerabdrücke auf dem polierten Stahl hinterlassen hatte. Von da an war er vorsichtiger gewesen – und in Erinnerung an ihre Worte wischte er das Schwert jedes Mal an seiner Tunika sauber, ehe er es wieder zurücklegte.
Ein Edelmann trat mit seinem Gefolge an den Stand, dessen Waffen Brunin gerade bewunderte, und begann, die Schwerter in Augenschein zu nehmen. Brunin sah zu, wie er die Klinge, die der Handwerker ihm reichte, in der Hand wog.
»Liegt gut in der Hand«, nickte der Edelmann. »Nur der Griff ist ein wenig kurz. Ich will im Kampf ja nicht meine Fingerkuppen verlieren.« Er schwang das Schwert prüfend durch die Luft, gefolgt von einem geschickten Streich in die Gegenrichtung, dann reichte er die Waffe herum, um die Meinung seiner Begleiter zu hören.
»Wenn die Klinge Euch zusagt, der Griff lässt sich ändern, Mylord«, sagte der Händler. »Ansonsten hätte ich noch das hier.« Er reichte ihm ein weiteres Schwert, diesmal in einer Scheide aus griffigem rosenfarbenem Leder.
Fasziniert rückte Brunin näher, doch im gleichen Moment wurde er auch schon von einem blonden Knappen aus dem Gefolge des Edelmannes zur Seite gestoßen. »Geh aus dem Weg, du Rotznase«, höhnte er. »Sieh zu, dass du zu deiner Amme kommst.«
Brunin schoss das Blut in die Wangen. Der Jüngling trug eine Tunika aus blutroter Wolle, und das Messer an seinem Gürtel war kaum kleiner als das von Mark. Seine Hand schwebte über dem Heft, als spielte er mit dem Gedanken, es zu ziehen. Brunin sah die angedeutete Drohung, und er spürte, wie ihm der Schweiß ausbrach.
»Dem hat es die Sprache verschlagen«, grinste ein jüngerer, blau gekleideter stämmiger Bursche. »Oder er ist Waliser und versteht uns gar nicht. Sieht aus wie ein Waliser, findest du nicht?«
Brunin reckte das Kinn in die Höhe. Jeder einzelne Muskel in seinem Körper spannte sich an, während er sich bemühte, sich nicht einschüchtern zu lassen. »I-ich bin kein Waliser«, sagte er.
Der Edelmann hielt in der Begutachtung des zweiten Schwerts inne und sah sich nach ihnen um. »Ernalt, Gerald, lasst den Jungen in Ruhe. Er kann gerne zuschauen, wenn er mag.« Seine Stimme klang freundlich. »Wie heißt du, Junge?«
Brunin rang um seine Haltung. »Fulke, Sir«, sagte er und nannte seinen offiziellen Geburtsnamen. »Fulke F-FitzWarin …«
Das Wohlwollen wich aus den Augen des Mannes. »Aus Whittington?«
»Ja, Sir.«
»Und wieso treibst du dich hier ganz allein auf dem Markt herum?«
»Ich warte auf meinen Vater«, antwortete Brunin.
Der Mann hob den Kopf und blickte sich um, als erwartete er, Brunins Vater in der Menge zu sehen. »Dann tust du vielleicht besser daran, nicht gerade in meiner Nähe zu warten«, sagte er. Seine Stimme hatte ihre Wärme verloren. »Wenn dein Vater mit seinen Ländereien genauso achtlos umgeht wie mit seinem Sohn, ist es gut möglich, dass er beides noch irgendwann verliert.« Dann wandte er Brunin ohne ein weiteres Wort den Rücken zu, gab dem Handwerker das Schwert zurück und begann mit ihm über den Preis zu verhandeln.
Brunin war verwirrt. Er konnte sich diesen plötzlichen Stimmungsumschwung nicht erklären, begriff aber immerhin so viel, dass seine Gegenwart nicht erwünscht war und dass dies etwas mit seinem Vater zu tun haben musste. Er wandte sich zum Gehen, doch plötzlich spürte er einen kräftigen Stoß im Rücken. Er stolperte, und als er sich überrascht umdrehte, sah er sich dem blonden Knappen und seinem Gefährten gegenüber.
»Weißt du, was mit einem jungen Fuchs passiert, der zu weit von seinem Bau entfernt herumstreunt?«, fragte der Blonde mit einer Stimme, die nicht mehr die eines Knaben, aber noch nicht die eines Mannes war. Er zückte sein Messer.
Brunin schluckte, und wieder brach ihm der Schweiß aus.
»Glaubst du, er hat Schiss?« Mit einem bösartigen Glitzern in den Augen versetzte der Stämmige der beiden Brunin einen weiteren Stoß.
»Natürlich hat er Schiss.«
»Hab ich n-nicht!«, widersprach Brunin. Etwas Seltsames ging mit seiner Blase vor sich, er hatte das Gefühl, als schnitte die Klinge des blonden Knappen mitten in sie hinein.
Der Jüngling tippte mit dem Daumen auf die Spitze seiner Waffe und ließ danach den Finger sachte über die Schneide gleiten. »Das solltest du aber«, sagte er. »Vielleicht schneide ich dir deinen kleinen Schwanz ab und schick dich mit einem Stummel zurück zu deinem Rudel. Was meinst du?« Er machte eine vielsagende Geste mit dem Dolch.
Brunin zuckte zurück. Er wusste, dass das nicht sehr mannhaft war, aber er konnte nicht anders. Er wünschte, er wäre zurück in ihrer Unterkunft, bei seiner Mutter, seinen Brüdern, ja sogar bei seiner Großmutter. Er wünschte, er wäre noch bei Mark und würde sich zu Tode langweilen.
Der blau gekleidete Knappe packte Brunins Arm. »Soll ich ihn festhalten?«
»Wenn du willst.«
Schreckliche Angst durchzuckte Brunin wie ein greller Blitz. Er zog seinen Fuß zurück, trat den Jungen, der ihn gefangen hielt, gegen das Schienbein, wand sich und biss in die Hand, die seinen Ellbogen umklammerte. Der Knappe schrie auf und ließ ihn los. Brunin machte, dass er wegkam. Flink und wendig wie ein Aal zwischen den Steinen, huschte er zwischen den Marktständen hindurch, aber auch seine Verfolger waren schnell, und sie waren zu zweit. Brunin stürzte auf den Stand zu, an dem er Mark, sein Bier schlürfend und mit dem Mädchen schäkernd, zurückgelassen hatte, doch zu seinem Entsetzen war der junge Sergeant seines Vaters nicht mehr zu sehen.
Über den Schanktisch hinweg funkelte das Mädchen den gehetzten, keuchenden Jungen wütend an. »Er ist losgezogen, um nach dir zu suchen.« Ihrem Tonfall merkte er an, wie zornig sie war, dass ihre Tändelei wegen ihm ein so abruptes Ende genommen hatte. »Da wirst du dich auf was gefasst machen dürfen.«
Das brauchte sie ihm nicht zu sagen. »Bitte…«, krächzte er, aber es war schon zu spät. Die beiden Knappen packten ihn rechts und links und hielten ihn fest. Als das Mädchen sie argwöhnisch musterte, nickte der Blonde in Richtung Brunin. »Ein kleiner Taugenichts«, sagte er. Beruhigt wandte sie sich ab und überließ Brunin seinem Schicksal.
Er bot jedes Gran Kraft auf, das sich in seinem schmächtigen Körper verbarg, doch gegen die beiden Halbwüchsigen konnte er nichts ausrichten. Ihre Finger drückten sich schmerzhaft in sein Fleisch, während sie ihn über das Marktgelände schleiften, und einer hatte seine Hand auf seinen Mund gepresst, um sein Kreischen zu ersticken. Als er erneut zu beißen versuchte, spürte er das kalte Brennen des Messers an seinem Hals. Eine plötzliche, beschämende Wärme strömte in seine Bruche und befleckte seine Beinlinge.
»Bei den Gebeinen unseres Herrn, diese Memme hat sich in die Hosen gepisst!«, johlte der stämmige Knappe.
Sein blonder Gefährte schnaubte. »Was erwartest du denn bei einem mit solchem Blut? Es ist ja ein Wunder, dass es rot ist und nicht gelb.« Er zeigte Brunin seine blutbefleckten Finger und strich dann damit über die Wange des Jungen.
»Ich wette eine halbe Mark, dass seine Leber so gelb ist wie Pisse, wenn du sie ihm herausschneidest.«
»Eine halbe Mark? Abgemacht.«
»Ihr da!« Die Stimme klang gebieterisch und streng. Durch einen Tränenschleier hindurch erkannte Brunin den dunklen Umriss eines Benediktinermönchs, der ihnen mit hoch vor der Brust verschränkten Armen und missbilligender Miene den Weg versperrte. »Was macht ihr mit dem Knaben?«
»Das geht Euch nichts an«, entgegnete der Ältere der beiden schnippisch.
Der Mönch zog eine seiner schmalen grauen Augenbrauen hoch. »Ach, meinst du?«, sagte er kühl. »Lasst ihn los und macht, dass ihr fortkommt.«
Die beiden hielten dem gebieterischen Blick nur kurz stand. An Draufgängertum mangelte es den Knappen beileibe nicht, aber sie waren immer noch halbwüchsige Burschen, keine erwachsenen Männer. Widerwillig kapitulierten sie vor der Autorität der Kirche, schubsten Brunin von sich, so dass er auf die Knie fiel, und stolzierten davon. In einiger Entfernung drehte der Blonde sich noch einmal um.
»Deine Leber gehört mir, Hosenscheißer!«, rief er. »Irgendwann komme ich und hole sie mir!«
Brunin starrte auf das staubbedeckte Gras wenige Zoll vor seinen Augen. Ein dunkler Blutstropfen fiel aus der Schnittwunde an seinem Hals, rann die Halme hinab und versickerte im Boden. Er konnte den Atem in seinem Brustkorb rasseln und mit einem heiseren Schluchzen aus seiner Kehle entweichen hören. Er fragte sich, ob er wohl sterben würde, und wünschte, er wäre bereits tot.
»Was hatte das zu bedeuten, mein Kind?« Der Mönch beugte sich hinab und half Brunin auf die Beine. »Was hast du getan, dass sie auf dich losgegangen sind?«
»Nichts«, schluckte Brunin mit zitternder Stimme und wischte sich mit dem Ärmel über die Augen. Ihm war übel, und seine Beine knickten ein wie die eines Fohlens.
»Ich verstehe.« Die Stimme des Mönchs klang ausdruckslos. Vorsichtig neigte er Brunins Kopf zur Seite, um den Schnitt zu begutachten. »Nur ein Kratzer«, sagte er, »aber die Geschichte hätte durchaus böse ausgehen können.« Er schnalzte mit der Zunge und sprach eher zu sich selbst als zu Brunin. »Jedes Jahr bringt uns der Markt neben den Einkünften auch solche bösen Händel, vor allem seit die Männer sich darum streiten, wer das Königreich regieren soll.« Er führte Brunin mit sanftem Druck auf die Abtei zu. »Komm, mein Kind, wir wollen sehen, ob wir eine Salbe für deinen Kratzer finden und einen Platz, wo du dich eine Weile hinsetzen kannst.« Er musterte ihn aufmerksam. »Wenn du kein Findling bist, was ich, deinem Gewand nach zu urteilen, nicht glaube, wird sicher schon jemand nach dir suchen.«
Fulke FitzWarin, Herr über die Burgen von Whittington und Alberbury und mehr als fünfzehn Lehen in den Grafschaften Shropshire, Staffordshire, Devonshire und Cambridgeshire, nahm einen Schluck Wein, rollte ihn prüfend im Mund herum und schluckte. Dann reichte er den Becher seinem Begleiter. »Was haltet Ihr davon?«
Joscelin de Dinan roch an dem Wein und setzte den Becher unter dem erwartungsvollen Blick des Händlers an die Lippen. »Nicht übel«, sagte er und wischte sich den Mund ab. Die Fältchen in seinen Augenwinkeln vertieften sich, als er lächelte. »Ich würde mich gewiss nicht beleidigt fühlen, wenn Ihr ihn mir kredenzen solltet.«
FitzWarin stieß ein belustigtes Grunzen aus. »Gut zu wissen, dass ich nicht meinen besten Wein anzubrechen brauche, um Euch zufrieden zu stellen.« Er winkte den Weinhändler mit erhobenem Zeigefinger heran. »Ich nehme dreißig Fässer davon. Den Preis kannst du mit meinem Haushofmeister aushandeln.« Er hielt den Becher unter den Zapfen des Fasses und füllte ihn erneut. Um sie herum wogte die Menge. An den Ständen der Weinhändler herrschte stets besonders reges Treiben, und am besten besuchte man sie so früh wie möglich, wenn die Auswahl noch groß war.
Es war schön, an diesem sonnigen Morgen draußen zu sein, während keine dringenderen Angelegenheiten auf die Männer warteten, als vergnüglich mit alten Freunden zu plaudern, den Weinvorrat aufzustocken und später den Rossmarkt und die Waffenstände zu erkunden.
»Euer Haushofmeister?« Joscelin zog die Augenbrauen hoch. »Nicht Eure Mutter?«
FitzWarin lachte und strich sich das dichte, braune Haar aus der Stirn. »Sie würde sicher ein Wörtchen mitreden wollen, aber einstweilen sind all ihre Gedanken auf den Kauf von Stoff und Geschmeide gerichtet. Manchmal gibt es einfach zu viele Dinge, um die sie sich kümmern zu müssen glaubt, als dass sie bei allem ihre Finger im Spiel haben könnte.« Unter den Kronvasallen der walisischen Lande genoss seine Mutter einen geradezu legendären Ruf. Viele behaupteten, manche sogar in seiner Gegenwart, dass Lady Mellette es mit jedem Drachen aufnehmen könne. Sie war schon fünfundsechzig, aber immer noch zäher als FitzWarins Gemahlin, die nicht einmal halb so viele Jahre zählte.
Die Männer kosteten noch an einigen anderen Weinen. Joscelin suchte nach einem weißen Rheinwein, und FitzWarin erstand ein Viertelfass süßen, starken Eisweins.
»Es gibt da etwas, um das ich Euch bitten wollte«, sagte FitzWarin, als sie in traulicher Stimmung von den Weinständen fortschlenderten. Seine Schritte waren fest, und er schwankte auch kein bisschen, aber er merkte, wie seine Zunge mit ihm durchgehen wollte. Joscelins Wangen waren mit einer dunklen Röte überzogen, die seine rauchgrauen Augen wie polierte Feuersteine glänzen ließ.
»Solange es sich nicht um meine Töchter handelt«, erwiderte Joscelin nur halb im Scherz. Er hatte zwei Stieftöchter und zwei Töchter von seinem eigen Fleisch und Blut, aber keinen Sohn, und so traten unablässig Männer an ihn heran, die es nach einem künftigen Anteil an der strategisch bedeutsamen Burg und dem wohlhabenden Städtchen Ludlow gelüstete.
»Nein.« FitzWarin schüttelte den Kopf. »Es geht um meinen Sohn… meinen Ältesten«, fügte er hinzu, denn er hatte nicht nur den einen. »Er sollte schon längst mit seiner Ausbildung begonnen haben. Der Junge ist jetzt zehn Jahre alt. Ich habe mich gefragt, ob Ihr …«
Joscelin zog die Augenbrauen hoch, denn normalerweise behielt ein Mann seinen Erben bei sich und nahm die Söhne anderer Männer als Gefährten für ihn in seinen Haushalt auf. Es waren die jüngeren Söhne, die in fremde Familien gegeben wurden, in der Hoffnung, dass sie durch Heirat oder als Ritter im Haushalt des Burgherrn einen Platz finden würden. »Ihr wollt ihn nicht in Whittington behalten?«
Sie blieben stehen, um eine Reihe von Packpferden durchzulassen. Glöckchen läuteten an ihrem Geschirr, und auf dem Rücken trugen sie Weidenkörbe voller Gürtel aus vergoldetem Leder, die wie ein Gewirr schimmernder Schlangen anmuteten.
FitzWarin seufzte und strich sich erneut das Haar aus der Stirn. »Nein«, sagte er. »Wenn es Ralf wäre oder Richard oder Warin, würde ich das tun, aber Brunin muss seine Flügel ausbreiten. Und ich kann mir keinen besseren Ort denken, an dem er seine Ausbildung erhalten könnte, als Ludlow … wenn Ihr ihn nehmen wollt.«
Joscelin blickte nachdenklich drein und versuchte, die Bedeutung von FitzWarins Worten zu ergründen. Er hegte keine Zweifel daran, dass Ralf, Richard und Warin sich als umgängliche Knaben erweisen würden, die sich leicht ins Mannesalter führen ließen. Doch ein Junge, der seine Flügel ausbreiten musste, verhieß eine größere Herausforderung zu werden. »Es ist keine geringe Verantwortung, den Erben eines Freundes aufzuziehen«, sagte er.
»Ich vertraue Euch.«
»Und Euch selbst vertraut Ihr nicht?«
FitzWarin warf ihm einen finsteren Blick zu. »Da ich nicht der Älteste war, wurde ich zur Ausbildung fortgeschickt. Das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin … und es war eine glückliche Fügung, denn mein Bruder starb und ließ mich als Erben zurück. Brunin ist wie ich. In einem fremden Haushalt wird er eher die Möglichkeit haben, sich zu entfalten, und es wäre mir sehr lieb, wenn dieser Haushalt der Eure sein könnte.«
Joscelin runzelte die Stirn. »Habt Ihr darüber schon mit Eurer Gemahlin gesprochen?«
»Eve wird tun, was ich sage, und um meine Mutter werde ich mich schon kümmern«, erwiderte FitzWarin brüsk.
Joscelin dachte an sein eigenes behagliches Zuhause, und er wusste, dass er trotz Eve FitzWarins großer Schönheit nicht eine Minute lang mit seinem Freund tauschen wollte.
»Ich will Brunin ein neues Pony kaufen«, fuhr FitzWarin in unbeschwerterem Ton fort. »Mark führt ihn gerade ein wenig auf dem Markt herum, aber wir treffen uns zur Sext auf dem Rossmarkt. Wenn Ihr den Jungen sehen wollt, könnt Ihr Euch uns gerne anschließen.«
»Damit ich ihm ins Maul schauen kann, als wäre er ein Hengstfohlen, das zum Verkauf steht?«
Joscelins Sarkasmus war an FitzWarin verschenkt. »Nun ja, wenn Ihr es so seht… Kein Mensch kauft ein Pferd, ohne es sich vorher genau anzusehen.«
Joscelin blieb eine Antwort erspart, als ein junger Mann mit besorgter Miene von den Garküchen her auf sie zuhastete. Er trug das gesteppte Wams eines Kriegers, und seine linke Hand ruhte auf dem Heft eines langen Jagdmessers.
»Mark?« FitzWarins Lippen wurden schmal. »Wo ist Brunin?«
Respektvoll senkte der junge Mann den Kopf. »Ich weiß es nicht, Mylord«, antwortete er bekümmert.
Der Blick, den FitzWarin ihm zuwarf, hätte Stahl zerschneiden können. »Du weißt es nicht?«
Der Sergeant fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. »Wir wurden durch die Menschenmenge getrennt, Mylord. Ich war gerade auf dem Weg zum Rossmarkt, um nachzusehen, ob er dort ist. Er weiß, dass wir uns dort treffen wollen, und ich dachte …«
»Wie in Gottes Namen konntet ihr getrennt werden?« FitzWarins Stimme verhieß nichts Gutes für seinen Sergeanten.
»Ich … Gerade war er noch da, und im nächsten Moment war er schon verschwunden.«
»Wo war er?«, fragte Joscelin. »Wo genau hast du ihn verloren? Bei welchem Stand?«
Der Sergeant zuckte zusammen. »Bei einer der Garküchen, Mylord.«
FitzWarins Augen blitzten drohend auf. »Ich vermute, du hast gesoffen und dir den Wanst voll geschlagen, statt auf den Jungen aufzupassen.«
»Ich habe nur für einen einzigen Moment weggesehen, das schwöre ich.«
»Und das war schon zu viel, wie du merkst!« FitzWarin hieb mit der geballten Faust durch die Luft. »Aber dafür habe ich jetzt keine Zeit; ich werde mich später mit dir befassen. Zuallererst müssen wir meinen Sohn finden.«
Joscelin räusperte sich. »Euer Sergeant hat sicher Recht, und der Junge wird zum Rossmarkt gehen. So viel Verstand wird er ja wohl haben.«
FitzWarin sah Mark finster an. »Ja«, knurrte er. »Er hat genug Verstand, wenn er sich dazu entschließt, ihn zu gebrauchen… auf jeden Fall mehr als dieser Schafskopf hier.«
Die Männer machten sich auf den Weg durch die Marktstände. FitzWarin schickte Mark fort, um die anderen Ritter und Sergeanten aus seinem Gefolge zu holen, damit sie sich an der Suche beteiligten. »Aber scheuch mir ja nicht die Frauen auf«, befahl er. »Das Letzte, was ich jetzt brauche, ist ein Aufruhr im Hühnerstall.«
FitzWarin und Joscelin gingen auf direktem Weg zum Rossmarkt, doch obwohl es dort unzählige Jungen gab, die Pferde am Zügel hielten und den Pferdeknechten halfen, war von dem Gesuchten weit und breit nichts zu sehen. Die kleine Hand schützend in einer von harter Arbeit schwieligen Faust geborgen, ging ein Sohn neben seinem Vater her an den Männern vorbei. Die beiden blieben Seite an Seite stehen, um ein wohlgenährtes, scheckiges Pony in Augenschein zu nehmen. FitzWarin sah das eifrige, auf den Vater gerichtete Gesicht des Kindes und dann auf dessen nachsichtiges Lächeln, und er wusste, dass Gott ihn strafte. »Wenn Brunin auch nur das Geringste zugestoßen ist, werde ich in Zukunft meine Beinlinge mit den Gedärmen meines Sergeanten schnüren«, stieß er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.
Joscelins erste Regung war, ihn mit der Versicherung zu beruhigen, dass der Junge gewiss unversehrt war und wieder auftauchen würde, doch er biss sich auf die Zunge. Wenn eine seiner Töchter in dieser Menschenflut verloren gegangen wäre, wäre er sicher weniger zuversichtlich. Wohlweislich sagte er daher gar nichts und konzentrierte sich ganz auf die Suche.
Mark und die anderen Soldaten suchten das Ufer des Severn ab, wo die flachen Kähne der Kaufleute an ihren Vertäuungen auf dem Wasser schaukelten, doch sie fanden keine Spur von Brunin, und niemand hatte den Jungen gesehen. Obwohl der Fluss so harmlos aussah, war er tückisch und ein Kind, das ins Wasser fiel, würde rasch in seinen Tiefen verschwinden. Mühlgraben, Bach und Teich wurden ebenfalls abgesucht, aber auch dort war keine Spur von dem Jungen. FitzWarin war zusammen mit Joscelin über den ganzen Markt gelaufen, und seine Nerven lagen mittlerweile bloß, als plötzlich ein junger Mönch auf sie zutrat.
»Mylords, ich habe gehört, dass Ihr nach einem verloren gegangenen Kind sucht?«
FitzWarins Augen leuchteten auf. »Gott sei gepriesen, habt Ihr ihn gefunden?«
»Ja, Mylord. Er ist bei Bruder Anselm im Pförtnerhaus.« Der Mönch deutete hinter sich auf ein niedriges steinernes Gebäude neben dem Haupteingang der Abtei.
FitzWarin ging mit schnellen Schritten darauf zu und legte eine Hand auf seine Schwertscheide, um sie ruhig zu halten. Joscelin eilte neben ihm her. »Wenn er bei den Mönchen Hilfe gesucht hat, zeugt das auch von Verstand«, sagte er.
FitzWarin knurrte. »Verstand hätte er bewiesen, wenn er bei meinem Sergeanten geblieben wäre«, schimpfte er. »Dafür werde ich den beiden noch das Fell über die Ohren ziehen.«
Auf einer Bank vor dem Pförtnerhaus saß ein gedrungener Mönch mittleren Alters und tätschelte einem kläglich dreinblickenden Kind beruhigend die Schulter. Tränenspuren zogen sich über die Wangen des Jungen, seine dunklen Augen waren glasig und verschreckt. Auf einer Wange hatte er Flecken, die wie blutige Fingerabdrücke aussahen, und ein Schnitt an seinem Hals war mit einer gelben Salbe bestrichen worden. Auf den Innenseiten seiner Beinlinge prangte ein verräterischer Fleck.
FitzWarin blieb abrupt stehen. Seine Augen weiteten sich. »In Dreiteufelsnamen, Brunin!«
Der Mönch zog seine Hand zurück und stand auf. Wenn er sich durch diese Blasphemie auf Gottes eigenem Boden irritiert fühlte, ließ er sich davon nichts anmerken. »Gehört dieser Junge zu Euch, Mylord?«
»Er ist mein Sohn«, erwiderte FitzWarin scharf. »Was ist mit ihm geschehen?« Mit großen Schritten ging er auf die Bank zu, beugte sich zu Brunin hinab und drehte seinen Kopf, so dass er die Wunde besser sehen konnte. »Wer war das?«
Die Miene des Jungen war vollkommen ausdruckslos. FitzWarin kannte diesen Blick. Welchen Schmerz Brunin auch immer hatte erdulden müssen, er hatte ihn in sein Inneres gesperrt, wo er sich schweigend von ihm nährte und der Schmerz sich von ihm.
»Ein paar ältere Burschen haben ihre Scherze mit ihm getrieben, die allerdings immer weniger komisch wurden«, sagte der Mönch. »Ich ging dazwischen und brachte ihn ins Pförtnerhaus. Als ich von einem meiner Brüder hörte, dass jemand nach einem Kind suchte, sandte ich Bruder Simon aus, um Eure Schritte hierher zu lenken.« Er deutete auf den Jungen. »Es hat ihn mitgenommen, aber er hat keine ernsthaften Verletzungen davongetragen.«
FitzWarin wandte sich an Brunin. »Würdest du die Burschen wiedererkennen?«, fragte er und presste die Kiefer zusammen, als er sah, wie blankes Entsetzen in den Augen seines Sohnes aufleuchtete. »Also, würdest du?« Er konnte nichts dagegen tun, dass er immer lauter sprach.
»Ja, Sir«. Brunin schluckte.
FitzWarin zog ihn mit einem Ruck auf die Beine. »Dann lass uns gehen und sie suchen, und dann werden wir ja sehen, ob ihnen der Spaß nicht vergeht, wenn sie meine Klinge zu spüren bekommen.«
»Gewalt erzeugt nur noch mehr Gewalt, Mylord«, wandte der Mönch ein. »Und wir haben doch sicherlich in diesem Leben alle genug davon erlebt, um nicht unnötig neue schüren zu wollen.«
»Spart Euch Eure Predigten für die Kirche«, knurrte FitzWarin. »Von denen habe ich auch schon so viele gehört, dass es für den Rest meines Lebens reichen wird!« Unwirsch wandte er dem Mönch den Rücken zu und sah finster auf seinen Sohn hinab, dessen Schulter unter seiner Hand zitterte. »Wie sahen sie aus?«
Brunin stammelte eine Beschreibung, und dabei wurde sein Gesicht immer bleicher.
»Es wäre vielleicht das Beste, ihn zurückzulassen«, sagte Joscelin in ausdruckslosem Ton. »Er scheint mir nicht in der Verfassung zu sein, auf dem Marktgelände herumzulaufen.«
»Ich sehe selbst, in welcher Verfassung er ist«, erwiderte FitzWarin scharf. »Und wenn ich diejenigen erwische, die dafür verantwortlich sind, dann werden sie dafür bezahlen. Komm schon, Junge, in deinen Adern fließt das Blut von Königen. Zeig, was in dir steckt.«
Während dieses Wortwechsels hatte Brunin die Zähne zusammengebissen und krampfhaft geschluckt, doch schließlich war er nicht mehr länger Herr seines Willens, und er beugte den Kopf und würgte haltlos, während Krämpfe seinen schmächtigen Körper schüttelten, bis seine Knie nachgaben.
»In Gottes Namen, schickt ihn zurück in Eure Unterkunft«, sagte Joscelin, in dessen Zügen sich Entsetzen und Mitleid spiegelten. »Er ist am Ende seiner Kräfte. Selbst wenn er ein Nachfahre von König Artus persönlich wäre, würde er jetzt seine Ruhe haben müssen.«
Mit grimmiger Miene hob FitzWarin Brunin auf, der ihm leicht wie eine Feder in den Armen lag. Er spürte die Feuchtigkeit, wo Brunin seine Hosen durchnässt hatte, und ein tiefer, zärtlicher Zorn erfüllte ihn, nicht zuletzt deswegen, weil er sich schämte, dass jemand seinem Sohn so große Angst eingejagt hatte, dass dieser die Kontrolle über seine Blase verloren hatte. Verriet das etwa eine Veranlagung zur Feigheit? Dieser Gedanke quälte ihn wie ein kleiner spitzer Stein im Schuh. Was, wenn Brunin die Fähigkeiten fehlten, die er brauchte, um zu gegebener Zeit die Geschicke der Familie in die Hand zu nehmen? Das alles wäre nicht von Bedeutung, wenn er einer der Jüngeren wäre, aber er war sein Erbe. Dass er sich aber überhaupt schämte, machte FitzWarin noch wütender. Er sollte Gott danken, dass Brunin in Sicherheit war, und sich nicht über das mangelnde Rückgrat des Jungen erregen. Von diesen zwiespältigen Empfinden geplagt, drückte er seinen Sohn an sich, ehe er ihn brüsk in die Obhut zweier seiner Ritter gab.
»Guy, Johan, bringt ihn auf schnellstem Wege in meine Unterkunft und übergebt ihn den Frauen. Erklärt ihnen so wenig wie möglich. Darum werde ich mich selbst kümmern, wenn ich zurückkomme.«
»Ja, Mylord.« Guy legte sich Brunin über die Schulter wie einen Hirschen.
Mit tief gefurchter Stirn sah FitzWarin ihnen nach. Dann zuckte er die Schultern, als wolle er eine schwere Last zurechtrücken, sandte einen dritten Mann aus, der die Suchenden vom Fluss zurückrufen sollte, und wandte sich wieder dem Marktgelände zu.
2
»Ihr sucht nach einer Nadel im Heuhaufen«, warnte Joscelin, während er mit großen Schritten neben seinem Freund herging. »Und wenn Ihr einen Streit vom Zaun brecht, wird sich der Sheriff auf Euch stürzen wie ein Habicht.«
FitzWarin bleckte die Zähne. »Ihr braucht mich ja nicht zu begleiten.«
»Ich weiß.«
Schweigend gingen sie weiter, während ihre Blicke umherwanderten und die Menge absuchten, durch die sie sich hindurchdrängten. Joscelin war der Größere von beiden, zwei Yards und eine Fingerlänge groß, und mit seinem dichten, dunkelroten Haar und dem löwengleichen Gang zog er viele Blicke auf sich. Außer Hörweite, aber nahe genug, um im Notfall rasch herbeigerufen zu werden, folgten ihnen ihre Männer.
»Ich würde es verstehen, wenn Ihr es ablehnt, meinen Sohn aufzunehmen«, sagte FitzWarin, während sie einen Bogen um einen Akrobaten schlugen, der gerade auf zwei Schwertspitzen einen Handstand vollführte.
Ein hübsches junges Mädchen in einem Kleid, das einen unschicklichen Blick auf ihren Fußknöchel freigab, wirbelte auf die Männer zu und schwenkte einen bemalten Eimer vor ihrer Nase. FitzWarin starrte sie wütend an. Joscelin schnippte einen Viertelpenny in den Eimer und verschränkte die Arme zum Zeichen, dass sie von ihm nicht mehr bekommen würde. Er hatte das Gefühl, die meiste Zeit seines Lebens auf der einen oder anderen Schwertspitze balancierend verbracht zu haben.
»Ihr sagtet, er wäre wie Ihr«, sagte er leise und mit einem Seitenblick auf FitzWarin. »Bleibt Ihr dabei?«
FitzWarin strich sich mit einer energischen Geste das Haar aus der Stirn und ballte die Faust. »Bei den Gebeinen unseres Herrn, ich weiß es nicht.« Laut sog er die Luft ein. »Ja, ich denke schon, auch wenn ich in seinem Alter mehr …« Er brach ab und verzog das Gesicht. »Ich wollte ›Mut besaß‹ sagen, aber Mut ist nicht das richtige Wort. Tatendrang vielleicht. Ich bin sicher, dass es in ihm steckt, aber er ist so verschlossen, dass man kaum weiß, wo man mit dem Suchen anfangen soll.«
»Und deswegen meintet Ihr, er müsse seine Flügel ausbreiten?«
»Ich bin ihm zu nahe und würde ihn in seiner Entwicklung nur behindern.«
Joscelin nickte. »Ich kann Euch nichts versprechen, aber ich werde darüber nachdenken«, sagte er. »Zuerst muss ich mit meiner Gemahlin darüber reden.«
FitzWarin sah ihn verwundert, fast schon missbilligend an. »Wenn ich einen Knappen in meinen Haushalt aufnehme, bitte ich Eve vorher nicht um Erlaubnis. Das ist meine Angelegenheit, und es würde ihr im Traum nicht einfallen, sich in solche Dinge einzumischen.«
»Eurer Mutter allerdings durchaus«, erwiderte Joscelin mit einem Lächeln.
FitzWarin schüttelte den Kopf. »Nicht bei solchen Entscheidungen.«
»Vielleicht nicht offen, aber Ihr würdet bald merken, wenn sie etwas gegen Eure Wahl einzuwenden hätte. Lady Mellette ist keine Frau, die mit ihrer Meinung hinter dem Berg hält – und das sage ich mit dem allergrößten Respekt. Und aus einem eben solchen Respekt werde ich erst mit Sybilla reden. Sie ist die Herrin von Ludlow, und wenn ich Brunin in mein Gefolge aufnähme, würde er zumindest am Anfang viel Zeit unter ihrer Aufsicht verbringen.«
FitzWarin sah immer noch so aus, als hielte er Joscelin für zu nachgiebig, aber er neigte den Kopf. »Wie Ihr meint«, sagte er.
Sie ließen die Gaukler hinter sich und konzentrierten sich wieder auf ihre Suche, wanderten von Stand zu Stand, doch ohne Erfolg.
»Wahrscheinlich sind sie längst fort«, sagte Joscelin, als sie bei den Ständen der Waffenschmiede eine Pause machten.
»Nein, sie sind hier irgendwo«, knurrte FitzWarin mit der Hartnäckigkeit eines Terriers, der die Witterung eines Dachses aufgenommen hatte. »Niemand kommt lediglich für einen Tag auf den Markt. Selbst wenn sie sich nicht mehr zwischen den Ständen herumtreiben, haben sie ganz sicher in der Nähe eine Unterkunft genommen.«
»Sir.« Es war Marks Stimme, nervös und beflissen. Er war vom Fluss heraufgekommen und hatte sich FitzWarins Gefolge angeschlossen.
FitzWarins Blick folgte dem ausgestreckten Finger des Sergeanten hin zu einer Gruppe von Rittern und Knappen am anderen Ende der langen Reihe von Waffenständen. Aus ihrer Mitte ragte ein hochgewachsener Edelmann mit krausem schwarzem Haar und einem sauber gestutzten Bart hervor. Er war in Begleitung zweier junger Burschen, der eine flachsblond und in eine rote Tunika gekleidet, der andere stämmig, sommersprossig und in blaues Tuch gewandet. Der Blonde wirkte ausgesprochen großspurig, und an seinem Gürtel hing ein auffälliges Messer.
Auch Joscelin schaute zu ihnen hinüber, doch es war nicht der Anblick der Knappen, der seine Hand zu seinem Schwert zucken ließ, sondern der des Edelmanns. Gilbert de Lacy war der Vetter seiner Frau, aber da er Besitzansprüche auf Ludlow erhob, war ihre Verwandtschaft Anlass für Hader, nicht Freundschaft. Das Lehen war de Lacys Vater vor über fünfzig Jahren weggenommen worden, weil er sich gegen den König aufgelehnt hatte, doch das hielt seinen Sohn nicht davon ab, mit aller Macht sowohl vor Gericht als auch auf dem Schlachtfeld dafür zu kämpfen, dass die Ländereien ihrem Zweig der Familie zurückerstattet wurden. Unter normalen Umständen wäre Joscelin einem Zusammentreffen mit ihm aus dem Weg gegangen. Zwar konnte er sich in einem Kampf durchaus behaupten, doch der Gedanke an eine Auseinandersetzung mit diesem verbitterten, gefährlichen Rivalen behagte ihm nicht.
De Lacy hob den Kopf und bemerkte FitzWarin und Joscelin. Auch seine Hand legte sich an das Schwertheft, und seine kantigen Wangen röteten sich. Für einen kurzen Augenblick stockte sein Schritt, ehe er weiter auf den Stand eines Scheidenmachers zuging. Dann wandte er ihnen den Rücken zu und ignorierte Joscelin und FitzWarin geflissentlich. Die Knappen wechselten einen raschen Blick und hielten sich dicht hinter ihrem Herrn.
FitzWarin senkte seinen Kopf wie ein Bulle und ging geradewegs zum Angriff über, indem er de Lacy an der Schulter packte und ihn herumriss. »Mylord, Eure Knappen haben sich an meinem Sohn vergriffen«, stieß er wütend hervor, »ich verlange Genugtuung.«
Mit einem geringschätzigen Blick schüttelte de Lacy FitzWarins Hand ab. »So sind junge Burschen nun einmal«, gab er zurück. »Wenn Euer Sohn nicht auf sich selbst aufpassen kann, hättet Ihr dafür sorgen sollen, dass er am Busen seiner Amme bleibt.«
Wutentbrannt machte FitzWarin einen Satz nach vorne.
De Lacy wehrte seine Faust mit seinem Unterarm ab und zischte dann dicht vor seinem Gesicht: »Wenn ich mich in jeden Streit und jede Rauferei einmischen wollte, in die meine Knappen geraten, dann käme ich zu nichts anderem mehr. Ich habe weiß Gott Wichtigeres zu tun.« Er stieß FitzWarin von sich. »Ich würde Euch und de Dinan nur zu gerne auf dem Schlachtfeld das Genick brechen, aber ich bin nicht so dumm, diesen Markt in eines zu verwandeln. Ernalt, Gerald, lauft zurück zu meiner Unterkunft und richtet dem Haushofmeister aus, ich sei auf dem Weg, er solle Wein bereithalten. Macht schon.« Er wich nicht von der Stelle und versperrte FitzWarin und Joscelin den Weg, bis die Jungen sich aus dem Staub gemacht hatten.
»Wenn ich es für nötig halte, dass meine Knappen bestraft werden, sorge ich schon selbst dafür«, sagte er hitzig. »Es ist meine Aufgabe, ihnen Zucht und Ordnung beizubringen.«
»Dann gerbt ihnen mit Eurer Peitsche das Fell«, stieß FitzWarin wütend hervor. »Denn wenn Ihr es nicht tut, werde ich das übernehmen. Eine wüste Keilerei ist das eine. Sein Messer gegen ein Kind zu richten etwas anderes.«
Überraschung flackerte in de Lacys Miene auf.
»Ein Messer«, wiederholte FitzWarin. »Nur ein Feigling zieht gegen einen Wehrlosen blank. Wenn Ihr es gesehen habt und nicht eingeschritten seid, dann seid Ihr ebenfalls ein Feigling. Und wenn Ihr es nicht gesehen habt, dann ist es mindestens ebenso sehr Eure Schuld, weil Ihr Eure Knappen wie zwei räudige Hunde herumstreunen lasst, wie es meine ist, weil ich nicht besser auf meinen Sohn aufgepasst habe.«
Ein Muskel zuckte an de Lacys Wange. Wortlos machte er auf dem Absatz kehrt und schritt davon. Seine Männer folgten ihm, nicht ohne sich noch einige Male nach FitzWarin und Joscelin und deren Gefolge umzudrehen. Die Wirtshäuser würden an diesem Abend gefährliche Orte sein.
FitzWarin stieß langsam die Luft aus und Zorn und Anspannung lösten sich. Joscelin zog seine Hand von seinem Schwert zurück. Er hatte den Griff so fest umklammert, dass sich das Muster des geflochtenen Leders in seine Handfläche eingegraben hatte.
»De Lacy«, FitzWarin bleckte die Zähne. »Ausgerechnet de Lacy musste es sein.«
Joscelins rechte Hand zitterte. Er hatte den Drang zu kämpfen kaum beherrschen können, und doch war er erleichtert, dass es nicht dazu gekommen war. »Habt Ihr die Männer bemerkt, die ihn begleiteten?«
»Ich habe eher auf seine Knappen geachtet, diese kleinen Bastarde«, sagte FitzWarin schroff. »Was war mit den Männern?«
»Ich habe zwei von ihnen gestern vor einem Wirtshaus gesehen, wo sie ihre Schwerter feilboten.«
»Wollt Ihr damit sagen, dass de Lacy dabei ist, Leute anzuwerben?«
Joscelin nickte. »Gestern waren sie jedenfalls noch Söldner, die einen neuen Herrn suchten. Und wenn de Lacy seine Reihen verstärkt, dann sollte ich die Wachen in Ludlow verdoppeln und mehr Spähtrupps aussenden.«
»Glaubt Ihr, de Lacy will Euch angreifen?«
»Ich denke nicht, dass er vor die Tore von Ludlow ziehen und die Burg belagern wird, dazu hat er nicht die Mittel, aber er kann wie ein bissiger Hund nach meinen Knöcheln schnappen und mir eine Menge Ärger bereiten. Und Ihr solltet ebenfalls auf Eure Mauern achten. Mit Euch ist er zwar nicht wie mit mir verfeindet, aber zwischen Euch herrscht auch nicht gerade Freundschaft, und Ihr seid mein Verbündeter. Ich würde ihm durchaus zutrauen, dass er Eure Feinde in Wales dazu anstachelt, Eure Ländereien zu überfallen.«
»Wenn sie das tun, werden wir ihnen einen Empfang bereiten, von der noch die nächste Generation berichten wird«, knurrte FitzWarin.
Joscelins graue Augen glitten über die Schwerter, Dolche, Äxte und Speerspitzen, die an dem Stand feilgeboten wurden, der ihnen am nächsten war. Ihre Schneiden waren so scharf geschliffen, dass sie blau glänzten. Normalerweise hob der Anblick von so herrlich gearbeiteten Stücken seine Stimmung, doch heute erschien ihm ihr Anblick wie ein böses Omen, und er spürte, wie tiefe Wehmut in sein Inneres strömte, das eben noch von kämpferischer Anspannung erfüllt gewesen war.
Als FitzWarin in seine Unterkunft zurückkehrte, war seine Laune so finster wie ein Gewitterhimmel. Der Krug Wein in einem der Wirtshäuser hatte seine Stimmung nicht bessern können. Das Gesöff hatte wie Essig und Katzenpisse geschmeckt, und Joscelin war wortkarg und in Gedanken versunken gewesen. FitzWarin hatte seine Männer angewiesen, mit ihm gemeinsam zurückzukehren, so dass sie nicht weitertrinken konnten. Bei einer Rauferei mit de Lacys Männern hätten sie ihrer Erregung Luft verschaffen können, doch der mögliche Preis dafür war zu hoch.
Als er durch die Tür trat, rührte eine Magd gerade in einem Kessel, damit der Fleischeintopf nicht anbrennen konnte. Seine Frau und seine Mutter standen über einige Stoffballen gebeugt, die auf einer Truhe lagen, und seine Söhne, abgesehen von Brunin, balgten sich auf dem Boden wie ein Wurf Welpen, selbst William beteiligte sich, der Zweijährige, der immer wieder über seinen Kittel purzelte.
»Mein Gemahl.« Eve kam mit nervöser, beflissener Miene auf ihn zu. Als er sie elf Jahre zuvor geheiratet hatte, war sie fünfzehn gewesen. Die Geburt der sechs Söhne hatte die einst straffen Muskeln erschlaffen lassen, aber sie war immer noch schlank, und ihr Gesicht würde auch noch im Alter von großer Schönheit sein. Ihr Haar schimmerte golden durch das Netz hindurch, und ihre weit auseinander stehenden Augen waren so groß und glänzend wie die eines Rehkitzes.
Er begrüßte sie mit einem gleichgültigen Grunzen.
»Seid Ihr hungrig?«
Das war er, doch es gelüstete ihn bestimmt nicht nach verkochtem Eintopf. »Brot und Käse reichen.« Er ging zur Anrichte hinüber und schnitt eine dicke Scheibe von dem Brotlaib, der dort lag. Eve beobachtete ihn und kaute dabei auf ihrer Unterlippe herum.
»Wo ist Brunin?«, fragte er.
»Auf dem Schlafboden.« Sie deutete auf die Leiter, die auf den langen, schmalen Dachboden führte. »Guy hat gesagt, dass ihn jemand angegriffen hat.« Beim letzten Wort zitterte ihre Stimme.
»Wölfe erkennen einen Schwächling sofort.« Die Stimme war sehr tief für die einer Frau und so kalt wie ein rauer Januarmorgen. Lady Mellette wandte sich von den Stoffen ab und kam zu ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter herüber. Trotz ihres vorgerückten Alters hielt sie sich so gerade wie ein Stock. Ihr Kleid aus dunkelblauem Tuch und der Wimpel aus gebleichtem Leinen, den sie straff um ihren Kopf gelegt trug, wirkten geziemend streng. Nicht einmal in ihrer Jugend war sie eine Schönheit gewesen, doch sie verschaffte sich auf andere Art Aufmerksamkeit. Niemand wagte es, über Lady Mellette hinwegzusehen.
FitzWarin spürte den vertrauten Stich aus Zorn und Schuldgefühlen. »Brunin ist kein Schwächling«, erwiderte er heftig, und seine eigenen zwiespältigen Gefühle verliehen seinem Ton Schärfe. »Das hätte jedem Kind passieren können, das zur falschen Zeit am falschen Ort war.«
»So wie er es ständig zu sein scheint.« Mellettes Miene blieb unversöhnlich. »Guy hat uns erzählt, dass er seinem Aufpasser davongelaufen und allein herumgestreunt ist. Wenn er gehorcht hätte und geblieben wäre, wo er war, dann wäre das nicht passiert.«
Gereizt fuhr sich FitzWarin mit der freien Hand durchs Haar. »Bei Christi Leiden am Kreuz, Mutter, wenn er ständig gehorchen würde, müsste ich mir mehr Sorgen um ihn machen. Das zeigt doch, dass er einen Funken in sich trägt, den es zu schüren gilt.«
»Das ist so, als würde man einem Narren ein Goldstück geben und erwarten, dass er es am Ende des Tages immer noch hat. Und lästere in meiner Gegenwart nicht den Namen des Herrn!«
Er entschuldigte sich nicht, aber er schlug die Augen nieder, um ihrem flammenden Blick zu entgehen. »Hat Brunin irgendetwas gesagt?«
Mellette schnaubte unwirsch. »Genauso viel wie sonst auch. Man könnte fast glauben, er sei ohne Zunge geboren worden. Und ich frage mich, ob es sich mit seinem Verstand nicht tatsächlich so verhält.«
FitzWarin schluckte sein Brot hinunter und bemühte sich krampfhaft, nicht die Beherrschung zu verlieren. »Wenn er will, hat Brunin sowohl Stimme als auch Verstand«, sagte er.
»Was nicht gerade häufig der Fall ist.«
Plötzlich erklang das laute Heulen des Jüngsten, nachdem sich der vierjährige Thomas auf ihn hatte fallen lassen. Eve ging hinüber, fischte William aus dem Gewühl und hob ihn auf den Arm. Einen Augenblick später verlangte er unter lautem Protest und mit ausgestreckten Armen danach, sich wieder ins Getümmel stürzen zu können. Als Mellette die Szene beobachtete, huschte vorübergehend ein wohlwollender Ausdruck über ihre Züge, doch dann wandte sie ihre Aufmerksamkeit wieder FitzWarin zu.
»Hast du herausgefunden, wer es war?«
»Zwei Knappen aus dem Gefolge von Gilbert de Lacy.«
»Nun, das überrascht mich nicht. Sein Vater war ein Verräter, und er selbst hat beim Streit zwischen Stephan und Mathilde öfter die Seiten gewechselt als eine Hure die Männer am Vorabend der Schlacht. Ich kann doch hoffentlich davon ausgehen, dass du dich darum gekümmert hast?«
»Ja«, erwiderte er schroff. »Ich habe mich darum gekümmert.« Genau wie sein Sohn hatte er nicht die Absicht, sich ausführlicher zu dem Vorgefallenen zu äußern. Er nahm den Krug und schenkte sich einen Becher Wein ein.
Die Augenbrauen seiner Mutter zogen sich zusammen. »Das solltest du einer Magd überlassen«, sagte sie und sah sich suchend nach einer um.
»Wir sind hier im Haus eines Kaufmanns untergebracht, nicht am königlichen Hof«, knurrte er. »Ich kann schon für mich selbst sorgen.«
»Aber das ist kein Grund, dich wie ein Bauer zu benehmen. In deinen Adern fließt das Blut des Eroberers, vergiss das nicht.«
Durch eine mehr als fragwürdige Abstammung, dachte er bei sich, doch er konnte sich diese Bemerkung gerade noch verkneifen. Seine Mutter war die illegitime Tochter des Grafen von Derby, welcher seinerseits behauptete, ein illegitimer Sohn von Wilhelm dem Eroberer zu sein, der selbst als Bastard geboren worden war. FitzWarins Vater war ein verwegener Söldner gewesen, dessen reger Verstand und schnelle Klinge ihm die Aufmerksamkeit des Grafen und Mellettes widerstrebende Hand eingebracht hatten. Der schlanke, dunkelhäutige Warin de Metz hatte in einen höheren Stand eingeheiratet, und die stolze Lady Mellette war der Ansicht, dass sie weit unter dem Rang ihrer väterlichen Abstammung verehelicht worden war. Diese Überzeugung hatte ihre Verbindung von Anbeginn an vergiftet, und obwohl ihr Gemahl seit langem in seinem Grab ruhte, hatte die Verbitterung sie nicht verlassen. Ihr Reich war ein Königshof, sie war die Königin, und wehe dem, der dies vergaß.
Mellette schnalzte gereizt mit der Zunge, dann seufzte sie. »Ich habe über den Jungen nachgedacht«, verkündete sie.
»Ach ja?« FitzWarin schnitt hinter dem erhobenen Becher eine Grimasse.
»Du hast fünf weitere Söhne, alle kräftig und gesund.« Sie deutete auf die lautstark balgenden Jungen. »Warum weihst du Brunin nicht der Kirche? Einen Sohn in geistlichem Stand zu haben, ist in jeder Hinsicht hilfreich, und mir scheint, dass er für das Leben im Kloster geeignet wäre.«
»Nein«, entfuhr es FitzWarin lauter, als er beabsichtigt hatte. Dieser Gedanke war auch ihm bereits gekommen, und ihre Worte hatten an seinem Schuldgefühl gerührt. »Nein«, wiederholte er in beherrschterem Ton, als sie die Augenbrauen hochzog. »Ich hoffe, heute für Brunins Zukunft gesorgt zu haben. Ich habe mit Joscelin de Dinan darüber gesprochen, ihn zur Ausbildung nach Ludlow zu geben.«
Das brachte sie zum Schweigen. Hinter sich hörte er, wie Eve leise nach Luft schnappte.
Mellette ging zu einer Bank am Kamin und setzte sich auf den Rand, die Knie zusammengepresst, die Hände im Schoß gefaltet. »Der Erbe wird üblicherweise zu Hause erzogen«, sagte sie. Er bemerkte, wie ihre Augen aufblitzten und wie ihr Blick kurz zu Ralf hinüberhuschte. Es war offensichtlich, was sie dachte.
»Üblicherweise ja, aber nicht immer. Ich hoffe, dass die Erfahrungen, die Brunin in einem fremden Haushalt sammeln kann, seiner Entwicklung förderlich sein werden.«
»Und was ist mit Ralf und Richard? Willst du sie zu Hause erziehen?«
»Wahrscheinlich werde ich auch sie zur Ausbildung fortgeben«, sagte er. »Ich möchte mich ja nicht ganz über die Gepflogenheiten hinwegsetzen.«
Sie rümpfte geringschätzig die Nase. »Du glaubst, dass die Erziehung durch einen bretonischen Söldner uns und Brunin einen besseren Dienst erweisen wird, als ihn der Kirche zu übergeben?«
»Joscelin de Dinan ist mehr als bloß ein bretonischer Söldner«, entgegnete FitzWarin knapp. »Er stammt von den Grafen der Bretagne ab, und Ludlow ist eine bedeutende Festung. Verglichen damit ist Whittington geradezu eine armselige Hütte.«
Dieser Vergleich ließ Mellette zusammenzucken, und ihre Lippen zogen sich so fest zusammen wie die Schnur am Geldbeutel eines Geizhalses.
»Er verfügt über alle Fertigkeiten eines Kriegers und wenn es gefordert ist, auch über das Auftreten eines Höflings«, fuhr FitzWarin fort. »Brunin wird eine umfassende Erziehung bekommen. Lady Sybilla ist eine gewissenhafte Burgherrin, die ihre Pflichten den Knappen ihres Gemahls gegenüber ernst nimmt.« Er hatte als Köder eine Spur aus Krumen ausgelegt. Nun präsentierte er ihr den Rest des Brotlaibs, indem er sie mit Ludlow selbst lockte, das ihnen als Preis winkte. »Joscelin hat nur zwei Töchter. In Anbetracht von Sybillas Alter ist es höchst unwahrscheinlich, dass sie ihm noch einen Sohn gebären wird, dem die Ländereien zufallen würden, so dass wohl die beiden Mädchen erben werden.«
Mellette sah mit störrischer Miene auf ihre gefalteten Hände hinab. FitzWarins Entschlossenheit wuchs. Er würde Brunin fortschicken, was auch immer sie dagegen einwenden mochte.
Nach einer Weile hob sie den Kopf. »Vielleicht solltest du lieber Ralf nach Ludlow schicken. Wenn du eine Verbindung im Sinn hast, eignet sich dein zweiter Sohn besser dazu, de Dinan zu beeindrucken.«
»Nein, Mutter. Ich habe ihm Brunin angeboten, und dafür hatte ich gute Gründe.« FitzWarin zwang sich, den Wein nicht in einem Zug hinunterzustürzen. Er hatte im Wirtshaus schon mehr getrunken, als gut für ihn war, und dazu kamen noch die Becher am Stand des Weinhändlers.
»Welche Gründe?«, fragte sie herausfordernd.
»Er ist mein Erbe«, antwortete FitzWarin. »Joscelin wird keinen zweitgeborenen Sohn als Gatten für eine seiner Töchter akzeptieren, ganz gleich, wie fähig der Junge sein mag. Und Brunin braucht eine Gelegenheit, aus dem Schatten der Familie herauszutreten. Joscelin de Dinan kann ihm diese Gelegenheit bieten.«
Mellettes Kiefer mahlten, als kaute sie auf seinen Worten herum und fände darin sowohl Nahrung als auch groben Sand. »Nun ja, wenn er nach Ludlow geht, werden wir zumindest nicht die gesamte Priesterzeit hindurch für ihn aufkommen müssen«, räumte sie wiederwillig ein, »und vielleicht bewirkt Joscelin de Dinan ja sogar ein Wunder und verwandelt dieses unedle Metall in Gold.« Ihr Tonfall machte deutlich, dass sie daran zwar nicht glaubte, aber bereit war, abzuwarten, wie sich die Sache entwickelte.
FitzWarin wusste, dass er mehr Zustimmung von ihr nicht bekommen würde, und so stellte er seinen Becher ab und ging auf die Leiter zu, die zum Dachboden hinaufführte.
»Mein Gemahl, weckt ihn nicht auf«, sagte Eve rasch. »Er schläft.«
Er hielt inne und drehte sich um. Sofort schlug Eve die Augen nieder.
»Misch dich nicht ein, Weib«, erwiderte er, doch seine Stimme klang freundlicher als alles, was er seit seiner Rückkunft gesagt hatte. Die Tritte knarrten unter seinen Füßen, aber er ging davon aus, dass ein paar verstohlene Schritte Brunin schon nicht aufschrecken würden, wenn er bei dem Lärm schlafen konnte, den seine Brüder unten veranstalteten.
Die Läden standen offen, und FitzWarin blieb kurz am Fenster stehen. Immer noch tranken die Männer in den Wirtshäusern – und auch Frauen, dachte er, als ein schrilles Gackern durch das Fenster drang. Laternen und Kochfeuer glommen zwischen den Marktständen, da viele der Händler nachts bei ihren Waren Wache hielten. Über allem hing der Geruch von Rauch und Eintopf. Ein Pferd wieherte, und einige andere antworteten. Seufzend wandte er sich dem im Halbdunkel liegenden Raum zu und ging an der Reihe der Strohsäcke entlang, die auf dem Boden ausgebreitet waren.
Brunin lag auf dem letzten Strohsack, seine Umrisse zeichneten sich unter dem dünnen Überwurf aus gestreiftem walisischem Tuch ab. Sein Atem ging so flach, dass sich FitzWarin dicht über ihn beugen musste, um das Heben und Senken seines Brustkorbs erkennen zu können. Den rechten Unterarm hatte das Kind über die Augen geschoben, und selbst im Schlaf war die Faust fest geballt. Behutsam hob FitzWarin Brunins Arm an und legte ihn neben seinen Körper. Der Junge seufzte, und seine dichten schwarzen Wimpern flatterten, aber er wachte nicht auf. Aufgebracht, verwirrt und von einer Liebe erfasst, die so stark war, dass sie beinahe wie Trauer anmutete, betrachtete FitzWarin seinen schlafenden Erstgeborenen. Er erinnerte sich an die Nacht, in der er zur Welt gekommen war, eine wilde, stürmische Märznacht, in der der Wind so sehr getobt hatte, dass er Bäume entwurzelte, Heuhaufen mit sich riss und Hütten umwarf. Die Hebamme war mit einem wimmernden Bündel in den Armen aus der Geburtskammer gekommen und hatte den Männern das nächste Glied ihrer Linie gezeigt.
Damals hatte FitzWarins Vater noch gelebt, und er hatte das Kind als Erster gehalten. Schon in jener Zeit war die Ähnlichkeit zwischen Großvater und Enkel deutlich zu erkennen gewesen. Nicht nur in ihrer Hautfarbe, sondern im gesamten Körperbau, der eine jung und frisch wie ein eng aufgerolltes Weißdornblatt am Ende des Winters, der andere mitgenommen und zerfetzt vom langen Abstieg durch den Herbst ins welke Alter. FitzWarin hatte seinen Vater niemals weinen sehen, doch in jener Nacht hatte er es getan. Jetzt war er tot, und der Funke, den er weitergereicht hatte, drohte zu verlöschen.
Als er leise Schritte hörte, drehte er sich um und sah Eve auf sich zukommen. Die Dämmerung hatte die Farbe ihrer Haut und ihres Haars verblassen lassen und verwandelte ihre Augen in dunkle Tümpel, so dass sie wie ein Feenwesen aus den Tiefen der walisischen Hügel anmutete. Seine walisische Kinderfrau hatte ihm früher Geschichten von diesen Feen erzählt, und seine Gemahlin erschien ihm oft wie eine von ihnen. Wie oft erschien sie ihm wie eine leere Hülle, als wandle ihr wahres Wesen an einem anderen Ort. Ihre Ehe war aus politischen Gründen geschlossen worden, Gefühle waren an der Entscheidung nicht beteiligt gewesen. Sie erfüllten zwar ihre ehelichen Pflichten, doch es glich eher einem Gesellschaftstanz zwischen zwei Fremden. Sie war aufmerksam, fügsam, gehorsam und überaus fruchtbar. Und da er nie die eheliche Treue verletzt oder die Hand gegen sie erhoben hatte, hielt er sich für einen guten und rücksichtsvollen Ehemann.
Sie trat neben ihn und betrachtete ihren Sohn nun ebenfalls mit besorgtem Blick. »Er hat kein Wort gesagt.« Ihre Stimme war leise und ausdruckslos. »Weder zu mir noch zu sonst jemandem. Eure Mutter hat versucht, ihn zum Reden zu bringen, doch dadurch schien er nur noch verstockter zu werden.« Sie biss sich auf die Lippe. »Wenn ich seinen Schmerz auf mich nehmen könnte, würde ich es tun.«
In FitzWarin wallte ein Gefühl auf, das ihn die beengten Schlafverhältnisse bedauern ließ und Sehnsucht nach ihrem Schlafgemach in Whittington in ihm wachrief. Er legte seine Hand an ihre Taille, und seine kräftigen Finger, die Finger eines Schwertkämpfers, spreizten sich über die Rundung ihres Gesäßes. »Brunin muss lernen, sich durchzusetzen«, sagte er schroff.
Sie versteifte sich. »Oh ja«, sagte sie. »Das muss er wohl. So wie alle Männer.« Die zunehmende Dämmerung ließ ihre Züge verschwimmen, doch die Bitterkeit in ihrer sonst so sanften Stimme war nicht zu überhören.
»Eve?« Die Verblüffung entlockte ihm ihren Namen, und er betrachtete sie von der Seite.
Ein Muskel zuckte an ihrem Hals. »In Gottes Namen, Mylord, schickt ihn fort aus diesem Haushalt, ehe es zu spät ist.« Sie entwand sich seiner Umarmung und eilte vom Dachboden.
Bei dem Geräusch ihrer laufenden Schritte bewegte sich der Junge auf seinem Strohlager und murmelte im Schlaf etwas vor sich hin, doch was er sagte, konnte sein Vater nicht verstehen.
FitzWarin rieb sich mit den Händen übers Gesicht. Ein dumpfer Schmerz, der von dem vielen Wein und der Anspannung herrührte, begann in seinem Kopf zu hämmern. Er konnte sich nicht dazu durchringen, wieder zu den Frauen und seinen herumtobenden Söhnen hinunterzugehen. Nachdem er seine Stiefel ausgezogen hatte, streckte er sich auf dem freien Strohsack neben Brunin aus und schloss die Augen. Er schlief ein, den Arm über die Augen geschoben und die Faust fest geballt.
3
Den Kopf auf eine Nackenrolle gestützt, lag Hawise de Dinan rücklings im Bett ihrer Eltern und starrte hinauf zum Baldachin. Neben sich hörte sie, wie Marion angestrengt ein Kichern zu unterdrücken versuchte, und das reizte sie ebenfalls zum Lachen. Sie presste die Lippen zusammen und kämpfte gegen den Lachanfall an, der aus ihr herauszubrechen drohte.
»Du sollst doch die Augen geschlossen halten. Du bist schwer verletzt«, schimpfte Sibbi verärgert.
Ohne den Kopf zu bewegen linste Hawise zu ihrer Schwester hinüber, die das zweitbeste grüne Kleid ihrer Mutter trug, das sie aus der Kleidertruhe stibitzt hatte, und den dazu passenden seidenen Wimpel. Sie hielt eine Rolle Leinenbinden in der Hand.
»Menschen sterben mit offenen Augen«, gab Hawise zu bedenken. Nicht dass sie tatsächlich jemals gesehen hätte, wie jemand seinen letzten Atemzug tat, aber letztes Jahr hatte sie in der Kapelle an der Totenwache für einen der Ritter teilgenommen und erinnerte sich daran, dass man Münzen auf seine Lider hatte legen müssen, um sie geschlossen zu halten.
»Aber du stirbst ja nicht, du bist nur verletzt.«
»Darf ich dann stöhnen?«
Sibbi verdrehte die Augen.
»Im echten Leben würde ich doch auch stöhnen, oder nicht?«
»Stimmt, das würde sie«, bekräftigte Marion und nickte energisch mit ihrem flachsblonden Kopf. Sie hatte sich ein Kissen unter das Kleid gestopft. »Ich glaube, das Kind kommt«, sagte sie. »Darf ich auch stöhnen?«
»Nein, darfst du nicht.« Sibbis graublaue Augen blitzten vor Ärger. »Und du kannst das Kind erst bekommen, wenn ich die Wunden deines Gemahls verbunden habe!«
Die drei Mädchen spielten »Belagerung«. Es war Hawises Idee gewesen, sie war ein Wildfang mit lebhafter Fantasie, und so hatte sie sich leicht in die Rolle des kühnen Ritters hineinversetzen können, der die Burg vor dem Angriff seiner Feinde rettete. Marion hatte sich dafür entschieden, die Burgdame zu verkörpern, und da sie, wenn auch auf eine andere Weise, genauso viel Gefallen an Dramatik fand wie Hawise, hatte sie ihre gefahrvolle Lage zusätzlich noch durch eine Schwangerschaft ausgeschmückt. Sibbi, die zwei Jahre älter war als ihre Schwester und Marion, begeisterte sich eher für den heilkundlichen Aspekt des Spiels. Sie wollte die eingebildeten Wunden pflegen und dabei ihre Verbandskünste schulen. Die Geburt eines Kindes überstieg noch ihre Kenntnisse, doch ein Kissen war schon einmal ein guter Anfang.
»Gib mir deinen Arm«, befahl sie Hawise.
»Du musst mir erst viel Wein geben, damit ich betrunken werde«, erwiderte Hawise sachkundig. »Als Papa vom Pferd gefallen ist und sich das Schlüsselbein gebrochen hat, hat Mama ihn drei Quart walisischen Met trinken lassen, ehe sie sich um seine Verletzung gekümmert hat.«
»Dann tu einfach, als wärst du betrunken«, gab Sibbi schnippisch zurück.
Hawise verzog angestrengt das Gesicht und versuchte, sich an den Vorfall zu erinnern. Ihr Vater hatte ständig durch seine zusammengebissenen Zähne geredet und war ausgesprochen übler Laune gewesen. Der Met hatte seine Stimmung gebessert, doch als er angefangen hatte, ein Lied über acht lüsterne Jungfrauen und eine gelbe Katze zu singen, hatte ihre Mutter Hawise hastig aus dem Zimmer gescheucht. Schade. Sie hätte liebend gerne noch das Ende des Lieds gehört.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: