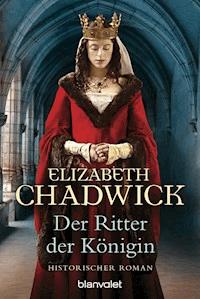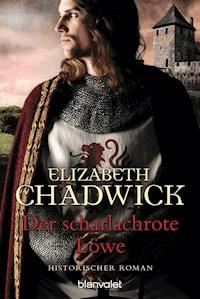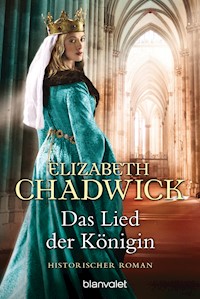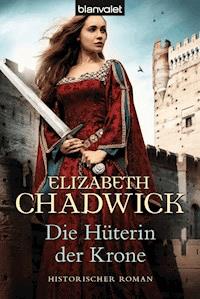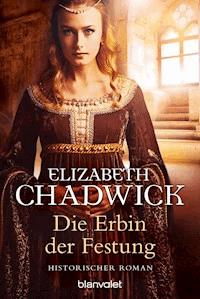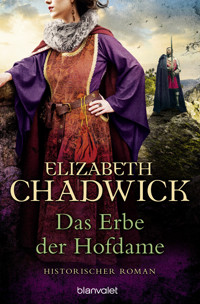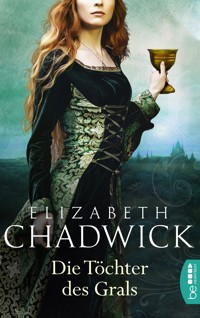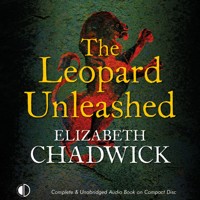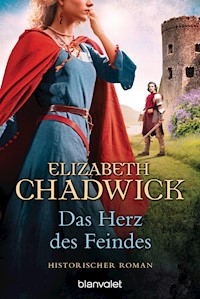9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Um seine Seele zu retten, muss er einen gefährlichen Weg zurücklegen ...
Ein langes, ruhmreiches Leben neigt sich dem Ende, doch William Marshall hat einen letzten Auftrag: Sein Knappe soll die Seide, die er als junger Mann in Jerusalem selbst gewoben hat, zum Orden der Templer bringen. Während er darauf wartet, dass seine letzte ritterliche Pflicht erfüllt wird, erinnert er sich an seine Vergangenheit. Denn er trat einst die lange Reise nach Jerusalem an, um seinem geliebten Prinzen ein Gelübde zu erfüllen. Doch die dunklen Pfade, auf denen er wanderte, brachten ihm neben großer Leidenschaft auch großen Verlust. Und doch wurde William Marshall in der heiligsten und gefährlichsten Stadt der Welt zum größten Ritter aller Zeiten …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 829
Ähnliche
Buch
England, 1219
William Marshal, der größte Ritter Englands, liegt auf dem Sterbebett, doch er hat noch einen vertrauensvollen Auftrag für seinen treuen Diener: Er soll die seidenen Grabtücher, die er vor dreißig Jahren aus dem Heiligen Land mitnahm, dem Templerorden übergeben. Es ist an der Zeit, das Gelübde, das er den Templern gab, zu erfüllen, um für alle Ewigkeit ein Mönch ihres Ordens zu werden.
Während er auf die Rückkehr seines Dieners wartet, blickt er auf seine lange Pilgerfahrt mit seinem Bruder Ancel und die ihnen übertragene heilige Mission zurück, den Mantel ihres toten jungen Herrn nach Jerusalem zu tragen und ihn auf die Grabstätte Christi zu legen.
Jerusalem, 1183
In der heiligsten aller Städte geraten die Brüder in tödliche politische Machenschaften und hinterhältige Pläne der mächtigen Männer und Frauen, die das Königreich regieren. Zusammen mit der gefährlichen, launenhaften Paschia de Riveri, Konkubine des höchsten Kirchenmanns des Landes, begeben sich William und sein Bruder auf einen äußerst gefährlichen Weg …
Autorin
Elizabeth Chadwick lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in Nottingham. Sie hat inzwischen über zwanzig historische Romane geschrieben, die allesamt im Mittelalter spielen. Vieles von ihrem Wissen über diese Epoche resultiert aus ihren Recherchen als Mitglied von »Regia Anglorum«, einem Verein, der das Leben und Wirken der Menschen im frühen Mittelalter nachspielt und so Geschichte lebendig werden lässt. Elizabeth Chadwick wurde mit dem Betty Trask Award ausgezeichnet, und ihre Romane gelangen immer wieder auf die Auswahlliste des Romantic Novelists’ Award.
Von Elizabeth Chadwick bereits erschienen (Auswahl):
Die englische Rebellin ∙ Die Hüterin der Krone ∙ Das Lied der Königin ∙ Das Herz der Königin ∙ Das Vermächtnis der Königin
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Elizabeth Chadwick
Der letzte Auftrag des Ritters
Roman
Deutsch von Nina Bader
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »Templar Silks« bei Sphere, an imprint of Little, Brown Book Group, an Hachette UK Company, London
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2018 by Elizabeth Chadwick
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018 by Blanvalet Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Redaktion: Bettina Hengesbach
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (Aleksminyaylo1; Fernando Cortes; Vladyslav Spivak; Evgeniia Litovchenko)
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
LH ∙ Herstellung: sam
ISBN: 978-3-641-22953-5 V002
www.blanvalet.de
1
Landsitz Caversham bei Reading, Berkshire – Wohnsitz von William Marshal, Regent von England – April 1219
»Jetzt wird es nicht mehr lange dauern.«
Als William die Stimme hörte, drehte er den Kopf auf dem Kissen, aber er konnte nicht einschätzen, ob die Worte seinem Geist entsprangen, dem spirituellen Reich von Träumen und Visionen, die ihn jetzt ständig begleiteten, oder ob jemand im Raum laut gesprochen hatte. Er hatte häufig das Gefühl zu schlafen, obwohl er wach war, und der Kampf, zu vollem Bewusstsein zurückzukehren, nahm mit jedem verstreichenden Tag mehr Zeit in Anspruch.
Eine kühle Brise trug den frischen Duft des Frühlings durch das offene Fenster zu ihm herüber. Sonnenlicht wärmte den steinernen Dreierbogen und verwandelte das gesprenkelte Grau in fahles Gold, flutete über das Bett, verlieh der schlichten braunen Decke einen satten Ton und berührte segnend seine altersfleckige Hand. Während er den Fries betrachtete, der entlang der Oberkante der Wand verlief und abwechselnd sein scharlachrotes Löwenemblem und Isabelles rote Sparren auf goldenem Grund zeigte, dachte er darüber nach, wie kurz ein Menschenleben in Gottes großem Gesamtbild doch war. Es gab noch so viel zu tun, aber er verfügte nicht länger über die Fähigkeit, diese Dinge zu vollbringen; daher mussten nun andere die Zügel in die Hand nehmen. Ihm war ein anderes Schicksal zugedacht.
Die Tür wurde geöffnet, und ein stämmiger Mann mittleren Alters betrat die Kammer. Nachdem er mit Williams Templeralmosenpfleger Bruder Geoffrey ein kurzes gemurmeltes Wort gewechselt hatte, trat er an die Bettkante. »Sire, Ihr habt nach mir geschickt?«
William zwang sich, sich auf seinen Besucher zu konzentrieren. Jean D’Earley war vor über dreißig Jahren als Knappe in seinen Haushalt eingetreten und war, während er es zum Ritter und Lord gebracht hatte, zu einem engen Freund und Vertrauten geworden. Dennoch gab es Dinge, die auch er nicht wusste.
William deutete auf den Krug auf dem Tisch neben seinem Bett. »Etwas zu trinken, wenn du so gut wärst, Jean.«
Mit einem besorgten Ausdruck in den Augen goss Jean klares Quellwasser in Williams Kelch. »Habt Ihr heute schon etwas gegessen, Sire?«
Hatte er das? Essen bedeutete ihm dieser Tage wenig – eine Ironie, wo doch sein Spitzname einst »Gasteviande« gelautet hatte, was hieß, dass er alles verschlang, was ihm in die Hände geriet, und immer noch nach mehr verlangte. Wie groß war damals sein Appetit gewesen, und zwar nicht nur auf Speisen, sondern auf alle Freuden des Lebens. »Die Gräfin hat mir vorhin in Milch eingeweichtes Brot gebracht«, erwiderte er. Die Nahrung für Kleinkinder, Alte und Sterbende. Er hatte es nur hinuntergewürgt, um Isabelle zu beschwichtigen.
Er konzentrierte sich darauf, seine Hand ruhig zu halten, während er den Becher an seine Lippen führte. Vor zwei Jahren, mit siebzig, hatte dieselbe Hand noch die Kraft besessen, ein Schwert zu schwingen und eine Bresche in ein Kampfgewühl zu schlagen. Troubadoure besangen ihn als »pfeilschnell wie ein Adler« und »raubgierig wie ein Löwe«. Vielleicht hatte das der Wahrheit entsprochen, aber er vermutete eher, dass sie in der Hoffnung auf eine großzügige Entlohnung übertrieben.
Er trank ein paar Schlucke, um seine Kehle zu befeuchten. »Ich möchte, dass du etwas für mich tust. Etwas, worum ich keinen anderen Mann bitten würde.«
»Mit Vergnügen, Sire«, entgegnete Jean ernst. »Betrachtet den Auftrag als erledigt.«
William lächelte sarkastisch. Ein halbes Leben zuvor hatte sein eigener Herr auf seinem Sterbebett ähnliche Worte zu ihm gesagt, und er hatte ein Versprechen abgegeben, ohne zu ahnen, welchen Preis er würde zahlen müssen. Er gab Jean den Krug zurück. »Deine Loyalität ist unerschütterlich.«
»Bis zum Tod, Sire.«
William lachte und hielt dann vor Schmerz den Atem an. »Ja«, stieß er keuchend hervor. »Aber nicht bis zu deinem, hoffe ich – zumindest noch nicht.«
Er bedeutete seinem Besucher, das Kissen aufzuschütteln und ihm zu helfen, sich aufzusetzen. Jeans Klopfen zerbröselte die getrockneten Lavendelzweige in der Füllung, und ein sauberer, strenger Duft erfüllte die Luft.
»Was soll ich tun, Sire?«
William folgte den Sonnenstrahlen auf der Bettdecke mit dem Finger. »Ich möchte, dass du dich nach Wales, nach Striguil begibst und Stephen nach zwei Seidenstücken fragst, die ich ihm nach meiner Rückkehr aus Jerusalem anvertraut habe.«
Jeans dunkle Augenbrauen schossen bis zum Ansatz seines silbernen Haarschopfes hoch.
»Ja«, bestätigte William. »Ein halbes Leben und eine Gnade, die zu erleben ich nicht erwartet hätte. Du musst unseren Männern im Grenzgebiet auch noch Briefe zustellen, aber die Seidenstücke haben Vorrang, und du musst sie unverzüglich zu mir bringen.« Er sah, dass Jeans Blick plötzlich bestürzt wirkte, als er die Dringlichkeit der Forderung begriff. Es war so schwer, einem Freund, der selbst dann nicht an das Unvermeidliche glauben wollte, wenn er mit den Beweisen dafür konfrontiert wurde, die Nachricht von der Endgültigkeit beizubringen.
»Natürlich. Ich werde sofort aufbrechen. Aber was, wenn …« Jean brach ab und rieb sich den Nacken.
William streckte eine Hand aus und umschloss Jeans Unterarm so fest, wie er es vermochte. »Tu, was ich dir sage, mein Junge, und ich werde hier sein, wenn du zurückkommst – ich verspreche es. Ich habe noch nie ein Versprechen gebrochen, das ich dir gegeben habe, nicht wahr?«
»Nein, Sire, das habt Ihr nicht.« Jean schluckte. »Ich würde auch kein Versprechen brechen, das ich Euch gebe. Ich schwöre, dass ich so schnell zurückkomme, wie ich kann.«
William blickte zu dem durch das Fenster strömende Licht. »Das Wetter ist schön, und die Straßen werden gut passierbar sein.« Ein Abglanz des alten Lächelns huschte über sein Gesicht. »Ich würde ja mit dir kommen, aber da das unmöglich ist, werde ich dich im Geiste begleiten. Ich wünsche dir eine gute Reise.«
Jean verneigte sich tief, presste eine Hand auf sein Herz, als er sich aufrichtete, und verließ mit stolzen, zielstrebigen Schritten rasch den Raum.
Ermattet und ausgelaugt sank William in die Kissen zurück. Er betrachtete die Bögen blauen Himmels durch das Fenster, spürte, wie eine leichte Brise sein Gesicht streichelte, und erinnerte sich an längst vergessene Apriltage, als er mit dem Schwung der Jugend an Turnieren teilgenommen, hohe Lösegeldsummen eingestrichen und jeden Preis gewonnen hatte. Er war im Gefolge von Königen und Königinnen geritten, und das Leben war mit der Schnelligkeit und Kraft eines galoppierenden Pferdes durch seine Adern geströmt. All diese physische Stärke und Vitalität waren nur noch kleine Überbleibsel in seinem sterbenden Körper, doch die Erinnerungen blieben so lebhaft und reich, so von Freude und Schmerz erfüllt wie in dem Moment, in dem sie entstanden waren.
Mit der frischen Luft wehten die Rufe der Stallburschen, die Jeans Pferd sattelten und sein Packpferd bereitmachten, durch das offene Fenster zu ihm herüber. Wenn sich das Wetter hielt und es auf der Straße nicht zu Verzögerungen kam, würde dieser Auftrag weniger als vierzehn Tage in Anspruch nehmen. Eine so kurze Zeitspanne, die doch zu aller Zeit der Welt führte. Einer Ewigkeit.
William schloss die Augen und schickte seine Gedanken durch Tunnel der Erinnerungen, bis er zu dem Moment an einem warmen Sommerabend gelangte, der ihn unerbittlich zu diesen beiden Stücken Seidenstoff geführt hatte.
Es hatte an einem Schrein im Limousin begonnen, und er war auf Raub aus gewesen.
2
Martel, der Limousin, Juni 1183
Die kleine Silbermünze blitzte auf, als sie sich in einem Strahl staubigen Sonnenlichts drehte, bevor sie in den Nachmittagsschatten getaucht wurde und mit einem leisen Klirren zwischen William und seinem jungen Herrn auf den Tisch fiel.
Henry – Harry für seine Vertrauten –, der älteste Sohn des Königs von England, deutete auf die Münze. »Da«, sagte er. »Alles, was zwischen uns und bitterer Armut steht.« Er trug sein übliches Lächeln zur Schau, doch jeglicher Humor war aus seinen blauen Augen gewichen. »Kein Geld, um die Truppen zu bezahlen, die Pferde zu füttern und unsere Bäuche zu füllen.« Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, warf er seinen mageren Geldbeutel auf den Tisch.
William erwiderte nichts darauf. Der einzige Ausweg aus ihrer heiklen Lage bestand darin, dass Harry sich mit seinem Vater versöhnte, gegen den er derzeit Krieg führte. Und das würde er nie tun, weil es bei dem Streit hauptsächlich darum ging, dass Harry weder über Land noch über die Macht verfügte, sein Leben nach eigenem Gutdünken zu leben, und finanziell von seinem Erzeuger abhängig war.
Sie hatten die umliegende Gegend und die Dörfer geplündert und durch verschiedene, oft hinterhältige Überzeugungsmethoden Tribute eingefordert, bis diese Vorratskammer ausgeschöpft war. Nachdem sie bereits ihre wertvollsten Besitztümer verkauft oder verpfändet hatten, würde eine zweite Runde des Knauserns und Knapsens nicht annähernd die erforderlichen hundert Mark einbringen. Nächste Woche würden weitere hundert dazukommen. Sie waren in die Enge getrieben und dem Druck ihrer eigenen Söldner ausgesetzt, die ihren Lohn mit Drohungen einforderten.
Trotz Harrys theatralischer Geste mit dem Penny blieben ihm noch ein paar Wertgegenstände von der Plünderung des Grabes des heiligen Martial vor einigen Monaten – ein juwelenbesetztes Kreuz, vergoldete Kerzenleuchter und verschiedene Altarschmuckstücke – aber diese stellten ihre Notreserve dar und steckten in den Satteltaschen seines Pferdes, falls er flüchten musste.
Harry griff nach der Münze und schnippte sie erneut in die Luft, vom Licht in den Schatten. »Wir werden Rocamadour einen Besuch abstatten und die Kirche um ein weiteres Darlehen ersuchen müssen«, sagte er beiläufig. »Sie strotzen da oben vor Geld und fangen nichts damit an, richtig?«
Der Penny fiel vom Tisch und verschwand in der dicken Binsenschicht auf dem Boden. Hinter der Fassade der Gelassenheit lauerten Groll und Provokation.
»Sire, davon würde ich abraten.« William wurde langsam unbehaglich zumute. Er war bei dem Überfall auf St. Martial nicht dabei gewesen und hatte kein Verlangen, in die Plünderung eines so heiligen Schreins wie Rocamadour verstrickt zu werden.
»Ha, all das Silber und Gold, das die Kirche angehäuft hat, dient doch nur dazu, ihre Kapellen zu schmücken, von Bauern angegafft und von Priestern neidisch gehütet zu werden. Gott versteht, dass ich es ihm zurückzahlen werde. Habe ich nicht in Seinem Namen das Kreuz genommen?« Harry deutete auf die beiden auf den Brustteil seines Mantels aufgenähten Seidenstreifen.
»Wäre es nicht besser, die Friedensverhandlungen mit Eurem Vater wieder aufzunehmen?«
Williams Worte riefen ein verächtliches Schnauben hervor. »Er würde nichts anderes tun, als meine Schulden zu bezahlen und mich zu ermahnen, mich in Zukunft besser zu benehmen, ohne sich die Mühe zu machen, mir zuzuhören. Ha! Vielleicht sollte ich wirklich nach Jerusalem reisen. Da würde der Bart des alten Ziegenbocks weiß werden!« Harry winkte ungeduldig ab. »Ich werde tun, was ich tun muss – es sei denn, Ihr habt eine andere Idee, die nichts mit meinem Vater zu tun hat?« Er warf William einen gebieterischen Blick zu; lud die Bürde auf seine Schultern, machte ihn dafür verantwortlich, dass sie sich in dieser Lage befanden.
William verzog das Gesicht. In Wahrheit hatten sie die Wahl, entweder die Altäre von Rocamadour zu plündern, um ihre Schulden zu bezahlen, oder zu riskieren, Opfer ihrer eigenen Söldner zu werden, die mit ihm, William, hart ins Gericht gehen würden, weil er der Zahlmeister war, die Schnittstelle zwischen ihnen und Harry, für den man seinem Vater zumindest noch ein Lösegeld abpressen konnte. Trotzdem unternahm er noch einen Versuch, denn Gottes Zorn dauerte nicht nur einen Moment an, sondern ewig. »Sire, ich bin immer noch der Meinung, dass wir es nicht tun sollten.«
»Ich entscheide, was wir tun sollten und was nicht«, fauchte Harry. »Wagt es vielleicht irgendjemand, die Worte meines teuren Bruders Richard in Frage zu stellen? Gilt mein Wort weniger als seines? Glaubt Ihr, Richard und seine Söldner würden zögern, sich das zu nehmen, was sie brauchen? Bei Christus, er hat Aquitanien die letzten zehn Jahre lang ausgenommen wie ein Fleischer ein Schwein!« Er sprang auf. »Teilt das den Männern mit, und sorgt dafür, dass die Ordnung gewahrt wird. Sagt ihnen, sie werden ihren Sold bekommen. Ah, meine Eingeweide!« Eine Hand auf seinen Bauch gepresst, vollführte er mit der anderen eine Geste, die William zu verstehen gab, dass er sich entfernen sollte, und eilte abrupt zu der Nische, die die Latrine beherbergte.
Von schweren Bedenken geplagt verließ William den Raum, wohl wissend, dass er in der Falle saß. Er hatte einen Eid geschworen, seinem jungen Herrn in jeder Lebenslage beizustehen, und wenn das den Weg zur Hölle einschloss, dann musste er diese Reise antreten und Harry auf jedem bitteren Schritt beschützen und verteidigen.
Als er den Hof überquerte, war er sich bewusst, dass die Söldnersoldaten seine Bewegungen mit Raubtieraugen verfolgten. Sancho, einer der Hauptmänner, hatte bei einem Würfelspiel im Staub gesessen, erhob sich jetzt aber, vertrat William den Weg, verschränkte die Arme vor der Brust und schob einen Fuß vor, um die Aufmerksamkeit auf das Schwert zu lenken, das auf seiner Hüfte ruhte. »Ich nehme an, Ihr habt gute Nachrichten für mich, Messire Marshal?«
»Ihr werdet bezahlt werden«, erwiderte William kurz angebunden. »Ihr habt mein Wort darauf.«
»Und ich vertraue auf Euer Wort.« Ein hartes Grinsen durchzog den schwarzen Vollbart des Söldners. »Aber die Frage ist, wann?«
»Morgen Abend. Ich verspreche es.«
»Dann werde ich dies den anderen mitteilen.« Sancho neigte den Kopf und schlenderte zu seinem Spiel zurück.
William ging weiter; achtete darauf, seine Schritte locker und seine Hände geöffnet zu halten, während sich seine Gedanken in engen, immer kleiner werdenden Kreisen drehten.
»Hier, die wirst du brauchen. Zieh dich an, und mach dich bereit loszureiten.« William warf seinem Bruder Ancel, der auf der Kante seiner Pritsche saß und sich das vom Schlaf zerzauste Haar aus den Augen strich, eine wattierte Tunika zu. Ancels Hemd war nicht zugeschnürt, und seine stämmigen Beine waren bis auf eine kurze Unterhose nackt.
»Es ist noch mitten in der Nacht«, stöhnte er und blinzelte dabei in das Licht der Laterne.
»Es ist eine Stunde vor Tagesanbruch.«
»Wo reiten wir überhaupt hin?« Ancel tastete nach seiner Hose.
»Wir müssen Geldmittel auftreiben – beeil dich.«
»Das wird auch Zeit. In der Speisekammer sind nur noch Suppenknochen, und beim Würfeln spielen wir um Zeltpflöcke. Ist es ein langer Ritt?«
»Nach Rocamadour.«
Ancel hielt mit dem Ankleiden inne. Seine Augen wurden groß. »Rocamadour?«
»Ja«, versetzte William. »Rocamadour.« Er nahm eine Satteltasche von einem Wandhaken und warf sie auf Ancels Bett. »Die wirst du für die Beute brauchen.«
Ancel starrte ihn voller Entsetzen an. »Das ist eine Sünde«, krächzte er heiser. »Gott wird uns mit Sicherheit dafür strafen!«
»Es ist ein Darlehen, das mit Zinsen zurückgezahlt wird.«
»Ja, mit unseren Seelen.« Ancel schüttelte den Kopf. »Wir werden in der Hölle dafür bezahlen – ich komme nicht mit.«
»Oh doch, das tust du. Wir haben keine andere Wahl, es sei denn, du weißt, wo wir genug Geld auftreiben können, um die Söldner vor dem nächsten Sonnenuntergang zu bezahlen. Wenn nicht, können wir uns ebenso gut selbst die Kehle durchschneiden, und das war es dann.«
Ancel presste die Lippen zusammen. Seine Augen funkelten aufsässig.
William musterte seinen schlaftrunkenen jüngeren Bruder erbost. Er hatte Ancel vor vier Jahren in sein Turniergefolge und dann in den Militärdienst bei Harry aufgenommen. Ancel war eine seltsame Mischung von Gegensätzen – unschuldig und wissend, geschickt und tollpatschig, oft töricht, aber tief in seinem Inneren wahrlich weise. Ein Vorzug und eine Verpflichtung.
»Wir werden dafür verdammt werden«, wiederholte Ancel.
William biss sich auf die Lippe. Wenn sein Bruder begann, seine Sätze zu wiederholen, konnte man nichts anderes tun, als ihn zu ignorieren. Er mochte eingeschnappt sein, aber er würde tun, was ihm befohlen wurde, wenn auch nur langsam, widerwillig und mit vielen bösen Blicken. Er konnte die Nachhut bilden, was jedem recht sein würde. Irgendjemand musste ohnehin auf die Pferde Acht geben und die Gegend im Auge behalten.
»Beeil dich«, mahnte William knapp. »Lass unseren Herrn nicht warten.«
Draußen versammelten sich die Truppen. Ihr Atem bildete in der frühen Morgenluft einen feinen Nebel. Unter Ächzen, Spucken und gelegentlichem nervösem Auflachen wechselten sie verstohlene Blicke. Ihre Stimmung war eine Mischung aus Beklommenheit und trotzig zur Schau gestellter Kampfeslust.
Williams Knappe Eustace schnallte die Ledertaschen auf Williams muskulösem Braunen fest.
»Ist das wahr, Sire?«, fragte er, als William nach den Zügeln griff und sich in den Sattel schwang. »Wir wollen Rocamadour überfallen?«
William verdrehte die Augen. »Nicht du auch noch! Es steht dir nicht zu, diese Entscheidung zu hinterfragen. Halte dich bedeckt und tu deine Pflicht – hast du mich verstanden?«
»Ja, Sire.« Eustace senkte den Blick und bekreuzigte sich im Schatten heimlich, doch William registrierte die Geste mit Verdruss, denn am liebsten hätte er es ihm gleichgetan.
Harry kam aus seiner Unterkunft und setzte dabei eine kleine Filzkappe auf. Im Gegensatz zu seinen Rittern, die er angewiesen hatte, ihre Rüstungen anzulegen, war er in seine Hoftracht gekleidet – eine bestickte Tunika, ein mit Goldborte gesäumter Umhang und ein kostbarer roter, mit Silber beschlagener Gürtel – Dinge, die er einbehalten hatte, während anderer persönlicher Zierrat verkauft worden war, um Pferde und Männer zu ernähren.
Er bedachte William mit einem starren Lächeln, als er den Fuß in den Steigbügel schob. »Gut, worauf warten wir? Lasst uns nach Rocamadour reiten und uns ein Darlehen sichern.«
Als sich der Trupp zum Aufbruch bereitmachte, kam Ancel mit grimmig zusammengekniffenen schmalen Lippen aus seinem Quartier. Ohne irgendjemanden eines Blickes zu würdigen, warf er seine Tasche über die Kruppe seines Kastanienbraunen und stieg auf.
William maß ihn mit einem harten Blick, ließ ihm sein Verhalten aber durchgehen. Zumindest hatte er ihn nicht am Kragen herschleifen müssen, und im Moment gab es Wichtigeres, worüber er sich den Kopf zerbrechen musste.
Der Schrein von St. Amadour umfasste steile Klippen, die vierhundert Fuß über dem silbern schimmernden Fluss Alzou aufragten. Die in das steinerne Antlitz der Schlucht hineingebauten, von der Morgensonne vergoldeten Kapellen schienen sich wie strahlende kleine Leuchtfeuer vom Morgenhimmel abzuheben. William biss die Zähne zusammen und bemühte sich, seine Bedenken und seine Furcht vor Gott zu ignorieren. Er wagte es nicht, sich auch nur den leisesten Hauch eines Zweifels anmerken zu lassen, weil seine Männer dies sofort bemerken und dementsprechend reagieren würden. Einige standen bereits jetzt kurz davor, zurückzuscheuen wie nervöse Pferde.
Harry hatte seine eigenen Gewissensbisse dadurch beschwichtigt, dass er erklärte, der Schatz sei nur ein Darlehen, und er habe als Sohn eines Königs und künftiger Wohltäter des Schreins das Recht, sich vorübergehend daran zu bedienen. Selbst ein Narr musste erkennen, dass seine Ansprüche berechtigt waren. Sein Vater hatte ihn zum König von England gekrönt, als er gerade fünfzehn Jahre alt gewesen war, und er trug seine Königswürde wie eine Rüstung und benutzte das Blendwerk seines Charmes als Schild.
Eine Handvoll Soldaten bewachte den Eingang zu der befestigten Stadt, die zum Schrein hochführte, aber Harry und William hatten dies bedacht, als sie den Plan geschmiedet hatten, und die Truppe daher aufgeteilt. Das Dutzend Söldner, das sie aus Martel mitgebracht hatten, hielt sich ein Stück entfernt verborgen. Harry, der auf das Tor zuritt, hatte als Eskorte nur seine persönliche Leibwache bei sich.
Mit einem Lächeln, das die ganze Welt zu erhellen vermochte, verkündete Harry, er sei gekommen, um am Schrein zu beten, und versprach, nichts Böses im Schilde zu führen, sondern dem Heiligen nur Ehre und Achtung zu erweisen. »Mich haben zahlreiche Sorgen geplagt.« Er legte sich eine Hand ans Herz, setzte eine zerknirschte Miene auf, und seine Augen weiteten sich voller Unschuld. »Im Traum hatte ich die Vision, dass ich hier bei Saint Amadour und der Heiligen Jungfrau Trost und Anleitung finden würde.«
Die Wachposten berieten sich und fielen beide ebenfalls Harrys gefährlichem Charme zum Opfer, als sie sich entschieden, das Tor zu öffnen und ihn einzulassen. Danach war alles ganz leicht. Mit einigen wenigen, jedoch oft geübten Bewegungen entwaffneten William und die anderen Ritter die Soldaten und fesselten sie an einen Pfosten. Mit drei Jagdhornfanfaren riefen sie die Söldner herbei. »Denkt daran – es soll kein Blut vergossen werden«, warnte Harry. »Ich möchte nicht, dass dieses Unterfangen durch Tote besudelt wird.«
Harry überließ es den Söldnern und Knappen, das Tor zu verteidigen, und eilte mit seinen Rittern die schmale Straße zu der steilen Treppe entlang, die zu dem Schrein mit seinen Kerzenleuchtern und Platten, seinen Juwelen und seinen Reliquien führte, zu denen auch das berühmte Schwert Durendal gehörte, das sich einst im Besitz des Helden Roland befunden hatte.
Pilger flüchteten in Panik vor den glitzernden Rüstungen und den bedrohlichen Schwertern. Angespannt und auf der Hut rechnete William dort, wo die Stufen zu der Terrasse der Kapelle der Heiligen Jungfrau führten, mit Widerstand, aber es wurde kein Alarm geschlagen. Ein einzelner graubärtiger Wächter war anwesend, um die Pilger zur Ordnung anzuhalten, doch er hatte gerade in eine Ecke gepisst und zupfte immer noch seine Kleider zurecht, als die Räuber eintrafen.
»Tretet zur Seite, dann wird Euch nichts geschehen«, schnarrte William.
Der Wächter hob zum Zeichen, dass er sich ergab, die Hände und wurde augenblicklich entwaffnet und gefesselt. Zwei Mönche, die sich in der Kapelle aufgehalten hatten, beeilten sich, den Schrein mit seinem schmiedeeisernen Gitter zu sichern, aber William war schneller; er sprang vor, schob die Schulter, die von seinem Kettenhemd geschützt wurde, durch die Lücke und drängte die Brüder zur Seite.
»Holt Euren Abt«, befahl Harry. »Richtet ihm aus, dass König Henry ihn dringend zu sprechen wünscht.«
Die Mönche stürzten mit um ihre Sandalen flatternden Kutten davon. Ein halbes Dutzend Pilger kauerte vor dem Altar. William scheuchte sie hinaus und beobachtete, wie sie flohen; denn dies war leichter, als die Muttergottes anzublicken und sich zu fragen, was seine eigene Mutter wohl sagen würde, wenn sie ihn jetzt sehen könnte.
Harry trat mit aufgesetzter Gelassenheit auf den Altar zu. »Lasst dies hier.« Er deutete auf die Statue der Jungfrau mit dem Christuskind auf dem Schoß und den neben ihr stehenden juwelenbesetzten Reliquienschrein, in dem ein Fetzen von ihrem Gewand ruhte. »Und nehmt alles andere mit.« Er griff nach einem Kerzenleuchter aus vergoldetem Silber und bewunderte die filigranen Verzierungen rund um den Fuß. »Der hier gehört eindeutig uns – mein Vater hat ihn ihnen in dem Jahr meiner Krönung gestiftet. Zusammen mit diesem Kelch.« Er zeigte auf einen goldenen, mit Edelsteinen besetzten Becher.
Mit schmalen Lippen klappte William den Deckel einer in der Nähe stehenden Truhe mit einem vernehmlichen Knall zu; benutzte das Möbelstück als Ventil für seine aufgestaute Furcht und seinen Abscheu. Mit Juwelen bestickte Seidengewänder von unschätzbarem Wert schimmerten in üppigen smaragdgrünen und saphirblauen Falten neben schneeweißem gefälteltem Leinen – Kleidungsstücke, die nur an Feiertagen und Anlässen von hoher religiöser Bedeutung zum Einsatz kamen, jetzt aber als Bündel zum Fortschaffen der Beute missbraucht wurden.
William bellte kurze Befehle, und die Männer begannen, den kostbaren Inhalt des Schreins so hastig in die Gewänder zu stopfen, als würde ihre Eile ihre Tat vor den Augen Gottes verbergen. William leitete sie an und überwachte alles; löste sich innerlich von dem furchtbaren Akt der Entweihung, wohl wissend, dass ihn seine Schuld überwältigen würde, wenn er darüber nachdenken würde, wie groß die Sünde war, die sie hier begingen.
Ancel arbeitete im Hintergrund, schaufelte Edelsteine und Münzen in seine Tasche, während er William mit giftigen Blicken durchbohrte, bis dieser ihn schließlich so hart und kalt anfunkelte, dass sein Bruder die Augen niederschlug und sich abwandte.
Nachdem ihr verdammenswertes Werk beendet war, war der Schrein Unserer Lieben Frau von Rocamadour bis auf die alte, schwarz verfärbte geschnitzte Jungfrau selbst, deren Miene im Licht der auf ihrem kahlen Altar brennenden Schreinlampe undurchdringlich blieb, jeglichen Schmuckes beraubt worden. Schändung – anders konnte man es nicht nennen. Williams Magen krampfte sich zusammen, als er den Männern barsch befahl, zum Tor zurückzukehren.
Sobald er allein war, wandte er sich endlich zu der Statue um, fiel in dem schwachen roten Schein auf die Knie und senkte den Kopf. »Heilige Mutter, ich verspreche dir, dass alles ersetzt wird«, schwor er. »Mein Herr braucht dringend Geld … Ich flehe dich an, erbarme dich, und vergib uns unsere Sünde.«
Im Schrein herrschte Stille. Das Flackern des rubinroten Lichts verstärkte die Schatten und bescherte ihm Visionen von der Hölle, die so weit von der Erlösung entfernt waren wie der Himmel von den Eingeweiden der Erde. Er erhob sich, wandte sich abrupt ab und folgte den Rittern, wobei er sich zwingen musste, nicht in einen Laufschritt zu verfallen.
Die Mönche hatten sich zusammengeschart und verfolgten mit händeringendem Tadel die Plünderung ihres Schreins. Ihr Abt Gerard D’Escorailles war ein alter Mann, jedoch noch immer kräftig genug, unverblümt seine Meinung kundzutun und Worte der Verdammnis als Waffe einzusetzen.
»Mit der Entweihung dieser heiligen Stätte begeht Ihr eine Todsünde, und Gott sieht alles und straft dementsprechend!«, dröhnte seine von Feuer erfüllte Stimme durch den Raum. »Fürchtet um Eure Seele! Eure Königswürde wird Euch nicht vor Gottes Zorn bewahren. Die Schwere Eurer Sünde wird Euch in die Hölle hinabziehen!«
»Aber Ihr könnt es Euch leisten, arme Pilger reichlich zu beschenken«, erwiderte Harry lächelnd. »Ich habe einen Eid geschworen, das Grab Christi in Jerusalem zu besuchen. Ihr werdet mir doch sicher nicht Euren Beitrag zu der Reise verwehren?«
Abt Gerards weißer Bart bebte. »Ihr macht Euch der Blasphemie schuldig! Wollt Ihr das Heilige Grab ebenfalls ausrauben und behaupten, es im Namen Christi zu tun?«
Harry lächelte immer noch, wenn auch jetzt aufgesetzt und spröde. Er hielt Abt Gerard ein versiegeltes Pergament hin, das sein Schreiber vor seinem Aufbruch verfasst hatte. »Hier ist mein feierliches Versprechen, dass ich alles ersetzen werde, was ich mir ausgeliehen habe.«
Der Abt schlug das Schreiben zur Seite. »Ein solches Dokument hat keinen Wert, wenn Ihr Gottes Eigentum stehlt, um Krieg zu finanzieren und mit Euren Höllenhunden in Menschengestalt Elend über rechtschaffene Bürger zu bringen!« Sein Blick schweifte verächtlich über die versammelten Ritter. »Was Ihr stehlt, kann niemals gleichwertig ersetzt werden, weil es überall im Land verstreut werden wird.«
»Ihr habt meinen Eid darauf, dass Ihr entschädigt werdet.« Harrys Züge hatten sich vor Wut verhärtet. »Ich würde ja sagen, fünffach, aber dies wäre Wucher, und wir wissen ja alle, wie sehr die Kirche diese Sünde verteufelt, nicht wahr?«
»Gott lässt seiner nicht spotten«, warnte der Abt mit harter, tonloser Stimme. »Wenn Ihr dieses Gold wiegt, wiegt es gegen Eure sterbliche Seele ab. Ich werde für Euch beten, nur leider vergebens, wie ich fürchte. Ihr seid für die Hölle bestimmt.«
Harry errötete. Er beugte sich vor und schob die Schriftrolle unter die Kordel, die dem alten Mann als Gürtel diente. »Bis zu meiner Rückkehr«, sagte er, machte auf dem Absatz kehrt und rauschte hinaus.
William, der seinem jungen Herrn augenblicklich folgte, spürte die Feindseligkeit der Mönche und Pilger, die sich förmlich in seinen Rücken bohrte, und darüber hinaus fühlte er die schwere Hand Gottes und die Verurteilung der Jungfrau, die seine Seele auf ewig beschämte.
An diesem Abend übertrug Harry William in ihrer Unterkunft die Aufgabe, die Beute unter den Söldnern zu verteilen. William kam ihr mit seiner üblichen Effizienz nach. Seiner ausdruckslosen Miene war nicht zu entnehmen, wie schuldig er sich fühlte. Wie Judas, der Christus verrät.
Nun, da Harry wieder über Geld verfügte, floss der Wein in Strömen, spülte in Kreuzkümmel geschmortes Hühnchen und in Mandelmilch gekochtes Kaninchen hinunter. Ein für Abt Gerards Tafel bestimmtes Ferkel wurde mit Füllung und eingemachten Äpfeln serviert, und alle aßen, bis ihre Bäuche so hart wie straff gespannte Trommeln waren. Die Männer tranken auch entschieden zu viel; versuchten, mit ausgelassener Fröhlichkeit und Völlerei die Erinnerung an das zu unterdrücken, was sie in Rocamadour getan hatten.
Williams Belohnung für seine Rolle bei dem Raub bestand aus einem Beutel Edelsteine – Saphire, Rubine und Bergkristalle, die mit einer Messerspitze aus der Altarvertäfelung des Schreins herausgebrochen worden waren. Der an seiner Hüfte befestigte kleine Lederbeutel fühlte sich wie ein schwerer Sack voller Sünden an, während er seinen Pflichten nachging. Aber nichtsdestotrotz musste er essen, seine Pferde füttern und die Ritter versorgen, die von ihm abhängig waren; als ihr Anführer durfte er sich nicht schwach und zimperlich zeigen.
Unter der angehäuften Beute befand sich auch das Schwert Durendal, das einst dem großen Helden Roland gehört hatte, der zu Tode gekommen war, als er den Pass von Roncesvalles gegen die Sarazenen verteidigt hatte. Jeder kannte diese Geschichte. Ein kunstvolles Muster aus Goldgeflecht zierte das Heft, und der Griff bestand aus überlappenden Streifen rosenfarbenen Leders. Das Schwert war in einen Spalt in der Wand gestoßen und dann an einen in den Fels getriebenen Ring gekettet worden, was aber den Diebstahl nicht verhindert hatte.
»Die Klinge ist so stumpf wie der Verstand eines Bauern.« Harry untersuchte es kritisch. »Seit Jahren nicht mehr geschärft worden. Die Mönche haben keine Ahnung, wie man solche Dinge pflegt. Wahrscheinlich ist es ohnehin nicht das echte Schwert von Roland. Wenn es ihm wirklich gehört hat, sollte es von einem Krieger geführt werden, statt auf einem Altar vor sich hin zu rosten.«
»In der Tat, Sire, aber es ist vielleicht nicht der beste Weg, sich Waffen zu beschaffen.«
Harry sah William mit hochgezogenen Brauen an. »Wittere ich da eine neue Strafpredigt von Euch, Marschall?«
»Ich meine nur, dass wir unsere Ausgaben kürzen sollten«, erwiderte William. »Schreine wie Rocamadour sind rar und liegen weit voneinander entfernt, und sie werden das Geraubte nicht so schnell ersetzen, wie die Männer ihren Sold fordern.«
»Ja, ja.« Harry schwenkte das Schwert, sodass sich das Licht im Heft fing. »Wir sprechen morgen darüber.«
»Sire.«
Da er dringend frische Luft brauchte, ging William ins Freie, um sich zu vergewissern, dass diejenigen, die die kurzen Strohhalme gezogen hatten und somit Wache halten mussten, ihre Posten bezogen hatten und die Pferde für die Nacht versorgt worden waren. Als er sich überzeugt hatte, dass alles in Ordnung war, blieb er bei dem Trog im Stallhof stehen, um sich Wasser ins Gesicht zu spritzen, bevor er leise stöhnte und die Handballen gegen seine Augen presste. Die Ungeheuerlichkeit dessen, was sie getan hatten, glich einem schwarzen Baum, der in seinem Körper wuchs und die Zweige in jeden Winkel seiner Seele ausstreckte. Diese Schande vor Gott würde ihn ewig begleiten. Er ließ die Hände sinken, stützte sie auf die steinernen Ränder des Troges und blickte auf das im Wasser schwimmende verzerrte Spiegelbild des Mondes, während er vor seinem geistigen Auge die Flammen der Hölle durch sein eigenes dunkles, durchsichtiges Ebenbild lodern sah. Schließlich richtete er sich auf, rief sich zur Raison und ging wieder ins Haus.
Harry würfelte gerade, nutzte Münzen aus der Beute als Einsatz und hatte das Schwert quer über seinen Schoß gelegt.
William machte einen Bogen um die Spieler und ging die Treppe zu seiner Kammer hinauf. Der Raum war in Dunkelheit gehüllt, nur ein Strahl des Mondlichtes fiel durch die Fensterläden. Von Ancels Pritsche wehten abgehackte, gequälte Atemzüge herüber. William holte die Laterne aus der Mauernische draußen vor der Kammer, hielt sie über das Bett und sah, dass sein Bruder kniete. Sein Körper bebte vor Schluchzen, und er hatte die Fäuste vor der Brust geballt.
»Ancel?«
Ancel drehte sich um. Sein Gesicht war von einer Angst verzerrt, die an Entsetzen grenzte. »Ich habe geträumt, ich würde bei lebendigem Leibe von Dämonen geschmort«, jammerte er. »Sie haben mir ihre Mistgabeln durch die Eingeweide getrieben und sie um die Zinken gedreht. Und Unsere Liebe Frau von Rocamadour hat zugeschaut und mich für die Tat verflucht, bei der sie mich beobachtet hat.«
Ein eisiger Schauer rann William über den Rücken. »Es war nur ein Albtraum«, sagte er knapp. »Harry wird es wiedergutmachen – es wird alles zurückgezahlt.«
»Du erwartest doch nicht von mir, dass ich das glaube, nun, da alles schon verteilt worden ist? Für diesen Frevel erlangen wir nie Vergebung, das weißt du! Ich hätte niemals von zu Hause weggehen sollen, um dich zu den Turnieren zu begleiten.« Ancel kehrte William den Rücken zu, legte sich wieder hin und rollte sich wie ein Embryo zusammen.
»Ancel …« William öffnete die Hände und ließ sie an den Seiten herabfallen. Sein Bruder verstand nicht, was es bedeutete, einen Kommandantenposten innezuhaben und Entscheidungen zum Wohle aller treffen zu müssen. Ancel liebte den Glanz und den Ruhm und stellte sich gern in prunkvollem Staat zur Schau, hatte aber keine Vorstellung von der Realität, die sich hinter dieser Fassade verbarg. Andere wurden vor schwierige Wahlen gestellt und dann dafür verdammt.
William seufzte, wandte sich ab und kehrte wieder zu seinem Würfelspiel zurück. Harrys Platz auf der Bank war leer.
»Latrine.« Robert of London deutete mit dem Kopf auf eine niedrige Tür. »Zu reichliches Essen nach den Hungerzeiten.« Eine Frau beugte sich vor, um seinen Becher neu zu füllen, woraufhin er ihr mit der Hand über die Hüfte strich und ihr einen Kuss gab.
Harry kehrte einen Moment später zurück, rieb sich den Magen und verzog das Gesicht, nahm aber seinen Platz am Tisch wieder ein. »Setzt Euch, Marschall, und lasst Euch auf ein Spiel ein«, sagte er. »Trinkt einen Schluck Wein.« Er reichte William eine kunstvoll gearbeitete Bergkristallkaraffe aus der Beute des Raubzuges.
William setzte sich neben ihn, schenkte sich Wein ein und wusste, als Harry die Würfel schüttelte und warf, dass jeder Mann, der heute Abend an diesem Tisch saß, verdammt war.
William blieb auf der Schwelle von Harrys Kammer stehen und wappnete sich. Er brauchte die verängstigten Diener erst gar nicht zu fragen, wie sein Herr die Nacht verbracht hatte, weil er die Geräusche und die unterdrückten Schmerzensschreie gehört hatte. Harry war seit einigen Tagen krank, und sein Zustand verschlechterte sich zusehends. Alles, was er zu sich nahm, erbrach er entweder wieder, oder seine Eingeweide entleerten sich schneller, als er die Latrine erreichen konnte. William hatte die Ruhr oft genug gesehen, um die Folgen zu kennen. Einige überlebten sie, viele nicht.
Er hatte den Männern erzählt, dass Harry sich gut erholte, aber die Zweifel und die Ungläubigkeit in ihren Augen waren ihm nicht entgangen, und obwohl er sich in ihrer Gegenwart optimistisch gab, war ihm hinter der Fassade übel vor Furcht.
Als er die Kammer betrat, stieg ihm der Gestank von Erbrochenem und Fäkalien in die Nase, und er kämpfte gegen einen heftigen Brechreiz an, als er einem Diener gegenüberstand, der eine Schüssel mit einer blutigen braunen Flüssigkeit in den Händen hielt.
»Bring das weg«, befahl William mit gepresster Stimme. »Und sorg dafür, dass der König frisches Bettzeug bekommt.«
Der Diener deckte die Schüssel mit einem Tuch ab. »Wir haben die Laken bereits zweimal gewechselt, Messire …«
»Dann wechselt sie noch einmal.«
»Die Wäscherin ist schon gegangen, um saubere zu holen.«
Der Mann entfernte sich, und William trat an das Bett, um sich neben Harry zu setzen. »Wie geht es Euch heute, Sire? Besser, nehme ich an?« Er registrierte erschrocken, wie eingefallen Harrys Züge waren. Jegliche Feuchtigkeit war aus seinem Gesicht gewichen, sodass sich die Haut über den Knochen spannte. Seine Lippen waren ausgedörrt und von den Zähnen zurückgezogen, und in seinem Mund befand sich kein Tropfen Speichel mehr. William spähte über seine Schulter zu Harrys vor Angst blassen Dienern und warf ihnen einen warnenden Blick zu.
Die Waschfrau erschien mit frischem Bettzeug vom Trockenplatz, das nach Sonnenschein roch. Harry musste aus dem Bett gehoben werden, während seine Laken gewechselt wurden. Er war bleich, rang nach Atem und biss die Zähne zusammen, während er auf einem Stuhl kauerte und sich an William festhielt. »Wenn es Dämonen gibt«, keuchte er, »dann haben sie ihre Klauen in meine Eingeweide geschlagen und reißen sie in Fetzen. Ich scheiße mein Lebensblut in eine Resteschüssel.« Ein verzweifelter Blick traf William. »Es liegt an Rocamadour und den anderen Schreinen, das sagen sie doch alle, nicht wahr? Es ist die Strafe für meine Sünden.«
»Sire, niemand sagt etwas Derartiges.«
»Doch, das tun sie, und sie glauben es … Und sie haben recht.« Harry schluckte, was klang wie ein trockenes Klicken. »Mich erwartet die Hölle.«
Auch Williams eigener Mund war strohtrocken. »Nein, Sire … Das glaube ich nicht.«
Harrys Gesicht verzerrte sich. »Ihr glaubt es, und ich glaube es auch. Spendet mir keinen falschen Trost, Marschall, und verratet mich jetzt nicht.« Er packte Williams Ärmel und krallte die Finger hinein, als ihn ein Krampf schüttelte. »Ihr seid mir seit meiner Jugend eine Stütze, und Eure Loyalität ist unerschütterlich.«
»Immer, Sire.« Williams Augen brannten vor Reue und Mitleid. Harrys königliche Eltern hatten ihm das Amt des Beschützers und Mentors ihres ältesten Sohnes anvertraut, und er hatte in jeder Hinsicht versagt. »Und ich werde Euch auch jetzt nicht verlassen.« Andere taten dies bereits – das Ungeziefer, das sich immer am Rand von Armeen herumdrückte, um die Krumen aufzupicken, und das einen untrüglichen Instinkt dafür hatte, wann es weiterziehen musste, ehe die Vorratskammer leer war.
»Ich beabsichtige, alles zurückzugeben, was ich aus den Schreinen von St. Martial und Rocamadour geraubt habe.« Harrys Hand hatte sich wie ein Schraubstock um Williams Arm geschlossen. »Das wisst Ihr.«
»Ja, Sire«, erwiderte William. In gewisser Hinsicht traf das zu, aber Absicht und Umsetzung war bei Harry nicht immer ein und dasselbe.
Das Gesicht des jungen Mannes verzerrte sich erneut, als ein weiterer Krampf einsetzte. »Ihr müsst mir helfen, Wiedergutmachung zu leisten, wenn ich es selber nicht mehr kann.«
William versuchte, sich immer noch wider besseres Wissen einzureden, dass Harry am Leben bleiben würde, und die Worte betäubten ihn, weil sie ihn zwangen, der Wahrheit ins Gesicht zu blicken. »Wenn es in meiner Macht liegt, werde ich es tun, Sire.«
»Marschall, ich will nicht in der Hölle schmoren, was ohne Gebete und Fürbitten sicher der Fall sein wird.« Harry rang nach Luft und bemühte sich weiterzusprechen. William half ihm, ein paar Schlucke mit Wasser versetzten Wein zu trinken. »Ich … ich möchte, dass Ihr nach Jerusalem reist und meinen Umhang in der Grabeskirche auf das Grab Christi legt.«
William starrte ihn an.
»Versprecht es mir …« Harrys in die Höhlen gesunkene Augen füllten sich mit Angst und dem Flehen um Beistand. »Lasst mich jetzt nicht im Stich. Wenn ich Euch je etwas bedeutet habe, dann tut es für mich.«
»Ich verspreche es Euch bereitwillig, Sire«, antwortete William, ohne zu zögern und ohne sich seinen Schock anmerken zu lassen. Er legte seine Hand auf die von Harry, spürte, wie sich die Knochen unter der Haut abzeichneten. »Aber ich hoffe, Ihr werdet diesen Eid selbst in Jerusalem leisten können.«
»Nein«, flüsterte Harry. »Das ist Gottes Strafe für meine Sünden … Es ist das Ende – ich werde dieses Gemach nur noch auf einer Totenbahre verlassen.«
Es war vorüber. Zur zehnten Stunde des zehnten Tages des Junis starb der junge König Henry, ältester Sohn des Königs von England und Herzog der Normandie, umgeben von seinen fassungslosen und verängstigten Rittern unter Qualen auf einem Aschelager auf dem Boden seiner Kammer in Martel. Zum Zeichen, dass er seine Sünden bereute, trug er einen Strick um den Hals und umklammerte mit den Händen ein schlichtes Holzkreuz. Er war erst achtundzwanzig Jahre alt gewesen, sah aber aus wie hundert.
William bückte sich und zog behutsam den großen Saphirring von Harrys Zeigefinger, dann küsste er den Rücken der schlaffen, kalten Hand seines Herrn. Harrys Vater hatte sich geweigert, nach Martel zu kommen, da er fürchtete, die Benachrichtigung wäre eine Kriegslist, die ihn in einen Hinterhalt locken sollte. Aber er hatte den Ring als Unterpfand geschickt und so zumindest bewiesen, dass noch immer ein Band zwischen Vater und Sohn bestand, obwohl das Schmuckstück jetzt mit der Benachrichtigung über die Tragödie zu Henry zurückgebracht werden musste.
Während seiner letzten klaren Momente hatte Harry William erneut gebeten, nach Jerusalem zu reisen und seinen Umhang auf das Heilige Grab zu legen, und William hatte sein Versprechen öffentlich vor den um das Totenbett gescharten weinenden Rittern und Geistlichen wiederholt. Zu Lebzeiten war Harry sein Schutzbefohlener gewesen, und er hatte ihn im Stich gelassen. Ihm oblag nun die noch schwerer wiegende Pflicht, ihn im Tod vor dem Höllenfeuer zu bewahren und, wenn möglich – was William nicht als sicher voraussetzte – für ihre Sünden Buße zu tun und nicht nur Gottes Vergebung, sondern auch die der Heiligen Jungfrau zu erlangen.
Als William sich zurückzog, um vor Tagesanbruch noch eine Stunde Schlaf zu finden, sah er, dass Ancel vor einer brennenden Kerze und einem kleinen hölzernen Kreuz im Gebet versunken war. Sein Bruder war nicht dabei gewesen, als William geschworen hatte, nach Jerusalem zu gehen, weil jemand trotz allem Wache halten musste, und Ancel hatte sich freiwillig dazu erboten.
Ohne sich umzudrehen, sagte Ancel mit rauer Stimme: »All die Dinge, die wir in Rocamadour geraubt haben … Menschen sind dorthin gekommen und haben vor ihnen um Beistand gebetet und Fürbitten gesprochen oder hatten sie aus Dankbarkeit für erhörte Gebete als Spende dort abgelegt. Jetzt sind sie unseretwegen besudelt – all ihre Macht ist dahin. Sie haben unserem jungen Herrn bei seiner Krankheit nichts genutzt … Vielleicht haben sie sogar sein Ende herbeigeführt. Viele werden sagen, dass er bekommen hat, was er verdient.« Er holte zittrig Atem und sah William mit glasigen Augen an. »Und wenn das zutrifft, wie wird dann Gottes Strafe für uns ausfallen? Wir werden alle in der Hölle schmoren, so viel steht fest.«
William ließ sich schwer auf Ancels Matratze sinken und barg den Kopf in den Händen.
»Ich weiß nicht mehr, was die Wahrheit ist«, stieß Ancel abgehackt hervor. »Ich habe zu dir aufgeschaut, weil ich dachte, du wüsstest, was zu tun ist, aber nach Rocamadour habe ich dieses Vertrauen verloren. Jeder Mensch muss sterben, und ich möchte keine ewigen Qualen leiden müssen – aber genau so wird es kommen.«
William hob mit einem erschöpften Seufzen den Kopf. »Du hast recht. Ich werde keine Entschuldigung vorbringen. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass Harry mir seinen Umhang anvertraut hat. Er hat mich gebeten, ihn nach Jerusalem zu bringen und ihn als Buße für seine Sünden auf das Grab Christi zu legen, damit er und somit wir alle um Absolution für das Verbrechen bitten können, das wir aus der Notwendigkeit heraus begangen haben. Ich weiß, dass du nur mit nach Rocamadour geritten bist, weil ich dich dazu gezwungen habe, und ich bin mir meiner Schuld bewusst. Jetzt bitte ich dich, mich nach Jerusalem zu begleiten und für das zu büßen, was wir getan haben. Aber ich würde es verstehen, wenn du dich weigerst.«
Ancels Augen wurden groß, das Weiße schimmerte im Laternenlicht. »Nach Jerusalem?«
»Ja. Zusammen mit Eustace und allen anderen, die die Reise auf sich nehmen wollen. Ich weiß nicht, ob wir unser Ziel erreichen oder überhaupt zurückkommen werden, aber es ist besser, bei dem Versuch zu sterben, als mit der Sünde zu leben.«
Ancels Adamsapfel hüpfte. Und dann rang er nach Luft, barg das Gesicht in den Händen, und ein herzzerreißendes Schluchzen schüttelte seinen Körper.
William legte ihm zaghaft eine Hand auf die Schulter. »Also … Wie entscheidest du dich?«
Ancel drehte sich um und presste den Kopf gegen Williams Brust, und als seine Stimme ihm wieder gehorchte, klang sie tränenerstickt. »Natürlich komme ich mit dir – um nichts in der Welt könntest du mich davon abhalten!«
»Wir werden das begangene Unrecht wiedergutmachen«, schwor William. Auch seine eigene Kehle war vor unterdrückten Emotionen wie zugeschnürt. Dann fügte er mit düsterer Entschlossenheit hinzu: »Und ich werde mein Leben dafür geben, dieses Versprechen zu halten, wenn es sein muss.«
3
Turm von Rouen, Juli 1183
Ancel hielt die Zügel von Williams mächtigem rotbraunem Schlachtross Bezant. »Ich behaupte noch immer, dass du verrückt bist. Warum überlässt du dem König dein bestes Pferd – deine beiden besten Pferde, um genau zu sein?« Er deutete auf Williams zweites Schlachtross, Bezants jüngeren Halbbruder Cuivre, um das sich Eustace kümmerte.
William rang um Geduld. Sie hatten bereits mehrere Male darüber diskutiert, aber wenn Ancel sich einmal eine Meinung gebildet hatte, hielt er unerschütterlich daran fest. »Ich habe dir doch erklärt, warum. Ich will nicht riskieren, die Tiere auf einer langen, anstrengenden Reise einzubüßen, und ich weiß, dass der König nichts anderes im Gegenzug für Geldmittel akzeptieren wird.« Abgesehen davon verspürte William das persönliche Bedürfnis, Buße zu tun und seine Schuld zu sühnen. Seine besten Pferde zu opfern würde dazu beitragen, dass er seine Sünde wieder ausgleichen konnte.
»Die Lords, die vor langer Zeit aufgebrochen sind, um Jerusalem zu befreien, haben ihre Schlachtrösser mitgenommen«, wandte Ancel ein.
»Und sie haben sie unterwegs verloren. Glaubst du wirklich, auch nur ein Mann ist auf dem Pferd in Jerusalem eingetroffen, auf dem er daheim losgeritten ist?«
Ancel öffnete den Mund, um erneut zu widersprechen, aber William zwang ihn mit einem scharfen Blick zum Schweigen und machte sich auf den Weg zu seiner Audienz beim König.
Er hatte mit Henry bereits über den Tod seines Sohnes gesprochen – eine schmerzliche Befragung über sich ergehen lassen, die im königlichen Feldzugszelt im Limousin stattgefunden hatte. Henrys Trauer war tief und aufrichtig gewesen, aber hinter einer Fassade aus eiserner Selbstbeherrschung verborgen geblieben. Nun, da Harry in der Kathedrale von Rouen begraben worden war, war es an der Zeit für eine zweite Audienz. William war von der Aussicht nicht sonderlich angetan, aber darauf vorbereitet und gefasst.
Er wurde in das Gemach des Königs geführt, in dem es von Beamten, Schreibern, Geistlichen, Edelleuten, Dienern und Boten wimmelte – all den vielen kleinen und großen Rädchen, die die Maschinerie des dynamischsten Hofes des Christentums in Betrieb hielten. Der für die Steuerung all dieser Rädchen verantwortliche Mann saß zusammengesunken in seinem mit Kissen gepolsterten Stuhl und umfasste mit einer Hand seinen grau gesprenkelten rötlichen Bart. Sein Gesicht war ausdruckslos, und für einen König, der den geradezu legendären Ruf hatte, keinen Moment zur Ruhe zu kommen, war diese stumpfe, lebensüberdrüssige Haltung erschreckend ungewöhnlich. Allerdings hatte er gestern seinen ältesten Sohn begraben.
William kniete vor Henry nieder und senkte den Kopf. Henry schwieg lange, ließ zu, dass die Stille an Gewicht gewann. Als er endlich das Wort ergriff, haftete seiner Stimme die weiche Sandigkeit gesiebter Asche an. »Ihr kommt also zu mir, und ich muss mich fragen, warum Ihr das tut und warum ich Euch jemals wieder empfangen sollte.«
»Sire, Ihr seid mein Lehnsherr. An wen sollte ich mich sonst wenden?«, gab William zurück.
»So habt Ihr nicht gedacht, als Ihr mir in den Rücken gefallen seid, nicht wahr?« Henry richtete sich auf und beugte sich ein wenig vor, sodass sein Hals ein Stück zwischen seinen Schultern verschwand. »Warum sollte ich Euch an meinem Hof dulden? Warum sollte ich Euch nicht hinauswerfen oder in den Kerker sperren lassen?«
Williams Nackenhaare richteten sich auf. Es wäre für Henry ein Leichtes, ihn zum Sündenbock für seine Trauer zu machen. »Sire, Ihr habt mir den Posten als Marschall Eures Sohnes übertragen, und ich habe mich stets bemüht, dieser Aufgabe nach Kräften gerecht zu werden. Mehr stand nicht in meiner Macht – ich wünschte, es wäre anders.«
Henry verstummte erneut. William warf ihm einen verstohlenen Blick zu und sah, dass der König mit dem Saphirring herumspielte, den Harry auf seinem Sterbelager getragen hatte. Henry betrachtete ihn, zog ihn geistesabwesend von seinem Finger und steckte ihn wieder an.
William holte tief Atem und sprach, bevor das Schweigen undurchdringlich wurde. »Sire, Euer Sohn hat mich in seinen letzten Stunden gebeten, seinen Umhang nach Jerusalem zu bringen, ihn auf das Grab Christi zu legen und in seinem Namen um Vergebung zu bitten, und ich habe geschworen, seinen Wunsch zu erfüllen. Ich beabsichtige, diesen Schwur zu halten, koste es, was es wolle – nichts wird mich davon abhalten, nur mein eigener Tod.«
Henry maß ihn mit einem säuerlichen Blick. »Somit leistet Ihr zumindest etwas, und vielleicht ist es das Beste, wenn Ihr mir einige Zeit lang nicht mehr unter die Augen kommt. Wann wollt Ihr aufbrechen?«
William räusperte sich. »So bald wie möglich – mit denjenigen meiner Männer, die mich begleiten wollen. Aber vorher muss ich nach England reisen, um mich zu verabschieden und die nötigen Geldmittel aufzutreiben.«
Henry erwiderte nichts darauf, und William wusste nicht, ob er auf den Knien verharren oder sich entfernen sollte. Ein weiterer flüchtiger Blick verriet ihm, dass das Kinn des Königs zitterte.
»Seid Ihr deswegen zu mir gekommen?«, krächzte Henry endlich. »Um Geld zu bekommen? Habt Ihr nach dem, was Ihr zusammen mit meinem Sohn getan habt, nicht selbst genug davon? Ha, Ihr überrascht mich, Marschall!«
William nahm den Seitenhieb stumm hin, aber es fühlte sich dennoch an, als würde man ihm mit einem Messer eine frische Wunde aufschlitzen, aus der alle Erinnerungen hervorquollen, all die Scham und bittere Reue dessentwegen, was in Rocamadour geschehen war. Er war bereits gezwungen gewesen, den König zu ersuchen, Harrys Söldnern den ihnen zustehenden Sold auszuzahlen. William hatte ihnen versprochen, dass sie ihr Geld erhalten würden, und Henry hatte sich darum gekümmert und die Schulden seines Sohnes bezahlt, allerdings widerwillig, und er gab William die Schuld dafür.
»Sire, ich habe Euch meine beiden besten Pferde gebracht – ich dachte, Ihr wollt sie vielleicht bis zu meiner Rückkehr bei Euch behalten.«
Henrys Miene wurde scharf, seine Energie kehrte zurück, und er gab sich kurz angebunden und geschäftsmäßig. »Ihr habt sie dabei?«
»Ja, Sire, sie stehen im Hof.«
»Zeigt sie mir. Ich will ja schließlich nicht, dass Ihr mir Schindmähren aufhalst, nicht?«
William überging auch diesen versteckten Seitenhieb. Er hatte in seinem ganzen Leben noch keine Schindmähre besessen. Als königlicher Marschall verstand er mehr von Pferden als jeder andere, den König mit eingeschlossen.
Henry schlang seinen Umhang um sich, und als er sich erhob, rutschte der Saphirring von seinem Finger und rollte klirrend über die Bodenfliesen. Beide Männer starrten ihn an, und wieder trat eine kurze, schreckliche Stille ein, bevor Henry sich abwandte und aus dem Raum rauschte, ohne den Edelstein aufzuheben. William folgte ihm. Eine tiefe Traurigkeit überkam ihn, denn der fallen gelassene Ring betonte für ihn den Umstand, dass der junge König nicht mehr auf dieser Welt weilte und wie endgültig dies war.
Henry stapfte in den Hof, wo die beiden Schlachtrösser aufgezäumt und gestriegelt warteten, mit den Schweifen nach den Fliegen schlugen und die Köpfe hochwarfen. Er musterte den muskulösen Rotfuchs und seinen dunkleren bronzefarbenen Bruder mit einem geschulten Blick. »Wie alt?«, erkundigte er sich.
»Bezant ist sieben und Cuivre sechs«, erwiderte William. Er wusste, dass Henry die Pferde annehmen würde. Er würde sie auf Kosten irgendeines seiner Untertanen einstallen und während Williams Abwesenheit als Deckhengste benutzen. Viele gute Fohlen würden während dieser Zeit gezeugt werden.
Henry untersuchte die Pferde wie ein erfahrener Händler auf dem Smithfield-Tiermarkt, strich mit den Händen über ihre Muskeln und an ihren Beinen hinunter und machte dabei die ganze Zeit ein Gesicht, als würde er minderwertige Ware begutachten. Endlich richtete er sich auf und verkündete sein Urteil. »Um der Liebe willen, die ich meinem verstorbenen Sohn entgegenbringe, werde ich diese Tiere zu mir nehmen und versorgen, während Ihr fort seid, und Euch hundert Pfund für beide bezahlen, damit Ihr Eure Kosten decken könnt. Wenn Gott Euch gnädig ist und Ihr zurückkehrt, dürft Ihr zu mir kommen und sie gegen das Versprechen auslösen, diese Summe zu erstatten.«
Ancel, der neben William stand, hüstelte verstimmt, und William warnte ihn mit einem raschen Rippenstoß. »Sire«, erwiderte er mit einer tiefen Verbeugung, »es ist mir eine Ehre, Euer Angebot dankbar anzunehmen.«
Henry musterte ihn mit einem abschätzenden Blick, wog seine Aufrichtigkeit ab, doch William spürte, dass sie in vertraute Gewässer zurückgekehrt waren, auch wenn die See noch rau war.
»Lasst uns zum Ende kommen«, schlug Henry vor. »Ich werde Briefe aufsetzen lassen, die Ihr zum päpstlichen Hof in Rom und meinem Vetter König Baldwin in Jerusalem mitnehmen könnt.« Mit einem knappen Nicken rieb er sich die Hände, als würde er sie waschen, und verließ den Hof, ohne sich noch einmal umzublicken.
»Ich fasse es nicht, dass du eingewilligt hast, ihm diese Pferde für hundert Pfund zu überlassen«, protestierte Ancel empört. »Sie sind gut und gerne das Doppelte wert!«
»Wäre es dir lieber gewesen, wenn ich mich geweigert oder mit ihm gefeilscht hätte?«, fauchte William. »Sein Sohn ist tot, und ich war für sein Wohlergehen verantwortlich – dafür, dass er am Leben bleibt –, und ich habe versagt. Ich weiß sehr wohl, dass er mir nicht den Preis gezahlt hat, den die Schlachtrösser wert sind, aber mit hundert Pfund kommen wir eine Weile aus, und unsere Pferde werden in der Zwischenzeit gut versorgt. Andere werden uns mit Geld und Vorräten ausstatten, und ich habe im Tempel eine Summe hinterlegt. Wir müssen keine Not leiden – und selbst wenn dem so wäre, würde ich barfuß und nur in meiner Unterhose nach Jerusalem wandern, um diese Mission zu erfüllen.«
Ancel machte ein finsteres Gesicht, sagte aber nichts mehr. William nahm ihm Bezant ab, rieb über die weiße Blesse des Schlachtrosses und fütterte es mit ein paar aus den königlichen Vorratskammern entwendeten getrockneten Datteln. Er hatte unzählige Stunden damit verbracht, das Pferd auszubilden, und zwischen ihnen bestand ein starkes Band aus Vertrauen und Zusammenarbeit, aber er würde auf der Reise sein Leben nicht aufs Spiel setzen. Er verabschiedete sich von Cuivre, bevor er beide Tiere Henrys Stallburschen übergab. Während er zusah, wie die beiden davongeführt wurden, verspürte er tiefen Kummer; denn selbst wenn er zurückkam und sie wieder ritt, würde es nie wieder in dem freudigen Tumult der Turniere sein, die er einst mit seinem jungen Herrn bestritten hatte. Diese Zeit war ein für alle Mal vorbei.
4
Landsitz Caversham, April 1219
Jenseits der friedlichen Stille seiner Krankenstube zogen an einem schönen Frühlingsmorgen flauschige weiße Wolken über den klaren blauen Himmel. Das Licht war so hell, dass es William blendete, und Isabelle, die neben seiner Sänfte herging, rückte sacht die Krempe seines Hutes zurecht, um sein Gesicht in Schatten zu tauchen, bevor sie seine Hand in die ihre nahm. In Jerusalem hatte er in viel grelleres Sonnenlicht geblickt, aber dieser Tage waren seine Augen an die Milde des Schattens gewöhnt.
Für gewöhnlich kamen die Menschen an sein Bett, aber heute hatte er sich wohl genug gefühlt, um der Messe in seiner Kapelle St. Mary beizuwohnen. Seine Ehe mit Isabelle hatte ihm die finanziellen Mittel verschafft, diesen Ort so reich auszuschmücken, wie es der Jungfrau zukam. Er hatte ihr in Rocamadour einen Eid geschworen und ihn hier, in Caversham, gehalten.
Er war gemäß seinem Rang als Earl of Pembroke für die Messe gekleidet; sein ausgezehrter Körper war in eine grüne Tunika und einen pelzgefütterten Umhang mit Goldschnallen gehüllt. An den Fingern trug er Ringe, zum ersten Mal seit Wochen, obwohl Isabelle sie unten mit ihrem Nähgarn hatte umwickeln müssen, weil sie zu groß waren. Sein Arzt hatte es für unklug gehalten, selbst diesen kleinen Ausflug zu unternehmen, aber William hatte seinen Rat missachtet. Er würde nicht wieder gesund. Stürbe er einen Tag früher, wäre wenigstens seine Seele gestärkter.
Er würde das tun, was er immer getan hatte, wenn er sich in Caversham aufhielt, selbst unter extremen Umständen, weil Caversham sein Zuhause war. Der Ort, an dem er immer seinen Gürtel hatte abschnallen, die Füße auf einen Schemel legen und Momente privater Behaglichkeit mit seiner Familie hatte genießen können. Mit einem Kind auf dem Schoß und einem Hund zu seinen Füßen. Isabelle, die ihm über das Kaminfeuer hinweg zulächelte. Isabelle, die in ihrem Bett lag, während eine ihrer blassen Schultern durch das schwere goldene Haar hindurchschimmerte. Dies würde mit das letzte Mal sein, dass er lebend und atmend vor den Altar trat, und er war entschlossen, all seine bemerkenswerte Willenskraft aufzubieten, um es durchzustehen.
Die Ritter trugen William durch die Kapellentüren in das geheiligte Innere, wo sich das Licht änderte. Hier gab es keinen Sonnenschein mehr, sondern nur noch den Schimmer hunderter Bienenwachskerzen, die die juwelenbesetzte Figur der Jungfrau beleuchteten, die mit dem Christuskind auf dem Knie und einer Himmelskrone auf dem Kopf auf ihrem Thron saß. Weihrauchduft erfüllte die Luft, vermischte sich mit dem Kerzendunst und schuf vor ihrem Bild einen goldenen Glanz. William bat stumm um Verzeihung, dass er sich nicht länger vor ihr zu Boden werfen konnte, wie es ihr eigentlich gebührte. Dennoch empfand er eine überwältigende Dankbarkeit dafür, dass er vor ihr Antlitz treten konnte, solange noch ein Atemzug in seinem Körper war. Er würde ihr jetzt mit Gebeten dienen und dann sehr bald im Geiste, wenn der Augenblick kam, in dem er seine sterbliche Hülle verlassen musste.
5
Templerkirche, Holborn, Juli 1183
In London regnete es – ein Sommerguss, der die Oberfläche der Themse mit kleinen Wellen versah und dem Wasser die Schattierung eines stumpfen Schwertes verlieh. William hatte mit seinem kleinen Gefolge die Brücke von der Southwark-Seite überquert, woraufhin sie augenblicklich von den durchdringenden Gerüchen der nassen Stadt eingehüllt worden waren, einem so starken, komplexen Parfüm, anziehend und abstoßend zugleich, dass sich ihre Nackenhaare aufstellten. Kot und Exkremente, der brackige, modrige Geruch des Flussufers bei Ebbe. Rauch von Kochfeuern, Ausdünstungen von Menschen, nassem Holz und Stein. Als sie vom Fluss in das Fleischerviertel einbogen, schlug ihnen der blutige Aasgestank faulenden Fleisches entgegen; aber es war zum Glück nicht so übel riechend, wie es bei voller Tageshitze der Fall gewesen wäre. Der Regen hielt auch die Fliegen fern.
Der aus dem überquellenden Rinnstein fließende Unrat spritzte unter den Hufen ihrer Pferde auf, bis sie endlich nach Ludgate kamen und in die Vororte hinter den Stadtmauern ritten, wo es nach durchweichten grünen Gärten roch. Die Gebäude drängten sich nicht länger wie raufende Trunkenbolde aneinander, sondern waren geräumig und zeugten von Wohlstand. Von gelegentlichen Blicken abgesehen schenkte William seiner Umgebung kaum Beachtung, sondern hielt den Kopf gesenkt und behielt seine Gedanken für sich. Da er seine Bürde mit niemandem aus seinem Gefolge teilen konnte, war sie von Tag zu Tag schwerer geworden. Er wurde nicht von Albträumen gepeinigt wie Ancel – wozu auch, wenn er jeden wachen Moment damit lebte? Er kannte nur einen einzigen Menschen, der ihm vielleicht helfen konnte, aber ob er dies auch wollen würde, wenn er die ganze Geschichte gehört hatte, war eine andere Frage.
Endlich erreichten sie Holborn und bogen durch einen offenen Torweg, der von zwei Sergeanten in dunklen Gewändern bewacht wurde, in einen Hof ein, hinter dem Ställe und ein Gewirr aus Holz- und Steingebäuden lagen. Der bauchige Rundbau der Kirche der Tempelritter war gerade eben sichtbar.
»Wartet hier«, befahl William seinem Gefolge und deutete dabei auf einen an den Seiten offenen Unterstand an einer Wand. Ancel machte Anstalten, ihm zu folgen, aber William wies ihn an, bei den anderen zu bleiben und das Kommando zu übernehmen. »Ich muss allein mit Aimery sprechen.«