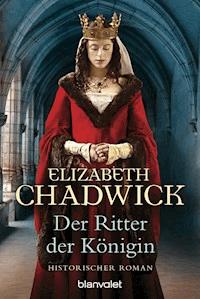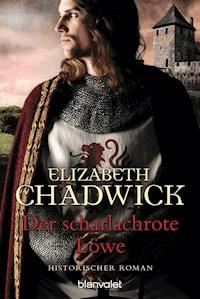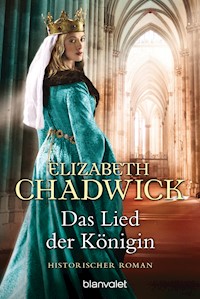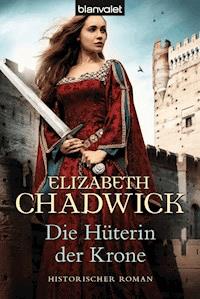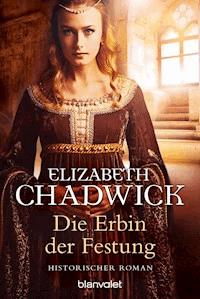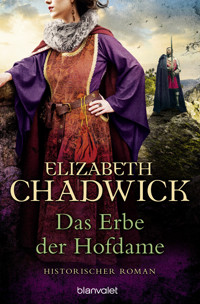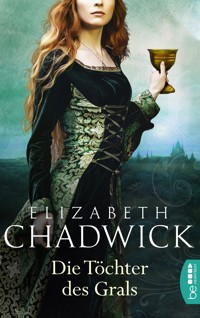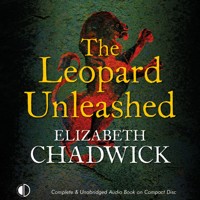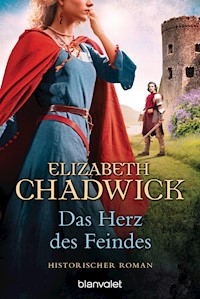Inhaltsverzeichnis
Buch
Autorin
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Copyright
Buch
Nach seinem glorreichen Sieg über König Harold bei Hastings wird Wilhelm der Eroberer bei seiner Rückkehr in die Normandie von den jubelnden Volksmassen empfangen. Damit in den neu eroberten Gebieten keine Aufstände aufflammen, hat er ein paar englische Edelleute als Geiseln mitgebracht. Sie unterwerfen sich dem neuen Herrn nur widerwillig. Doch einer von ihnen, Waltheof von Huntingdon, strebt nicht nach Rebellion - er hat anderes im Sinn. Als er Judith, die Nichte des normannischen Königs, das erste Mal sieht, weiß er, dass sie die Frau seines Herzens ist. Und als er ihr das Leben rettet, wird klar, dass die Anziehung gegenseitig ist. Doch Ehe und Liebe haben nicht viel miteinander gemein im mittelalterlichen Europa. Wilhelm widersetzt sich einer Eheschließung der beiden Liebenden. Und Waltheof rächt sich, indem er sich einer Verschwörung anschließt. Wilhelm gelingt es, den Aufstand niederzuschlagen, und nun ist er bereit, die Hochzeit zuzulassen - denn als Verwandter muss Waltheof ihm in Zukunft die Treue halten. Doch die Verbindung zwischen dem angelsächsischen Earl und der normannischen Comtesse ist großen Zerreißproben ausgesetzt. Während ihre Kinder heranwachsen, müssen sich die beiden Eheleute immer wieder entscheiden: zwischen ihrer Liebe und der Verpflichtung gegenüber ihren Herkunftsgeschlechtern …
Autorin
Elizabeth Chadwick lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in Nottingham. Sie hat inzwischen zwölf historische Romane geschrieben, deren Handlung stets im höfischen Mittelalter angesiedelt sind. Vieles von ihrem Wissen über diese Epoche resultiert aus ihren Recherchen als Mitglied von Regia Anglorum, einer renommierten historischen Vereinigung, die das Leben und Wirken der Menschen im frühen Mittelalter nachstellt und so Geschichte lebendig werden lässt. Die Autorin wurde mit dem Betty Task Award ausgezeichnet.
Von Elizabeth Chadwick bereits erschienen:
Die Erbin der Festung (36346) · Die Braut des Ritters (36345) · Der Falke von Montabard (36777) · Der Ritter der Königin (36903)
Die englische Originalausgabe erschien 2002 unter dem Titel »The Winter Mantle« bei Little, Brown & Co., London
1
Festung von Rouen, Normandie, Fastenzeit 1067
»Wie die Engländer wohl sind?«, fragte Sybille nachdenklich, während sie das Band am bestickten Leinenunterhemd ihrer Herrin schnürte.
»Sie haben mehr Haare und Bart als eine Herde wilder Ziegenböcke, wenn man nach denen urteilt, die wir bisher getroffen haben«, entgegnete Judith geringschätzig ihrer Magd. Als Nichte des Herzogs Wilhelm der Normandie, nun König von England, war sie sich ihres Ranges nur ach zu bewusst. »Bei unseren Männern sieht man wenigstens sofort, was sich in ihnen verbirgt, und man kann die Läuse leichter in Schach halten.« Sie warf einen Blick zum Fenster, wo der Jubel der Menge durch die offenen Läden wehte wie ein Sommerwind durch die Blätter eines Baumes. Am Fuße der hoch aufragenden Festungsmauern drängte sich die gesamte Einwohnerschaft von Rouen in den Straßen. Keiner wollte die triumphale Rückkehr des Herzogs verpassen, der in England den Thronräuber Harold Godwinsson bezwungen hatte.
Das Interesse ihrer Magd an den Engländern - und ihr eigenes, um die Wahrheit zu bekennen - rührte daher, dass ihr Onkel Wilhelm nicht nur schwer beladen mit angelsächsischer Beute in sein Herzogtum zurückkehrte, sondern auch in Begleitung hochgeborener Geiseln - englische Lords, denen er nicht traute und sie deshalb nicht aus den Augen lassen wollte.
»Aber es ist schön, einem Mann mit den Fingern durch den Bart zu fahren, findet Ihr nicht auch?«, fuhr Sybille mit funkelnden Augen fort. »Ganz besonders, wenn er jung ist und gut aussieht.«
Judith zog missbilligend die Stirn in Falten. »Nicht dass ich wüsste«, antwortete sie abschätzig.
Nicht im Geringsten eingeschüchtert warf die Magd übermütig den Kopf in den Nacken. »Dann habt Ihr ja nun Gelegenheit, es herauszufinden.« Sie holte das Kleid aus blutrotem Tuch, das Judith so gut stand, aus der Truhe, wo es zwischen Schichten getrockneter Rosenblüten und Zimtrinden aufbewahrt war, und half ihr hinein.
Judith ließ voller Wohlgefallen die Handflächen über das prächtige, weiche Tuch gleiten. Aus den Augenwinkeln verfolgte sie, wie sich ihre Mutter an ihrer Schwester Adelaide zu schaffen machte und an ihr zupfte und zerrte, um jede Kleiderfalte einzeln in Form zu bringen.
»Gott behüte, dass auch nur ein Haar nicht an seinem Ort ist«, murmelte Sybille und bekreuzigte sich zum Spaß.
Als ihre Mutter auf sie zukam, stieß Judith einen Seufzer aus. Sybille machte einen sittsamen Knicks vor der älteren Frau und vertiefte sich mit Eifer darin, Judiths Haar zu zwei festen, glänzenden Zöpfen zu flechten. Dann legte sie ihr einen seidenen Schleier um, der von Nadeln aus geschmiedetem Gold gehalten wurde.
Adelaide, Gräfin von Aumale, begutachtete das Werk der Magd mit Augen so hart und schneidend wie Scherben braunen Glases. »Das genügt«, sagte sie barsch zu Judith. »Wo ist dein Umhang?«
»Hier, Mutter.« Judith nahm das Gewand von ihrem Kleiderständer. Das dunkelgrüne Tuch war mit Biberpelz gefüttert und mit Zobel eingefasst, wie es ihrem Rang gebührte. Adelaide beugte sich vor, um die mit Granaten besetzte goldene Schließe zurechtzurücken und zupfte einen nicht vorhandenen Fussel von dem angerauten Gewebe.
Judith widerstand dem Drang, die Hand ihrer Mutter abzuwehren, doch Adelaide hatte es wohl gespürt, denn sie warf ihrer Tochter einen frostigen Blick zu. »Wir sind Frauen aus dem herzoglichen Haus«, sagte sie. »Und es steht uns an, das zu zeigen.«
»Das weiß ich, Mutter.« Judith war klug genug, ihre Gereiztheit nicht zu zeigen, doch hinter ihrer pflichtbewussten Fassade kochte sie vor Wut. Sie war mit fünfzehn Jahren im heiratsfähigen Alter, besaß die Rundungen einer Frau und bekam ihre monatlichen Blutungen, doch noch immer behandelte ihre Mutter sie wie ein Kind.
»Dann ist es ja gut.« Adelaide sah einschüchternd über ihre lange, spitze Nase hinab. Mit einem Nicken, das an ihre Töchter gerichtet war, rauschte sie davon, um sich den anderen Frauen aus dem Gefolge von Herzogin Matilda anzuschließen, die sich bereitmachten, sich zu der Menge zu begeben und ihre heimkehrenden Männer zu begrüßen. Adelaides Gemahl befand sich allerdings nicht unter ihnen. Er gehörte jener normannischen Streitkraft an, die zurückgeblieben war, um die Interessen des neuen Königs in England während seiner Abwesenheit zu wahren. Judith konnte sich vorstellen, dass ihre Mutter darüber nicht gerade unglücklich, vielleicht sogar erleichtert war. Ihr selbst war es egal. Er war ihr Stiefvater, und sie kannte ihn kaum, denn auch als er noch zu Hause gewesen war, hatte er selten die Frauen in ihren Gemächern besucht und sich lieber im großen Saal und bei den Wachleuten aufgehalten.
Ein stürmischer Märzwind fegte über den Burghof, fuhr respektlos in die Schleier und machte die peinlich genauen Vorbereitungen wie zum Hohn zunichte. Leuchtende Seidenbanner knallten wie Peitschen gegen die Turmzinnen, und darüber flogen die Wolken so schnell über den blauen Himmel, dass Judith vom Zusehen ganz schwindlig wurde.
Während sie im Windschatten einer Mauer Schutz suchte, fragte sie sich, wie lange es wohl noch dauern würde. Ihre Vettern Richard, Robert und Wilhelm, die Söhne des Herzogs, waren losgeritten, um ihren Vater in der Stadt zu empfangen. Nur zu gerne wäre sie mit ihnen gekommen, doch das hätte sich nicht geschickt, und die Form zu wahren stand, wie ihre Mutter sagte, für ein wichtiges Mitglied des höchsten Hauses im Lande an allererster Stelle.
Die Rufe der Menge hatten sich zu einem regelrechten Beifallssturm gesteigert. Judiths Herz schwoll vor Stolz an. Das war ihr Geschlecht, dem sie zujubelten, ihr Onkel, der nun durch Gottes Gnaden und seine eigene Entschlossenheit König geworden war.
Unter den Fanfarenstößen der Trompeten erreichten die ersten Reiter des Zuges den Burghof. Ihre Helme und Kettenhemden blitzten in der Sonne auf, Seidenfähnchen flatterten an den polierten Heften ihrer Lanzen. Unter den wogenden Farben des päpstlichen Banners kam ihr Onkel Wilhelm auf einem spanischen Hengst geritten, dessen Fell tiefschwarz glänzte. Er trug keine Rüstung, und seine mächtige Gestalt erstrahlte in einem karmesinroten Wollumhang, der von Goldstickereien überzogen war. Der Wind wehte ihm das dunkle Haar in die Stirn, und dass er die Augen zum Schutz vor dem Wind zusammenkniff, unterstrich noch das Adlerhafte seines Gesichts. Ein Knappe rannte los, um ihm die Zügel abzunehmen. Wilhelm sprang sicher vom Pferd und wandte sich dann den wartenden Frauen zu.
Herzogin Matilda eilte vor und sank in einem tiefen Knicks vor ihm nieder. Adelaide zog ermahnend an Judiths Umhang, woraufhin diese ebenfalls ihr Knie auf den harten Boden beugte.
Wilhelm streckte die Hand aus, zog seine Frau hoch und murmelte etwas, das Judith nicht verstand, das aber die zierliche Herzogin zum Erröten brachte. Er küsste seine Töchter Agatha, Constance, Cecilia und Adela und gab dann den anderen Frauen des Hauses das Zeichen, sich zu erheben. Seine Augen musterten sie der Reihe nach und ließen in ihrer Tiefe ein Lächeln erahnen, doch sein Mund blieb aus lange währender Gewohnheit und strenger Selbstbeherrschung ernst und geschlossen.
Der Burghof füllte sich zunehmend mit Wilhelms Gefolgschaft, die hinter ihm hereingeritten kam. Flankiert von Wachen trafen die englischen »Gäste« ein. Bärte und langes Haar, stellte Judith fest. Was sie zu Sybille gesagt hatte, stimmte also. Sie ähnelten tatsächlich einer Herde wilder Ziegenböcke, allerdings musste sie auch zugeben, dass die Stickereien auf ihren Gewändern die erlesensten waren, die sie jemals gesehen hatte.
Ein prächtig gekleideter Geistlicher, den Judith an dem reich verzierten Kreuz auf seinem Stab als Erzbischof erkannte, sprach mit zwei jungen Männern, die nach der Ähnlichkeit ihrer Gesichtszüge zu urteilen Brüder sein mussten. Auf einem gescheckten, gedrungenen Pferd saß ein strohblonder Junge mit feinen Zügen, der etwas verdrießlich dreinblickte. Er musste von sehr vornehmer Abstammung sein, weil er einen Rock in jenem seltenen Purpurrot trug, das dem Königshaus vorbehalten war, und eine Kappe mit einem Besatz aus Hermelinfell. Sie musterte ihn, bis ihr die Sicht von einem mächtigen kastanienbraunen Hengst verstellt wurde, auf dem ein junger Mann saß, der in Größe und Kraft seinem Pferd beinahe gleichkam.
Er hatte auf Kappe und Kapuze verzichtet, und der Wind wehte ihm das kupferblonde Haar ins Gesicht. Sein Bart, der die Konturen eines freundlichen Mundes und eines ausgeprägten Unterkiefers nachzeichnete, schimmerte rotgolden und ließ sie Sybilles freche Bemerkung in ganz neuem Licht betrachten. Wie würde er sich wohl anfühlen? Weich wie Seide oder kratzig wie Besenreisig? Die Vorstellung faszinierte und verwirrte sie gleichermaßen. Der Mann trug seine kostbare Kleidung mit einer Achtlosigkeit und Selbstverständlichkeit, die sie für verwerflich hätte halten müssen, doch stattdessen empfand sie Bewunderung und einen Anflug von Neid. Wer war er?
Im selben Augenblick, in dem sie sich die Frage stellte, entschied Judith, dass sie es gar nicht wissen wollte. Es reichte, dass er zu den Geiseln ihres Onkels gehörte. Darüber hinaus Spekulationen anzustellen wäre viel zu gefährlich. Sie senkte den Blick, und so entging ihr der flüchtige bewundernde Blick, den er in ihre Richtung sandte.
Mit einer graziösen Drehung folgte sie ihrer Mutter und Schwester zurück in die Sicherheit der großen Steinfestung und sah sich nicht einmal mehr um.
Sein Name war Waltheof Siwardsson, Earl von Huntingdon und Northampton. Dass er seine Ländereien und seinen Titel behalten durfte, verdankte er dem Umstand, dass er auf dem Schlachtfeld von Hastings nicht gegen Wilhelm gekämpft hatte. Das hieß jedoch nicht, dass der neue normannische König ihm oder seinen Gefährten traute.
»Wilhelm mag uns als seine Gäste bezeichnen, doch ändert das nichts daran, dass wir seine Gefangenen sind«, erklärte Prinz Edgar Ataheling, Abkömmling einer alten angelsächsischen Linie. Ein erboster Blick zuckte über seine feinen, beinahe femininen Züge. »Unser Käfig mag ja aus Gold sein, aber es ist und bleibt ein Käfig.«
Die englischen »Gäste« wurden in dem holzgetäfelten Saal versammelt, der ihnen für die Zeit ihres Aufenthalts in Rouen zugewiesen worden war. Auch wenn die Tore nicht bewacht waren, bestand bei keinem von ihnen der geringste Zweifel, dass der Versuch, sich davonzumachen und nach England einzuschiffen, vereitelt wurde und aller Wahrscheinlichkeit nach aufgespießt auf einer Lanze endete.
Waltheof zuckte mit den Achseln und füllte seinen Becher mit Wein aus dem bereitgestellten Krug. Sie mochten sich in Gefangenschaft befinden, doch immerhin wurden sie bestens versorgt. »Wir können es nicht ändern, also sollten wir es uns wenigstens gut gehen lassen.« Er nahm einen kräftigen Schluck. Er hatte eine Weile gebraucht, sich an den Geschmack von Wein zu gewöhnen, nachdem er bislang nur Met und Bier getrunken hatte, doch inzwischen mochte er es, wenn sich der Geschmack der herben Säure und der Gerbstoffe in seiner Kehle entfaltete. Er verstand Edgars Missmut. In England vertraten viele die Meinung, der junge Mann sei der rechtmäßige König. Er hatte mehr Anspruch auf den Thron als Harold Godwinsson oder Wilhelm, doch er war erst fünfzehn Jahre alt und daher eher eine Symbolfigur, um die man Männer scharen konnte, als dass er durch seine eigenen Kräfte und Fähigkeiten eine Bedrohung darstellte.
»Das nennst du gut gehen lassen, mit diesem Fusel?« Edgars hellblaue Augen waren voller Verachtung.
»Du musst dich nur daran gewöhnen«, sagte Waltheof und erntete dafür ein abfälliges Schnauben.
»Glaubst du zu erreichen, was du willst, indem du Geschmack an allem Normannischen findest?« Die Frage kam von Morcar, Graf von Northumberland. Er schlug einen feindseligen Ton an, die Arme herausfordernd vor der Brust verschränkt. Neben ihm stand sein älterer Bruder Edwin, Graf von Mercia, der wie üblich zuhörte, ohne sich einzumischen. Das Bündnis mit Harold waren sie nur halbherzig eingegangen, und ebenso hielten sie es mit der Anerkennung von Wilhelm dem Bastard als ihren König.
Waltheof fuhr sich mit der freien Hand durch das feste rotgoldene Haar und hob mit der anderen den Kelch. »Ein Ja scheint mir allemal besser, als immer nur nein zu sagen.« Er erwiderte Morcars starren Blick und schritt dann durch den Saal, um durch das Fenster in die aufziehende Dämmerung zu sehen. In den Gemächern und Innenhöfen der herzoglichen Anlage wurden Fackeln entzündet. Der wunderbare Geruch frisch gekochten Essens drang in seine Nase und sein Magen zog sich zusammen. Es wäre zu einfach, sich mit Morcar anzulegen, also hielt er sich zurück. Er wusste, dass Unstimmigkeiten in ihren Reihen den Normannen nur zum Vorteil gereichten und diese sie nur zu gerne im Streit sähen.
»Sei auf der Hut«, merkte Morcar leise an. »Eines Tages könntest du ja zu etwas sagen, das dir nur Schaden einbringen wird.«
Waltheof ballte die Hände zu Fäusten. Er spürte Zornesröte in seinem Gesicht aufsteigen, zwang sich jedoch, sich zurückzuhalten. »Eines Tages vielleicht«, erwiderte er, um die Spannung aufzulösen, »aber nicht heute.« Entschlossen wandte er sich dem Krug zu, füllte den Kelch erneut, und nahm einen tiefen Schluck von dem dunklen normannischen Wein. Aus Erfahrung wusste er, dass sich nach vier Bechern allmählich ein angenehmer Schleier über ihn legte. Zehn Becher und aus dem Schleier wurde Benommenheit. Fünfzehn führten zum Vergessen. Den Normannen missfielen die Trinkgewohnheiten der Engländer, und König Wilhelm war ausgesprochen enthaltsam. Waltheof hatte sich zurückgehalten, um sich verächtliche Blicke zu ersparen, aber das Verlangen war geblieben - vor allem, wenn Morcar in der Nähe war.
Waltheofs Vater, Siward der Starke, war einst Herr über die große Grafschaft Northumbria gewesen, doch er starb, als Waltheof noch ein kleiner Junge war, und eine Grafschaft mit so gefährdeten Grenzen musste von einem erwachsenen Mann gelenkt werden. Zunächst hatte Tosti Godwinsson die Herrschaft übernommen, er war jedoch beim Volk so unbeliebt, dass es sich schließlich gegen ihn auflehnte. Ihm folgte Morcar von Mercia, nachdem man Waltheof mit neunzehn Jahren immer noch für zu jung und unerfahren gehalten hatte, um ihm die Verantwortung über ein so riesiges Gebiet zu übertragen. Zwei Jahre waren seither vergangen, und Waltheof war entschlossen, Anspruch auf seine Ländereien zu erheben und Morcar zu verdrängen - und das wusste dieser.
In der Mitte des Raumes saßen Erzbischof Stigand und Wulfnoth Godwinsson. Letzterer war der Bruder König Harolds und war schon einmal viele Jahre als Geisel in der Normandie festgesetzt worden. Er war als Jüngling im selben Alter wie nun Edgar in Gefangenschaft geraten und inzwischen zum jungen Mann mit dichtem rotem Bart und traurigen grauen Augen herangereift. Still und anspruchslos hatte er sich wie der unauffällige Schatten seiner umtriebigen Brüder Leofwin, Gyrth und Harold bewegt, die auf dem Schlachtfeld von Hastings unter den Schwertern der Normannen gefallen waren. Zum Aufstand war er ungefähr so befähigt wie ein Beinloser zu einem Wettlauf.
Waltheof leerte seinen Becher bis auf den letzten Tropfen und goss sich in Gedanken versunken gerade nach, als es an der Tür klopfte. Da er unmittelbar daneben saß, schob er den Riegel auf. Sein Blick wanderte nach unten auf den schlanken, etwa neun oder zehn Jahre alten Knaben. Bernsteinfarbene Augen spitzten unter sonnengebleichtem braunem Haar hervor, das im Nacken hochgeschoren war. Er trug eine Tunika aus edlem blauem Tuch mit erlesenen Stickereien, die darauf hinwiesen, dass der Sprössling einen hohen Rang bekleidete. Möglicherweise war er ein Knappe im ersten Jahr seiner Lehrzeit, in dem Botendienste zu den täglichen Aufgaben gehörten.
Waltheof zog die Brauen hoch. »Ja, Kind?«, fragte er und kam sich auf einmal ganz alt vor.
»Mylords, gleich wird zum Essen geblasen, und es wird um eure Anwesenheit im Saal ersucht«, verkündete der Knabe selbstsicher. Sein Blick wanderte an Waltheof vorbei, um mit unverhohlener Neugier die anderen Anwesenden in Augenschein zu nehmen. Waltheof konnte fast sehen, wie er jede Einzelheit in sich aufsaugte und in seinem Gehirn speicherte, um später seinen Gefährten davon zu berichten.
»Und wir müssen ›König Wilhelm‹ stets zu Diensten sein, nicht wahr?«, höhnte Edgar Atheling auf Englisch. »Selbst wenn er ein Kind, das noch in Windeln steckt, nach uns schickt.«
Der Junge machte ein verwirrtes Gesicht. Waltheof legte ihm eine Hand auf die Schulter und lächelte ihn beruhigend an. »Wie heißt du, Knabe?«, fragte er auf Französisch.
»Simon de Senlis, Mylord.«
»Er ist mein Sohn.« Wilhelms Seneschall Richard de Rules kam etwas außer Atem hinzu. »Ich sagte ihm, was auszurichten sei, und er rannte mir davon wie ein von der Leine gelassener Jagdhund!«
»Wir geben wohl eine gute Beute ab«, merkte Edgar nun ebenfalls auf Französisch an.
De Rules schüttelte den Kopf und sah ihn entschuldigend an. »Das wollte ich damit nicht sagen, Mylord. Mein Sohn mag ungestüm wie ein Jagdhund sein, doch was ihn treibt, ist seine Leidenschaft, nicht der Wunsch, geschätzte Gäste wie Beute zu behandeln.«
Waltheof bewunderte die Art, wie de Rules mit Worten umzugehen wusste - elegant, aber ohne sich anzubiedern. Der Normanne hatte ein offenes, ehrliches Gesicht mit Lachfalten um die grauen Augen und dasselbe sonnengebleichte Haar wie sein Sohn.
»Ach, dann besitzt er wohl wie die meisten eures Schlages eine Leidenschaft für alles Englische?«, meinte Morcar spöttisch.
De Rules behielt seinen höflichen Ausdruck bei, doch die Wärme war aus seinen Augen verschwunden. »Wenn Mylords bereit sind, werde ich Sie nun zum Saal begleiten«, sagte er kühl und unverbindlich.
Waltheof räusperte sich und versuchte, die Stimmung durch ein Lächeln und einen Scherz wieder aufzuhellen. »Und ob ich bereit bin«, ließ er verlauten. »Ich bin so hungrig, dass ich einen ganzen Bären verschlingen könnte.« Mit einem Schwung warf er sich seinen Umhang um die Schultern. Er war aus dickem blauem Tuch gefertigt und mit einem schimmernden weißen Pelz gefüttert. Er winkte dem Jungen zu, der mit weit aufgerissenen Augen vor ihm stand. »Das ist das, was von dem letzten Bären übrig geblieben ist, der mir über den Weg lief.«
»Du hast doch in deinem ganzen Leben noch keinen Bären gesehen, und wenn, dann war es bestenfalls ein zahmer, der in Ketten dahertorkelte!«, höhnte Morcar übel gelaunt.
»Das zeigt mal wieder, wie gut du mich kennst«, gab Waltheof zurück und ließ schnell den Blick über die Gruppe englischer Adeliger wandern. »Ich jedenfalls gehe nun zum Abendessen in den Saal hinunter, denn Stolz allein wird meine Knochen nicht stärken, außerdem wäre es ungehobelt, der Einladung unserer normannischen Gastgeber nicht zu folgen.« Und auch dumm, doch das musste er nicht unbedingt sagen. Mochten sie sich auch noch so sehr über ihre Gefangenschaft beklagen, so wagten sie doch nicht, sich offen aufzulehnen, solange sie sich als Geiseln in der Normandie befanden.
Auf dem Weg in den großen Saal hielt sich der Junge neben Waltheof und strich zaghaft über den weißen Pelz, mit dem der blaue Umhang gefüttert war. »Ist das wirklich ein Bärenfell?«, erkundigte er sich.
Waltheof nickte. »Ja, das ist es, Junge, aber eines, wie du es auf keinem Jahrmarkt zu sehen bekommen wirst. Solche Tiere leben im eisigen Nordland, wo nie ein Mensch hingelangt.«
Simon sah ihn ernst und fragend an. »Wie seid Ihr dann daran gekommen?«
»Morcar hat Recht«, sagte Waltheof grinsend und blickte dabei über die Schulter zu dem mürrisch dreinschauenden Earl von Northumberland. »Ich habe noch nie andere Bären zu Gesicht bekommen als die räudigen Kreaturen, die auf Jahrmärkten die Leute belustigen. Doch als mein Vater jung war, suchte er das Abenteuer, und er erlegte den großen Bären, der einmal in diesem Fell gesteckt hatte. Er war doppelt so groß wie ein Mann, hatte Zähne wie Trinkhörner, und sein Brüllen fegte den Schnee von den Bergkuppen.« Waltheof breitete die Arme aus, um seine Schilderung anschaulicher zu gestalten, und das Fell schimmerte, als würde noch etwas von dem einstigen Leben der wilden Kreatur darin stecken. »Er ließ einen Umhang daraus arbeiten, und so gelangte es schließlich zu mir.«
Der Junge beäugte den Umhang mit Erstaunen und einem Anflug von Neid. Waltheof lachte und zerzauste dem Kind das Haar, eine Geste, die etwas Ausgelassenes, Vertrautes hatte.
Der normannische Adel war in seinem besten Staat erschienen, um die Heimkehr des Herzogs zu feiern, und nun drängte man sich um die langen Tafeln, die im großen Saal gedeckt worden waren. Die englischen Gefangenen wurden an einer Seite der erhöhten Tafel platziert, an der Wilhelms Familie sowie die Bischöfe von Rouen, Fécamp und Jumièges Platz genommen hatten. Ein in der Sonne gebleichtes leinenes Tuch, das üppig mit englischer Stickerei verziert war, bedeckte den Tisch. Darauf standen Trinkgefäße aus dem Horn der wilden weißen Rinder, die durch die großen Wälder von Northumbria streiften. Ihre Ränder und Spitzen waren kunstvoll in Silber und Gold gefasst. Kelche, Krüge und reich verzierte Kandelaber glänzten im Schein des Feuers wie der funkelnde Schatz eines Drachen. Das alles war Kriegsbeute, geplündert bei den Gefolgsleuten und Rittern, die auf dem Schlachtfeld von Hastings gefallen waren.
Waltheof fühlte sich inmitten dieser Zeugnisse der Eroberung unbehaglich, doch er war nüchtern genug, um zu wissen, dass es sich hier um eine Triumphfeier handelte und derlei Zurschaustellung geboten war. Er und seine Gefährten befanden sich hier, weil sie besiegt worden waren, und machten selbst einen Teil der Beute aus. Er vermutete, dass sie sogar über die Einschränkungen froh sein konnten, die König Wilhelm ihnen auferlegt hatte. In den Überlieferungen von Waltheofs Vorfahren hieß es, dass sie auf ihre Siege mit den Hirnschalen ihrer niedergemetzelten Widersacher anstießen.
Waltheof hatte einen Sinn für Sprachen. Sein Französisch war gut und nur von einem leichten Akzent gefärbt, und Latein ging ihm so fließend von den Lippen wie seine Muttersprache, da er in seiner Kindheit in der Abtei Crowland im Fenland unterrichtet worden war. Bald unterhielt er sich angeregt mit den normannischen Prälaten, die beide erstaunt waren, mit welcher Leichtigkeit er sich in der Sprache der Kirche verständigte.
»Man hatte mich einmal für das Priesteramt vorgesehen«, erklärte Waltheof dem Erzbischof von Rouen. »Ich verbrachte mehrere Jahre als Oblate in der Abtei Crowland und wurde dort von Abt Ulfcytel unterwiesen.«
»Ihr hättet einen eindrucksvollen Mönch abgegeben«, bemerkte der Erzbischof, während er von einer Gans den fetten Flügel abriss und sich mit einer Leinenserviette die Finger abwischte.
Waltheof warf den Kopf in den Nacken und lachte. »Ja, das hätte ich!« Er straffte die Schultern. Es befanden sich tatsächlich nur wenige Leute im Saal, die es an Größe oder Statur mit ihm aufnehmen konnten, und ganz gewiss keiner auf dem Podium, wo selbst der große und stämmige Herzog Wilhelm klein gegen ihn wirkte. »Vermutlich sind sie heute froh, dass sie nicht die Mengen Wollstoffes auftreiben mussten, die sie gebraucht hätten, um mir eine Kutte zu schneidern!« Während er redete, trafen seine Augen zufällig jene eines Mädchens, das zwischen den anderen Frauen aus Wilhelms Haus saß.
Er hatte sie schon bei seiner Ankunft im Burghof bemerkt. Der Ausdruck in ihrem Gesicht war eine Mischung aus Neugier und Argwohn gewesen, als würde sie aus nächster Nähe einen Löwen im Käfig betrachten. Genau dieser Ausdruck war auch jetzt wieder in ihrem Blick zu erkennen, und beinahe stahl sich ein Lächeln auf seine Lippen. Sie hatte rabenschwarzes Haar und war auf herbe Art schön. Ihre Nase war schmal und gerade, die Augen dunkelbraun und die schweren Lider mit dichten Wimpern eingefasst. Ihre Lippen, obschon zu einer starren, ernsten Linie gefroren, verhießen mehr als nur einen Anflug von Sinnlichkeit. Einen Moment lang erwiderte sie seinen prüfenden Blick, dann schlug sie züchtig die Augen nieder. Er fragte sich, wer sie war - das herauszufinden reizte ihn. Sicher wäre es eine Ablenkung, mit der man sich die eintönigen Stunden der Gefangenschaft vertreiben könnte.
Nach den verschiedenen Gängen des Festmahls zogen sich die Frauen zurück, so dass die Männer den Rest des Abends im Saal unter sich verbringen konnten. Waltheof verfolgte, wie sie den Raum verließen. In ihrem eng sitzenden Kleid aus tiefrotem Tuch bewegte sich die junge Frau geschmeidig wie ein Reh. Waltheof malte sich aus, sie in einem dunklen Gang im Schein der Fackeln in die Arme zu nehmen. Er stellte sich vor, wie sich diese dunklen Augen weiten würden, während sein Mund sich auf ihren senkte. Der Gedanke erregte ihn so sehr, dass er auf der Bank herumrutschen und seine Beinlinge zurechtziehen musste. Das Schicksal hatte ihn ganz einfach nicht dazu ausersehen, die klösterlichen Gelübde der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams abzulegen. Er zweifelte sehr, dass er es geschafft hätte, auch nur eines von ihnen einzuhalten.
Nachdem sich die Frauen verabschiedet hatten, lockerte sich die Atmosphäre zusehends, und Herzog Wilhelm, der sehr sittenstreng war, gestand seinen Gefolgsleuten eine gewisse Ausgelassenheit zu. In dem Treiben um sie herum ergriff Waltheof die Gelegenheit und erkundigte sich bei Richard de Rules, wer das Mädchen im roten Kleid war.
Der Seneschall sah ihn unruhig an. »Es ist Judith, die Nichte des Königs - ihre Mutter ist seine Schwester, Gräfin Adelaide von Aumale«, antwortete er. »Ich würde Euch raten, die Finger von dem Mädchen zu lassen.«
»Warum?« Waltheof verschränkte die Hände hinter dem Kopf. »Ist sie verlobt?«
De Rules schien die Situation unangenehm zu sein. »Noch nicht.«
Der Wein entfaltete in Waltheofs Blut seine Wirkung und machte ihn übermütig. »Dann kann man ihr doch den Hof machen?«
Der Normanne schüttelte verneinend den Kopf.
»Warum nicht?« Auf seiner Seite hatte lautstark ein Wettbewerb im Armdrücken begonnen und zog Waltheofs Aufmerksamkeit auf sich.
»Der Herzog ist ihr Onkel, daher wird ihre Heirat von größter Bedeutung für die Normandie sein«, gab de Rules Auskunft und betonte dabei jedes einzelne Wort.
Waltheofs Augen verengten sich. »Wollt Ihr damit sagen, ich sei nicht gut genug für sie?«
»Ich sage, dass der Herzog sie einem Mann seiner Wahl geben wird, nicht einem, der ihr den Hof macht, weil das Mädchen zufällig seinen Blick eingefangen hat. Außerdem«, fügte er spöttisch hinzu, »ist es vermutlich auch für Euch das Beste, sich von ihr fern zu halten. Ihre Mutter ist stolz wie ein Pfau, ihr Stiefvater äußerst empfindlich, wenn es um seine Ehre geht, und das Mädchen selbst ist schwierig.«
Waltheofs Neugier war entfacht. Er hätte gerne noch gefragt, in welcher Beziehung Judith schwierig sei, doch in diesem Augenblick griff ihn Edgar Atheling am Ärmel und zog ihn zu den Armdrückern hinüber. »Ein Pfund Silber, dass keiner Waltheof Siwardsson besiegt!«, brüllte er laut, seine junge Stimme heiser vom Trinken.
Die Männer grölten und schlugen auf die Tische. Meist scherzhaft gemeinte Beleidigungen wurden ausgetauscht, einige murmelten sich verschwörerisch etwas zu. Münzen blitzten wie Fischschuppen auf, als sie in die Mitte geworfen wurden. Waltheof wurde gegenüber dem für ihn vorgesehenen Gegner auf einen Stuhl gedrängt. Es handelte sich um einen Ritter aus dem herzoglichen Haus namens Picot de Saye. Der Mann hatte einen breiten Brustkorb und einen bulligen Nacken, Hände wie Schaufelblätter und auf einer Wange eine tiefe Narbe, die von einem Schwert stammen musste.
Sein Grinsen offenbarte das Fehlen mehrerer Zähne. »Es heißt, ein Narr und sein Geld sind bald voneinander getrennt«, sagte er voller Hohn.
Waltheof lachte seinen Gegner an. »Ich behaupte nicht, ein weiser Mann zu sein, aber es muss schon ein Stärkerer kommen als Ihr, um mich von meinem Silber zu trennen«, sagte er freundlich.
Spott und Hohn folgten dieser Bemerkung, doch auch diesmal wieder freundschaftlich gemeint. Waltheof stützte den Ellbogen auf den Tisch und legte die Hand in die des Normannen. Der Ärmel der Tunika des Jüngeren ließ kaum erahnen, welche Muskelkraft darunter verborgen war. Seine Hände waren glatt und nicht vom Kampf gezeichnet, denn Waltheof war zwar darin unterrichtet worden, Axt und Schwert in größter Vollendung zu führen, hatte es jedoch noch nie unter Beweis stellen müssen.
Picot fasste mit seiner vernarbten Hand nach der Waltheofs. »Zündet die Kerzen an«, befahl er.
Zu beiden Seiten ihrer Handgelenke standen flache Kerzenhalter, in denen kurze Talgstumpen steckten. Ziel des Wettkampfes war es, den Arm des Gegners nach unten zu drücken und damit die Flamme zu löschen. In dieser speziellen Disziplin hatte Waltheof Erfahrung, auch wenn davon nichts zu sehen war. Den Beweis für sein Talent stellte die unversehrte Haut auf seinem Handrücken dar.
Waltheof hielt seinen Arm locker und geschmeidig, als Picot zu drücken begann. Während er dem ersten prüfenden Druck standhielt, beobachtete er, wie sich beinahe unmerklich Picots Nacken und Schultern anspannten. In Waltheof machte sich gute Laune breit. Das Grinsen, das er Picot zukommen ließ, war natürlich und rührte nicht etwa daher, dass er vor Anstrengung die Zähne bleckte. Picot drückte stärker, doch Waltheof gab kein Jota nach. Vereinzelt fingen die Männer an, auf die Tische zu klopfen. Waltheof nahm den Lärm wie das Pochen in seinem Blut wahr, war sich der Zuschauer aber nur aus der Ferne bewusst. Konzentration war alles. Der Druck nahm zu, und Picots Griff begann zu schmerzen. Waltheof fing nun seinerseits an, Druck auszuüben, verstärkte ihn allmählich und ließ keinen Moment nach. Er entspannte die freie Hand, die auf seinem Oberschenkel lag und versuchte langsam und gleichmäßig zu atmen. Ermunternde Rufe übertönten das Trommeln der Fäuste. Waltheof pumpte noch mehr Kraft in seinen Unterarm und drückte Picots Handgelenk langsam und unerbittlich in Richtung Flamme. Der Normanne kämpfte, sein Gesicht färbte sich rot, und die Sehnen an seinem Hals schwollen zu dicken Strängen an, doch Waltheof war zu stark. Er fügte Picots Hand an der Kerze ein Brandmal zu und brachte sie zum Erlöschen, übler Gestank breitete sich aus.
Das Gebrüll war nun ohrenbetäubend. Picot rieb sich das verbrannte Handgelenk und starrte Waltheof an. »Ich werde nicht oft besiegt«, sagte er finster.
»Mein Vater wurde Siward der Starke genannt«, erwiderte Waltheof. »Man erzählt sich, er konnte mit einer Hand einen Ochsen zu Boden zwingen.« Er öffnete und schloss seine Faust, auf der die Fingerabdrücke des anderen als weiße Male zu erkennen waren.
»Wacker, Waltheof, Sohn des Siward, sehr wacker«, ließ eine tiefe Stimme hinter seiner linken Schulter verlauten. Waltheof wandte sich um und sah dort König Wilhelm stehen, dessen Schatten den Kerzenschein verdunkelte. Offensichtlich hatte er den Ausgang des Wettkampfes verfolgt, ein Gedanke, der Waltheof die Röte ins Gesicht trieb.
»Danke, Sire«, murmelte er.
»Nur zu schade, dass in meinem Saal nicht allzu oft Anlass besteht, gegen einen Ochsen zu ringen.« Wilhelm trug zwar ein Lächeln auf den Lippen, doch seine Augen waren ernst und wachsam. Hier stand ein Mann, der seinen Schutzschild nicht eine Sekunde lang hob und der andere an seinen eigenen strengen Normen maß.
Der eben erzwungene Sieg schmeckte auf einmal nicht mehr so süß, wie Waltheof es erwartet hatte.
2
Eine Woche später traf Wilhelms Hof die notwendigen Vorbereitungen, um Rouen zu verlassen und Ostern im nördlich gelegenen Fécamp zu feiern. Gräfin Adelaide, die unter einer Erkältung litt, hatte sich entschlossen, in einem der überdachten Gepäckkarren zu reisen, der im Inneren mit Federkissen und dicken Pelzen ausgelegt war, um das Holpern abzufedern und die Insassen warm zu halten.
Judith hasste diese Art des Reisens. Sie empfand das Rütteln und Wackeln als anstrengend, und mit der Gesellschaft verhielt es sich nicht anders. Die weinerliche Stimme ihrer Schwester konnte einem schnell auf die Nerven gehen, und das ständige Gezänke ihrer Mutter hätte sogar die Geduld einer Heiligen auf die Probe gestellt - und über eine solche Seelenstärke verfügte Judith nicht.
Nach vielem Hin und Her konnte sie Adelaide schließlich davon überzeugen, sie stattdessen auf ihrer schwarzen Friesenstute reiten zu lassen. »Dann ist auch mehr Platz im Karren«, betonte Judith. »Und ich verspreche, so zu reiten, dass Ihr mich immer sehen könnt.«
Adelaide nieste in ein großes Leinentaschentuch. »Dann geh, Kind«, bedeutete sie ihr mit einer müden Geste. »Du bereitest mir Kopfschmerzen. Sei nur vorsichtig und gib mir keinen Anlass, dich zu tadeln.«
Mit triumphierendem Lächeln machte Judith einen Knicks vor ihrer Mutter und wies Sybille leichten Herzens an, dem Stallburschen aufzutragen, ihre Stute zu satteln.
Draußen herrschte aufgrund der Vorbereitungen für die Reise nach Fécamp großes Durcheinander. Haushaltsutensilien wurden auf Gepäckkarren gestapelt: Decken und Wandbehänge für die herzoglichen Räume, Truhen voller Weißzeug, Stühle und Bänke, Polster, Kerzenleuchter, all die kostbaren Dinge, die den Engländern abgenommen worden waren. Falken aus den Käfigen, Hunde aus den Zwingern, ein Korb mit flatternden, aufgebracht gackernden Hühnern, die für die Tafel ihres Onkels bestimmt waren. Der Burghof war erfüllt von Lärm und Gerüchen, und Judith war versucht, sich wieder in die stickige Kammer ihrer Mutter zurückzuziehen.
Und dann entdeckte sie ihn auf der Burgwiese. Waltheof Siwardsson, Earl von Northampton, wie sie inzwischen wusste. Sie hatte ihn meist in Gesellschaft seiner Landsmänner gesehen und ihn unauffällig beobachtet, fasziniert und verwirrt in einem von seiner kraftstrotzenden Erscheinung.
Wie immer wich ihm der Sohn des Seneschalls, Simon de Senlis, nicht von der Seite und bewunderte ihn mit großen Augen, ähnlich einem jungen Hund, der zu seinem neuen Herrn aufsieht. Waltheof hatte sein dichtes kupferfarbenes Haar mit einem bestickten Band zurückgebunden und führte dem Jungen und dem anderen Publikum, das sich um ihn scharte, Kunststücke mit seiner riesigen dänischen Axt vor.
Judith verfolgte gebannt, wie er mühelos die schwere Klinge durch die Luft wirbelte. Das war also die Waffe, der die normannischen Krieger auf dem Schlachtfeld von Hastings gegenübergestanden hatten, der sie sich quälende Stunden lang widersetzen mussten und die ihnen beinahe den Garaus gemacht hätte. Als sie die Eleganz und Kraft von Waltheofs Bewegungen sah, hatte sie keine Zweifel mehr, dass Gott an diesem Tag auf der Seite ihres Onkels gestanden war, denn wie sonst hätte dieser gegen eine solche Waffe bestehen können?
Waltheofs Lachen erschallte gewaltig und überbordend, so wie es der Mann selbst war. Die Klinge blitzte noch einmal auf, als er die Axt ganz oben am Schaft auffing, um sie Simons älterem Bruder Garnier zu reichen, damit er sich auch daran versuche. Judith fühlte, wie ein Schauder über ihren Rücken lief und sich in ihren Lenden fing. Von einer Sehnsucht erfüllt, die sie nicht kannte und auch nicht verstand, ging sie rasch weg, weg von der Gefahr.
Sie traten die Reise nach Fécamp an, als die Sonne allmählich ihren Zenit erreichte. Es ging auf Ostern zu, das Wetter war herrlich, und auf den Straßen war der Schlamm des Winters weggetrocknet, so dass die Karren über festen Boden fahren konnten. Judith genoss die sanfte Wärme auf ihrer Haut und das zarte Grün des Frühlings, das das trostlose Schwarz und Braun des Winters verdrängte. Ihre Stute tänzelte ungestüm und zog an den Zügeln, wollte so gar nicht beschaulich dahintrotten. Es war geplant, unterwegs zu jagen, und Judith freute sich schon darauf, Jolie freien Lauf lassen zu können, denn auch sie selbst spürte, wie das Blut in ihren Adern schneller pulsierte und Ausgelassenheit sie befiel, die von der Frühlingswärme und dem Bedürfnis herrührte, sich nach dem Eingesperrtsein den Winter über ausgiebig zu dehnen und zu strecken.
Ein Knecht, der für die Hunde zuständig war, ließ das Jagdhundrudel des Herzogs frei, und die großen goldbraunen Tiere schnüffelten am Wegesrand entlang, um Witterungen aufzunehmen, denen man folgen konnte. Ohne die Hunde aus dem Blick zu lassen, kam Judith ihrer Pflicht nach und ritt in langsamem Schritt hinter dem Gefährt ihrer Mutter her. Aus dem Inneren drang gedämpftes Husten und Schniefen. Ihre Schwester sagte etwas in bockigem Tonfall, worauf Adelaide sie barsch anfuhr. Judith empfand große Erleichterung, dass man ihr diese Freiheit zugestanden hatte. Sie hätte es nicht ertragen, in dem stickigen Karren eingesperrt zu sein und den Frühlingstag nur durch einen kleinen Ausguck an sich vorbeiziehen zu sehen.
Einer der Jagdhunde scheuchte aus dem Gras, das entlang der ausgefahrenen Straße üppig spross, einen Hasen auf. Unter Freudenrufen und Fanfarenstößen lenkten die Männer ihre Pferde aus dem Zug und trieben sie zur Verfolgung an. Judith zögerte kurz, doch die Versuchung war zu groß. Ohne das Rufen ihrer Mutter zu beachten, zog sie Jolie herum und gab ihr die Sporen. Die Stute, die schon lange ungeduldig gewartet hatte, endlich losgaloppieren zu dürfen, flog davon wie ein Geschoss aus einer Armbrust. Judith ließ jede Vorsicht fahren und gebot ihr keinen Einhalt.
Sie ließ mehrere Reiter hinter sich, darunter auch ihren Vetter Rufus, der ihr ein Schimpfwort hinterherschickte. Sein derbes Gesicht war unter einem Schopf strohblonden Haars scharlachrot angelaufen. Die Frühlingsbrise fühlte sich in ihrem offenen Mund kühl und rein an und ließ ihren Schleier wie eine Fahne flattern. In der Jagdgesellschaft ritten noch andere Frauen mit, deren kreischende Aufmunterungsrufe sie anspornten, aber sie unterdrückte den Wunsch, laut aufzujuchzen. Das wäre nun doch über die Grenzen des Schicklichen hinausgegangen.
Der Hase tauchte in eine dicht von Erlen, Eschen und Weiden bestandene Senke ein. Judiths Stute nahm die Herausforderung in zwei großen Sprüngen, stockte dann aber so plötzlich, dass Judith beinahe aus dem Sattel gestürzt wäre. Das Mädchen klammerte sich an die Zügel und kämpfte darum, das Gleichgewicht wiederzufinden, während die Jagdgesellschaft an ihr vorbei durch das Dickicht auf das angrenzende Feld weiterstürmte und Judith weit zurückließ.
Durch ihre Röcke behindert, kämpfte sich Judith vom Rücken der Stute und sah, dass Jolie an der einen Hinterhand lahmte. Ohne nachzudenken legte sie die Hand auf das verletzte Gelenk. Erst lief ein Zittern über die Haut der Stute, dann schlug sie aus. Judith sprang rasch zur Seite und konnte von Glück reden, dass sie nur leicht von dem Hufeisen gestreift wurde. Doch das hatte ausgereicht, um das weiche Tuch ihres Kleides aufzureißen und den Blick auf das leinene Unterkleid freizugeben. Jolie machte Anstalten wegzustürmen, blieb dann aber mit angehobenem Bein stehen, die Zügel schleiften am Boden.
»Mylady, seid Ihr in Schwierigkeiten?«
Erstaunt blickte sie auf und sah Waltheof Siwardsson durch das Dickicht hindurch zu ihr zurückreiten. In seinem Gesicht stand Besorgnis.
Judiths Herz begann zu klopfen, und ihr Mund war plötzlich ganz trocken. Sie blickte sich um, konnte aber sonst niemanden entdecken. »Meine Stute«, sie wies auf ihr Pferd. »Sie nahm den Abhang wohl zu forsch.«
Ungewöhnlich elegant für einen Mann seiner Größe stieg er vom Pferd und band es an einem tief herabhängenden Ast fest. Behutsam näherte er sich Jolie von der Seite.
»Seid vorsichtig.« Judiths Stimme wurde lauter, obwohl sie sich vorgenommen hatte, ruhig und gelassen zu sprechen. »Sie wird durchgehen.«
»Nein, aber nein«, antwortete er mit einem leisen Summen in seiner Stimme, das ihre Magengrube in Vibration versetzte, »das wird sie nicht. Ich mag Pferde, und die Pferde mögen mich. Ich konnte schon als kleiner Junge gut mit ihnen umgehen. Abt Ulfcytel sagte immer, aus mir wäre ein guter Stallbursche geworden.«
Er fasste die Zügel der Stute und strich mit der offenen Hand über ihren schweißnassen Nacken. Judith hatte diese Hand mit todbringender Meisterschaft eine Streitaxt schwingen sehen. Nun konnte sie beobachten, wie sie ihr Pferd besänftigte, und fühlte dabei ihre Knie weich werden. Er murmelte sanfte, liebevolle Worte und ließ seinen Atem in die Nüstern der Stute strömen, wie sie es schon gelegentlich bei den Burschen im Stall gesehen hatte. Langsam und ruhig bewegte er sich zur Hinterhand und untersuchte vorsichtig das verletzte Bein. Jolie fuhr zusammen. Ebenso Judith, die befürchtete, Waltheof würde getreten und niedergetrampelt, doch nach diesem einen Zucken hielt die Stute still.
»Nach Fécamp wird sie Euch nicht tragen«, bemerkte er, ohne seinen Tonfall zu verändern, als wolle er das Pferd nicht erschrecken. Als sich seine dunkelblauen Augen mit denen Judiths trafen, war darin Sorge abzulesen. »Ich glaube, das Bein ist schwer verletzt.«
Judith befeuchtete ihre Lippen. Sie sah von ihm zum Pferd. »Wird sie etwa getötet werden müssen?«
Er hob die Schultern. »Das glaube ich nicht, Mylady. Selbst wenn sie später lahmen wird, kann man sie zur Zucht verwenden.« Um seinen Mund machte sich ein Zucken bemerkbar. »Bei einem Hengst wäre das natürlich etwas anderes, vor allem, wenn er an der Hinterhand verletzt wäre.«
Judiths Gesicht glühte. Sie wusste, dass ein Hengst eine Stute nur decken konnte, wenn er zwei gesunde Hinterläufe hatte, die während des Zeugungsakts sein ganzes Gewicht trugen. Auf einmal war sie sich der Gefahr ihrer Situation bewusst. Sie war die Nichte Herzog Wilhelms und hatte den Kardinalsfehler begangen, sich ohne Begleitperson von den anderen zu entfernen. Wie einfach könnte er sie auf den Teppich aus Veilchen werfen, der sich um ihre Füße ausbreitete, und sie vergewaltigen, um so Rache zu üben für seine Gefangenschaft und die Eroberung der englischen Krone durch ihren Onkel.
»Ihr müsst keine Angst vor mir haben, Mylady«, sagte er, als hätte er ihre Gedanken erraten.
»Ich habe keine Angst vor Euch«, erwiderte Judith forsch, doch in Wahrheit war sie starr vor Schreck.
Seine Lippen verzogen sich zu einem breiten Grinsen. »Ihr seid genau wie ich«, sagte er. »Ihr könnt einfach nicht lügen, da Euch Euer Gesicht verrät.« Sein Blick wanderte auf ihren Busen. »Ich bin keiner, der über Frauen herfällt«, merkte er leise an. »Sosehr ich auch in Versuchung geraten könnte.« Er wandte sich ab und band sein Pferd vom Baum los, saß auf und streckte die Hand zu Judith hinab. »Am besten Ihr steigt auf, Comtesse Judith, wenn wir den Zug noch erreichen wollen, ehe er in Fécamp eintrifft.«
Sie starrte auf seine Hand. Sie war so aufgewühlt, dass ihr ganz übel war. »Was ist mit meiner Stute?«
»Ihr könnt einen Stallburschen zurückschicken, sobald wir zu den anderen aufgeschlossen haben«, antwortete er. »Man wird sie im nächsten Dorf unterbringen müssen, bis sie wieder gesund ist.« Er nickte ihr auffordernd zu. »Kommt, hier könnt Ihr nicht bleiben, und ich verspreche, mich zu benehmen.«
Wider besseres Wissen reichte ihm Judith die Hand, setzte ihren Fuß auf seinen in den Steigbügel und ließ sich von ihm hochziehen. Nachdem sie ihre anfängliche Unbeholfenheit überwunden und das Durcheinander ihrer Röcke geordnet hatte, schaffte sie es, sich seitlich auf die Kruppe des Fuchses zu setzen. Krampfhaft klammerte sie sich hinten am Sattel fest, damit sie nicht hinabrutschte.
Er blickte über die Schulter, amüsiert, dass sie auf ihrem eigenen Pferd ganz selbstverständlich rittlings saß, es auf seinem aber offensichtlich als unpassend betrachtete. »Sagt mir rechtzeitig Bescheid, wenn Ihr glaubt herunterzufallen«, merkte er grinsend an. »Es wäre mir ausgesprochen unangenehm, wenn ich Euch wie eine erlegte Hirschkuh quer über den Sattel legen und so zu Eurem Onkel zurückbringen müsste.«
»Ich kann sehr wohl im Damensitz reiten«, ließ Judith schnippisch verlauten, verärgert über seinen Spott.
»Dann ist es ja gut«, antwortete er, »denn sonst müsste ich absteigen und das Pferd führen.« Er schnalzte mit der Zunge, und der Fuchs verfiel nach einem Zucken mit den Ohren in sanften Schritt.
Judith musterte die Äcker und widerstand der Versuchung, den Reiter vor ihr genauer zu betrachten. Ihre Mutter würde vor Wut kochen. Sie biss sich auf die Lippen. Es war nicht ihre Schuld, versicherte sie sich selbst. Außer dass sie vielleicht Jolie zu stark angetrieben hatte, so dass die Stute sich übernommen und das Bein überstreckt hatte.
Waltheof Siwardsson pfiff leise vor sich hin. Sie dachte daran, wie er im Burghof von Rouen die große Axt geschwungen hatte. »Habt Ihr in der großen Schlacht gegen meinen Onkel gekämpft?«, fragte sie ihn.
»Meint Ihr auf dem Schlachtfeld von Hastings?« Er drehte sich etwas im Sattel und sah sie an. »Nein, Mylady, das habe ich nicht.« Sein Lächeln wirkte auf einmal verbittert. »Vielleicht hätte ich es besser tun sollen.«
»Was hat Euch davon abgehalten?«
»Ach, das ist eine lange Geschichte, und ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich selbst die Antwort kenne.« Er verfiel in Schweigen und leitete das Pferd über einen Acker, auf dem der Weizen schon einen niedrigen grünen Teppich bildete. Dann seufzte er. »Ich war den Godwinssons weder zu Gehorsam noch zu Treue verpflichtet. Sie waren meiner Familie nie zu Diensten gewesen. Sie nahmen uns Northumbria und gaben es anderen.« Er zuckte mit den Achseln. »Ich erwarte nicht, dass Ihr das versteht.«
»Aber das tue ich«, erwiderte Judith und dachte dabei an die ständigen Vorträge ihrer Mutter. »Das Geburtsrecht eines Mannes ist sein ganzer Stolz.«
Er lächelte. »Ich habe nie geglaubt, viel Stolz zu besitzen, Mylady. Bis ich in seidenen Fesseln an Bord eines Schiffes in die Normandie gebracht wurde. Und nun frisst er mich auf, und ich frage mich, ob es ein Fehler war, mich aus Harolds letzter Schlacht herauszuhalten.«
Judith sagte nichts, denn sie wusste, dass dies über ihr Urteilsvermögen hinausging, doch Waltheof beantwortete sich die Frage mit einem Kopfschütteln selbst, bei dem sein kupferfarbenes Haar aufleuchtete. »Und selbst wenn ich gekämpft hätte, wäre Euer Onkel vielleicht doch als Sieger hervorgegangen. Und wenn durch unerwartet günstige Umstände Harold gewonnen hätte, bin ich dennoch nicht überzeugt, dass ich dadurch der Erfüllung meines Wunsches, Northumbria zurückzuerhalten, näher wäre. Die Grafschaft ist im Besitz von Morcar, und Harold war sein Schwager. Es gibt keinen, der für das Haus Siward kämpfen würde, außer Sven von Dänemark.« Er seufzte tief. »Manchmal glaube ich, ich wäre besser in Crowland geblieben und Mönch geworden.«
»Ich habe schon gehört, dass Ihr für den Dienst für die Kirche erzogen wurdet«, murmelte Judith.
Er nickte. »Ja, das wurde ich, doch als mein älterer Bruder in einer Schlacht fiel, holte man mich aus dem Kloster, um mich im Kampf auszubilden, wie es sich für mindestens einen Sohn eines großen Earl gehört. Ich war noch keine zwei Jahre zu Hause, als auch mein Vater starb und unsere Ländereien im Norden in die Hände von Tosti Godwinsson fielen.« Er bekreuzigte sich, und das Lächeln war auf einmal aus seinem Gesicht verschwunden.
»Hättet Ihr denn gerne die heiligen Gelübde abgelegt?«
»Manchmal glaube ich ja.« Er entspannte sich wieder. »In Crowland war es friedlich, und man konnte die Anwesenheit Gottes spüren. Draußen in der Welt ist es nicht so leicht, seine Stimme zu hören, da gibt es zu viele Versuchungen.« Er warf ihr einen prüfenden Blick zu. »Richard de Rules sagte, Ihr seid schwierig, aber das glaube ich nicht.«
Sie hob das Kinn. »Ich spreche das aus, was ich denke. Und das heißt doch, aufrichtig zu sein und nicht schwierig, oder?«
Er nickte zustimmend. »Ihr seid Eurem Onkel sehr ähnlich, Mylady«, antwortete er und trat dem Pferd behutsam in die Flanken, so dass es eine schnellere Gangart einschlug.
Sie schlossen zum Hauptzug auf, und ein Stallbursche wurde zu Judiths Stute zurückgeschickt. Waltheof lieferte Judith bei ihrer Mutter ab. Gräfin Adelaide musterte ihn mit zusammengekniffenen Augen, während er Judith in das Innere des Gefährts half, wo es streng nach Andornkraut und Salbei roch.
»Ein Glück, dass Ihr in der Nähe wart, um meiner Tochter zu helfen, Earl Waltheof«, bemerkte sie, erweckte dabei jedoch nicht den Anschein, als würde sie der Gedanke tatsächlich mit Freude erfüllen.
»Ja, das war es, Mylady.« Waltheof lächelte sie freimütig an und verbeugte sich vor ihr. Adelaide nahm es mit einem frostigen Nicken zur Kenntnis und sah dann weg, um zu zeigen, dass es nun mit ihrer Dankbarkeit und der Bereitschaft zu einer Unterhaltung ein Ende hatte.
»Danke, Mylord«, sagte Judith leise, weil sie das Gefühl hatte, die Antwort ihrer Mutter sei allzu knapp ausgefallen. Sie bemerkte, wie die Mägde sie erwartungsvoll anstarrten und ihre Schwester hinter vorgehaltener Hand kicherte.
»Es war mir eine Ehre, Mylady. Ich habe Eure Gesellschaft genossen.« Er verbeugte sich, stieg behände wieder in den Sattel, warf die Zügel herum und begrüßte die ersten von der Jagd Zurückgekehrten.
Adelaide sah ihre Tochter streng an. »›Ich habe Eure Gesellschaft genossen‹«, wiederholte sie mit ihrer wegen der Erkältung nasalen Stimme. »Ich will hoffen, du hast ihm keine falschen Hoffnungen gemacht, liebe Tochter.«
»Natürlich nicht!« Judith blickte finster zurück. »Ich habe nichts Falsches getan. Warum sollte ich mich nicht mit ihm unterhalten, wenn er schon der Gast meines Onkels ist?«
»Unterhalten ja, aber weiter nichts«, warnte sie Adelaide. »Du weißt sehr wohl, dass er mehr als ein Gast ist und weniger. Du hattest in diesem Fall keine andere Wahl, als seine Hilfe anzunehmen, aber mir wäre es lieber, es wäre gar nicht erst dazu gekommen. Und ich weiß nicht, was dein Onkel dazu sagen wird.«
»Meinen Onkel geht das gar nichts an!« Judith ahnte, was sie zu hören bekommen würde.
Adelaide schüttelte den Kopf. »Alles geht deinen Onkel etwas an. Wenn es den Anschein hat, dass du einen bestimmten Mann den anderen vorziehst, ist das nur von Nachteil, wenn es an der Zeit ist, einen Ehemann für dich auszuwählen. Zugegeben, Waltheof von Huntingdon sieht gut aus und hat ein gewinnendes Wesen, doch seine Abstammung und sein Stand sind für eine Verbindung mit unserem Haus bei weitem zu niedrig.« Bei den Worten gut aussehend und gewinnend hatte sie verächtlich die Lippen geschürzt, um deutlich zum Ausdruck zu bringen, dass sie solche Eigenschaften nicht gerade schätzte.
Judith errötete. »Obwohl meine Großmutter Herleve Wäscherin und die Tochter eines ganz gewöhnlichen Gerbers war?«, gab sie zurück.
Ihre Schwester rang bei dieser Schmähung um Luft. Adelaide richtete sich auf wie eine Schlange, was auf den tiefen Kissen und beim Schaukeln des Karrens gar nicht so einfach war. »Ich habe dich nicht aufgezogen, damit du deinem eigenen Fleisch und Blut so wenig Respekt entgegenbringst«, bemerkte sie frostig. »Meine Mutter, deine Großmutter, Gott sei ihrer Seele gnädig, starb ungeachtet ihrer Herkunft als edle Frau, und du sprichst nicht in diesem Ton von ihr, hast du das verstanden?«
»Ja, Mutter.« Judith presste die Lippen zusammen und hielt ihren Ärger zurück, denn sie wusste, wenn sie nun noch etwas entgegnete, drohte ihr die Peitsche. Ihre Mutter war ausgesprochen empfindlich, wenn die Sprache darauf kam, dass Herleve de Falaise tatsächlich die Tochter eines Gerbers gewesen war. Robert von der Normandie war ihr begegnet, als sie gerade in einem Fluss Wäsche wusch, und hatte sie mit auf seine Burg genommen. Sie hatte ihm zwei uneheliche Kinder geboren, Herzog Wilhelm und Adelaide, und als Roberts Interesse an ihr nachließ, wurde sie an einen seiner Gefolgsleute, Herluin de Conteville, verheiratet und so aus dem Weg geschafft. Aber Adelaide wollte nichts von Wäscherinnen und Gerbern hören. Was sie betraf, so bestand nur die adelige Linie, und die musste weitergeführt werden. Obwohl es nicht ausgesprochen wurde, wusste Judith, dass ihre Mutter eine Verbindung ihrer Tochter mit einem englischen Earl als Rückschritt für die Familie betrachten würde, auch wenn Waltheof Siwardsson einen besseren Stammbaum vorzuweisen hatte als sie selbst.
Judith hatte bisher keinen Gedanken an eine Verbindung mit einem englischen Earl verschwendet, nun, da ihre Mutter sich darüber so erregte, tat sie es.
Während sie in der Enge des Wagens saß, den kritischen Augen ihrer Mutter ausgesetzt, dachte sie daran, wie sie eben auf der Kruppe seines Pferdes gesessen hatte. An das kupferne Leuchten seines Haares gegen das warme dunkle Blau seines Umhangs. Seinen Humor. Wie es wohl wäre, in einem Haushalt mit einem Earl zu leben, der lieber lächelte als die Stirn in Falten legte? Der Gedanke war verlockend und versetzte Judith in Unruhe. Sie war ernste Worte und Pflichtbewusstsein gewohnt. Wäre es nicht seltsam und wunderbar, nur einmal den Kopf in den Nacken werfen und laut lachen zu dürfen?
»Er wird sie Euch nicht geben«, bemerkte Edgar Atheling höhnisch und schüttelte den Kopf über Waltheof. Es war der zweite Tag auf ihrer Reise nach Fécamp, und sie waren ihrem Ziel schon so nahe, dass sie den Rauch der Herdfeuer in der Stadt aufsteigen sahen und ihnen die eine oder andere Brise salziger Meeresluft in die Nase wehte. »Schließlich hat er seine eigene Tochter schon so gut wie sicher an Edwin von Mercia versprochen. Er wird wohl kaum sämtliche Jungfrauen aus seinem Haushalt an englische Gefangene verheiraten.«
»Wilhelm hat nicht gesagt, dass er Edwin die Hand seiner Tochter geben wird, nur dass er darüber nachdenken will«, erwiderte Waltheof. »Dass er mir seine Nichte gibt, ist nicht weniger wahrscheinlich, als dass er Edwin seine Tochter gibt.«
Edgar schnaubte verächtlich. »Mag sein, dass Ihr Recht habt, Waltheof«, sagte er. »Mag aber auch sein, dass keinem von Euch eine normannische Braut bestimmt ist.«
Waltheof zuckte gereizt mit den Schultern und wünschte sich, er hätte Edgar gegenüber nichts von seinem Interesse an Judith erwähnt. Edgars spöttische Bemerkung ärgerte ihn, denn sie bestätigte die Warnung von Richard de Rules, dass die Nichte Wilhelms des Bastards außer Reichweite für ihn sei. Aber gestern Nachmittag war sie nicht außer Reichweite, dachte er. Er hätte sie entführen und eine Heirat durch Vergewaltigung erzwingen können, eine Heirat, die ungefähr so lange gewährt hätte, wie die Normannen dazu brauchten, einen Mann auf eine Lanze zu spießen. Waltheof verzog das Gesicht. Vielleicht hatten Edgar und de Rules ja Recht. Vielleicht sollte er sie vergessen und sich anderweitig nach einer Braut umsehen, nach einem flachshaarigen englischen oder dänischen Mädchen, das ihm riesige Wikingersöhne gebären würde. Aber das war es nicht, was er wollte. Was er wollte fuhr fünfzig Yards hinter ihm in einem geschlossenen Karren, unter den Argusaugen der Mutter, die wie ein Drachen über ihren wertvollen Schatz wachte. Was er wollte, war das Eis zum Schmelzen bringen und das Feuer entfachen.
»Seid kein Narr«, sagte Edgar. »Sie ist eine Schönheit, ich weiß, aber es gibt hundert bessere Frauen, die Ihr als Ehefrau in Betracht ziehen könnt.« Er streckte die Faust in die Luft. »Und tausend allein in Fécamp, die Euch für ein Lächeln bereitwillig in ihren Kammern empfangen werden.«
Waltheof lachte widerstrebend. Letzteres war ihm auch schon in den Sinn gekommen. Herzog Wilhelms Nichte den Hof zu machen und sie zu gewinnen war ein Ziel in ferner Zukunft, auch wenn ihn die Frage, wie er das anstellen sollte, durchaus beschäftigte. Die Mädchen in den Tavernen von Fécamp standen dagegen sofort zur Verfügung und würden ihm helfen, sein Blut etwas abzukühlen. Besonders wenn er eines mit langen dunklen Zöpfen und sinnlichen braunen Augen finden würde.
3
Die Sonnenstrahlen fielen durch die Fensterläden und trafen auf Waltheofs geschlossene Lider. Leise brummend drehte er sich aus dem stechenden roten Lichtschein weg und stieß dabei gegen fremde Hüften und Oberschenkel. Es verwirrte ihn einen Moment lang, einen anderen Körper neben sich zu spüren, dann erinnerte er sich wieder. Er war betrunken gewesen, doch nicht bis zur Bewusstlosigkeit oder Handlungsunfähigkeit.
Draußen krähte ein Hahn, und es wurde ihm bewusst, dieses Geräusch schon eine ganze Weile durch den Schleier des Schlafs gehört zu haben. Da waren aber noch mehr Geräusche, das Rattern eines vorbeifahrenden Karrens und das schroffe Bellen eines Hundes, das Fegen eines Besens aus Birkenreisig auf dem Boden und zwei Frauen, die sich über einen Hof hinweg etwas zuriefen.
Das Mädchen an seiner Seite streckte sich und drückte sich an ihn. Schier unerträgliche Hitze breitete sich in Waltheofs Leistengegend aus. In den frühen Morgenstunden, wenn der Schlaf noch seine Sinne umnebelte, war er für solche Reize besonders empfänglich. Er drehte sie zu sich, öffnete ihre Schenkel und ließ, sich ganz dem Sinnen seines Körpers überlassend, seiner Lust ein zweites Mal ihren Lauf.
Sie war geschmeidig und zierlich, das dunkle Haar ging ihr bis zur Taille, und ihre Augen waren schwarz wie Schlehen. Es war dieses Äußere, das ihn zuerst angezogen hatte, und der sinnliche Blick, den sie ihm in der Taverne zugeworfen hatte. Die anderen Dirnen hatten nur zu sehr um seine Aufmerksamkeit geworben, sich auf seinen Schoß gesetzt, ihm den Bart gestreichelt, doch sie hatten ihn nicht interessiert, und so hatten sie sich willigere Kundschaft gesucht. Edgar Atheling war mit zweien von ihnen die Treppen hinauf verschwunden. Edwin und Morcar hatten sich unter die Obhut flämischer Zwillinge mit Zöpfen in der Farbe gerösteten Flachses und einer Haut wie frische Sahne begeben.
Die anfängliche Zurückhaltung des dunkelhaarigen Mädchens erinnerte Waltheof an Judith, und in seiner leichten Trunkenheit war es ihm nicht schwer gefallen, sich mit geschlossenen Augen vorzustellen, der Körper, den er in Besitz nahm, gehöre der Nichte des Herzogs der Normandie. Nun, nüchtern und im ersten Tageslicht, erkannte er, dass mit Ausnahme der dunklen Haare und Augen wenig Ähnlichkeit zwischen den beiden bestand. Ihre anfängliche Reserviertheit war nur gespielt gewesen. Auf diese Weise verkaufte sie sich, so wie die anderen Dirnen es mit Unverblümtheit versuchten.
Sie flüsterte ihm Worte ins Ohr, die Judith ganz gewiss nicht kannte, drängte ihn weiter, krallte die Nägel in seinen Rücken. Waltheof stöhnte und ließ sich auf einer Woge der Lust dem Höhepunkt zutreiben. Die Dirne keuchte und wand sich. Auch das, dachte er benommen, war wohl gespielt. Wie könnte es anders sein, wenn sie mit so vielen Männern zusammen war und ihre Bezahlung von der Zufriedenheit des Freiers abhing?
Er drehte sich von ihr weg, wartete, bis er wieder zu Atem gekommen war, und horchte auf die Geräusche der Stadt Fécamp, die allmählich zu Leben erwachte und ihr geschäftiges Treiben aufnahm.
»Gefalle ich Euch?« Sie sah ihn durch ihr zerzaustes Haar an und stützte das Kinn auf die Hände.
»Ja, du gefällst mir.« Waltheof setzte sich auf und warf ihr eine weitere Silbermünze aus seinem Beutel zu.
Sie schlang die Hände um seinen Nacken und küsste ihn voller Begeisterung. »Dann kommt Ihr wieder?«
»Vielleicht«, entgegnete er, weil er sie nicht enttäuschen wollte. Auf einmal musste er raus aus dieser Kammer mit ihrem strengen Geruch nach Wein, Schweiß und der Vereinigung ihrer Körper. Er löste sacht ihre Arme und zog sein Hemd an. Gestern Nacht hatte sie ihm ihren Namen genannt, aber er konnte und wollte sich jetzt nicht mehr daran erinnern.
Sie beobachtete ihn durch halb geschlossene Lider und spielte mit dem Zeigefinger an ihrem Mund. »Habt Ihr in England eine Frau zurückgelassen, Mylord?«
»Wie kommst du darauf?«, wollte Waltheof wissen und warf ihr einen Blick von der Seite zu.
»Wegen Eures Zögerns, bevor Ihr Euch entschieden habt, das war, als hättet Ihr ein schlechtes Gewissen oder das Gefühl, Ihr solltet besser nicht hier sein.«
Er schnaubte in einer Mischung aus Grimmigkeit und Erheiterung. »Du beobachtest gut.«
Sie sah ihn fragend an.
Ohne sich weiter darum zu kümmern, ob sein Hemd ordentlich zugeschnürt war, streifte Waltheof die Tunika über. Leinenes Unterzeug und Beinlinge folgten eilends. »Bist du bei all deinen Freiern so neugierig?«
»Nur wenn sie gut aussehen und einen großen Beutel haben.« Sie dehnte sich wie eine junge Füchsin und lächelte ihn an. »Und ich habe noch nicht oft einen größeren gesehen als Euren, Mylord.« Ihr Blick ruhte viel sagend auf seiner Leistengegend.
Ungewollt musste Waltheof lachen. Er beugte sich vor und gab ihr einen Klaps auf das entblößte Hinterteil. »Es freut mich, das zu hören.« Ohne ihr die Gelegenheit zu geben, weitere Fragen zu stellen, ging er zur Tür hinaus und lief schnell die Außentreppe hinab.
Als er noch einen Blick in den Gastraum warf, stellte er fest, dass sich dort niemand mehr aufhielt außer einer Frau, die das alte Wachs aus den Kerzenleuchtern kratzte, und einige von Wilhelms Rittern. Diese saßen um einen grob gezimmerten Tisch und tranken gemeinsam einen Krug Buttermilch. Waltheof grüßte sie höflich, doch mit einem bitteren Zug um die Lippen. Man erlaubte ihm und seinen englischen Mitgefangenen zwar sich herumzutreiben, doch eine normannische Wache war nie weit entfernt, die dafür zu sorgen hatte, dass keiner einen Fluchtversuch unternahm. Die Ritter waren kräftige Kerle und auch wenn sie keine Kettenpanzer angelegt hatten, so trugen sie doch für jeden sichtbar ihre Schwerter an der Hüfte.
Von Edgar, Edwin und Morcar war keine Spur zu sehen. Waltheof überlegte, ob er sie aus dem Bett werfen sollte, verwarf den Gedanken aber sofort wieder. Der Spaß daran würde in keinem Verhältnis zu dem Ärger stehen, den ihm das einbringen würde. Er ging nach draußen und ließ auf dem Misthaufen neben dem Stall Wasser. Dann schlenderte er gelassen in Richtung des Schlosses.