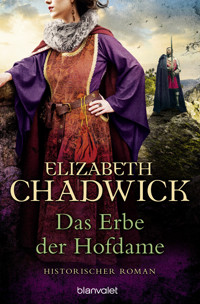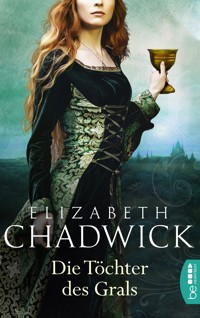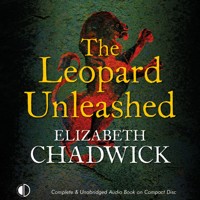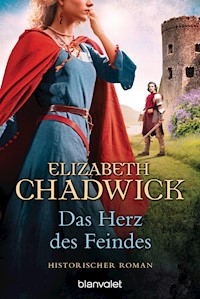8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie ist Irlands einzige Hoffnung ...
Irland 1152. Als Diarmait McMurchada, König von Leinster, eine Tochter statt des langersehnten Sohnes bekommt, ist seine Enttäuschung zunächst groß. Doch als er sie das erste Mal erblickt, weiß er sofort, dass Aoife sein Augenstern sein wird. Viele Jahre später befinden sich Aoife und ihre Familie im Exil, und nur die Gnade von Richard de Clare, einem reichen Kaufmann, kann ihnen zur Rückkehr in die irische Heimat verhelfen. Aoife ist inzwischen zu einer wunderschönen Frau herangewachsen, was auch Richard nicht verborgen geblieben ist. Und so verspricht Diarmait ihm die Hand seiner geliebten Aoife als Geschenk für dessen Unterstützung. Aoife dagegen hat ihre ganz eigenen Zukunftspläne …
Die Williams-Marshall-Reihe bei Blanvalet:
1. Der Ritter der Königin
2. Der scharlachrote Löwe
3. Das Banner der Königin
4. Die englische Rebellin
5. Die irische Prinzessin
Alle Bände können auch unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 757
Veröffentlichungsjahr: 2020
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Irland 1152. Als Diarmait MacMurchada, König von Leinster, eine Tochter statt des langersehnten Sohnes bekommt, ist seine Enttäuschung zunächst groß. Doch als er sie das erste Mal erblickt, weiß er sofort, dass Aoife sein Augenstern sein wird. Viele Jahre später befinden sich Aoife und ihre Familie im Exil, und nur die Gnade von Richard de Clare, Earl of Striguil, kann ihnen zur Rückkehr in die irische Heimat verhelfen. Aoife ist inzwischen zu einer wunderschönen Frau herangewachsen, was auch Richard nicht verborgen geblieben ist. Und so verspricht Diarmait ihm die Hand seiner geliebten Aoife als Geschenk für dessen Unterstützung. Aoife dagegen hat ihre ganz eigenen Zukunftspläne …
Autorin
Elizabeth Chadwick lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in Nottingham. Sie hat inzwischen über zwanzig historische Romane geschrieben, die allesamt im Mittelalter spielen. Vieles von ihrem Wissen über diese Epoche resultiert aus ihren Recherchen als Mitglied von »Regia Anglorum«, einem Verein, der das Leben und Wirken der Menschen im frühen Mittelalter nachspielt und so Geschichte lebendig werden lässt. Elizabeth Chadwick wurde mit dem Betty Trask Award ausgezeichnet, und ihre Romane gelangen immer wieder auf die Auswahlliste des Romantic Novelists’ Award.
Von Elizabeth Chadwick bereits erschienen (Auswahl)
Die englische Rebellin · Die Hüterin der Krone · Das Lied der Königin · Das Herz der Königin · Das Vermächtnis der Königin · Der letzte Auftrag des Ritters
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
ELIZABETH CHADWICK
Die irische Prinzessin
Deutsch von Nina Bader
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »The Irish Princess« bei Sphere, London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 2020 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright der Originalausgabe © 2019 by Elizabeth Chadwick Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2020 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Ulrike Nikel
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (Birgit Reitz-Hofmann; Bolyuk Rostyslav; Lovely Bird) und Richard Jenkins Photography
LA · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-26005-7V001www.blanvalet.de
PROLOG
Ferns Castle, Leinster, Irland, Frühjahr 1152
Im Morgengrauen kamen die Frauen der Burg, um Diarmait MacMurchada, dem König von Leinster, einem der zehn Königreiche in Irland, mitzuteilen, dass seine neue Frau eine Tochter geboren hatte.
Er nahm die Nachricht mit einem unwilligen Grunzen zur Kenntnis, weil er auf einen weiteren Sohn gehofft hatte, der zu einem großen, kräftigen Mann heranwachsen und sich den Speerkämpfern seiner Kriegerschar anschließen würde, obwohl Söhne genau wie Speere gefährlich sein konnten. Er wusste, wie er mit beiden umzugehen hatte, denn er war immer auf der Hut, ließ in seiner Wachsamkeit nie nach.
Seine Jungen betrachteten ihn aufmerksam, während sie am Feuer saßen und Schalen mit frischer, schaumiger Milch tranken. Er spürte ihre Erleichterung wegen der Geburt eines Mädchens. Môr, ihre Stiefmutter, war ihm vor Gott rechtmäßig angetraut, ihre Mütter hingegen waren mit ihm bloß nach alter Tradition verlobt, da ihre Abstammung zweifelhaft war und nicht dem Rang der MacMurchadas entsprach.
Diarmait musterte sie belustigt und wischte sich Milch von seinem Bart. Seine beiden Söhne Enna und Domnall, die er als Bärenjunge bezeichnete, waren stämmige, starke Burschen von vierzehn und elf Jahren, die, so Gott wollte, tapfere Krieger abgeben und füreinander einstehen würden, wie er und sein eigener Bruder es nicht getan hatten. Liebe deine Familie bedingungslos, traue ihr nie, hieß es schließlich.
Er wandte sich an die Frauen. »Bringt mir das Kind, ich will es sehen.«
Sie knicksten und entfernten sich hastig.
»Nun gut.« Diarmait fixierte seine Söhne mit einem Blick, der sich in ihr Innerstes bohrte. Vom lebenslangen Brüllen von Befehlen und vom Kommandieren der Soldaten, die ihm gehorchen mussten, klang seine Stimme rau, kratzig und barsch. »Ihr habt eine neue Schwester zu beschützen. Seht zu, dass ihr das wirklich tut, weil es genauso eure Pflicht ist wie die Aufgabe, euch aneinander und an mich zu binden.«
»So soll es sein, Vater, ich schwöre es.« Enna hielt Diarmaits Blick mit seinen klaren, hellen Augen unverwandt stand, und Domnall beeilte sich, dem Beispiel seines Bruders zu folgen.
»Ihr werdet dieses Versprechen in Gegenwart aller in der Kirche wiederholen, wenn sie getauft wird.«
»Wie wirst du sie nennen?«, fragte Enna.
»Das weiß ich erst, wenn ich sie sehe.« Môr schwatzte seit Wochen von Namen, wobei das meiste ihm zum einen Ohr hinein- und zum anderen wieder hinausgegangen war. Sie änderte ihre Meinung nämlich öfter, als er bei einem Fest Weinhörner leerte.
Die Frauen kehrten zurück. Môrs eigene frühere Amme Ainne hielt ein in eine blaue Decke gewickeltes Bündel in den Armen. Die Laute, die aus den Falten drangen, erinnerten Diarmait an eine kleine Krähe. Babys waren Frauensache. Abgesehen davon, dass sie ein Beweis für seine Manneskraft waren, interessierten sie ihn nicht, dennoch mussten die üblichen Rituale vollzogen werden, zu denen gehörte, dass das Kind anerkannt wurde. Obgleich es als Erstes die Augen seiner Mutter gesehen hatte, würde er ihm seinen Stempel aufdrücken, sodass es ein Leben lang ihm gehörte.
Er nahm der Amme das Baby ab und schob mit seinem schwieligen Zeigefinger die Decke zur Seite, um es anzuschauen und sich zu vergewissern, dass es gesund und perfekt war. Zehn Finger, zehn Zehen. Ein flaumiger Schopf dunkler Haare. Eine winzige Hülle, die ein schlagendes Herz beherbergte. Das kleine Mädchen fuhr fort, zu schniefen und zu quäken, als er sich erhob, es aus der raucherfüllten Halle trug und auf der Schwelle stehen blieb, um es im Licht der aufgehenden Sonne eingehend zu betrachten.
Plötzlich verstummte es und sah ihm in die Augen. Ihm stockte der Atem, denn er erkannte in dieser Tochter eine unergründliche Weisheit, die all das Wissen umfasste, das er vergessen hatte. Sie war so winzig und zart, so erlesen, ein Kunstwerk. Er ertappte sich dabei, wie ein Narr in ihr ernstes kleines Gesicht zu lächeln, während sich ein erster Anflug überwältigender Liebe, gepaart mit Beschützerinstinkten, in seiner Brust ausbreitete.
»Also dann, Tochter«, brummte er weich. »Wie sollen wir dich nennen?«
Diarmait sah zu, wie die Sonne den Horizont erreichte und den Himmel mit Gold säumte. Er war zweiundvierzig Jahre alt, kampferprobt, zynisch und skrupellos, aber in diesem Moment, wo er seine neugeborene Tochter im Arm hielt, fühlte er sich halb so alt – als hätte er durch sie aus einem Kelch der Hoffnung und des Neubeginns getrunken. Die Macht seiner Gefühle ließ seine Augen brennen, und mit einem Mal wusste er ihren Namen. Behutsam wickelte er sie wieder in die Decke und küsste sie auf die Stirn.
»Aoife«, sagte er. »Ich nenne dich Aoife.« Dieser Name bedeutete sowohl Strahlkraft als auch Schönheit, und er konnte sich nichts Passenderes vorstellen.
1
Pembroke Castle, Südwales, England November 1154
Der Bote traf zur Mittagszeit ein, als alle in der großen Halle beim Essen saßen. Das Licht begann bereits, schwächer zu werden, da tief hängende Regenwolken von der Irischen See heranzogen und die Burg in einen grauen Nieselregen tauchten.
Richard de Clare, Earl of Pembroke und Lord of Striguil, hörte resigniert zu, wie seine Mutter und seine Schwester Basilia sich über die Kosten für Kerzen und die noch vorhandene Menge in den Lagerräumen ausließen sowie darüber, was sie sich noch zu bestellen leisten konnten. Der größte Teil ihrer finanziellen Mittel wurde von den Kosten für den Erhalt der Burg. Speziell der Verteidigungsanlagen verschlungen. Mit dem Rest musste wegen der unsicheren Zukunft sparsam gewirtschaftet werden. Seit einem Jahr herrschte zwar Frieden nach langen Jahren des Bürgerkriegs, doch er war brüchig.
In seiner Kindheit hatte Geld keine große Rolle gespielt, jetzt beherrschte es seine Gedanken. Er war vierundzwanzig Jahre alt. Sein Vater war gestorben, als er achtzehn war, und die ganze Last, die eine umkämpfte Grafschaft bedeutete, war seinen Schultern aufgebürdet worden und hatte ihn mit einem Schlag von einem unmündigen Jugendlichen zu einem erwachsenen Mann werden lassen. Es war ihm vorgekommen, als hätte man ihn gegen eine Wand geschleudert. Verwirrt hatte er sich aufgerappelt, als er begriff, dass außer ihm niemand da war, und sich darangemacht, das Andenken seines Vaters zu ehren und selbst zu überleben.
Richard kannte jeden Mann, der an seinem Tisch saß, sein Brot aß, seinen Wein trank und sich an seinem Feuer wärmte, und vertraute ihm. Seine Kleidung, seine Waffen, sein Sold, alles war ihm vertraut. Es oblag seiner Verantwortung, für seine Leute zu sorgen. In diesem Punkt zu versagen wäre eine Schande, aber er hatte oft schwer zu kämpfen.
Er tauchte seinen Löffel in den Eintopf aus Hammelfleisch, in dieser Jahreszeit ein Grundnahrungsmittel, das die Köche mit Pfeffer und Kreuzkümmel würzten, um es appetitlicher zu machen. Gerade als er die Hand halb zum Mund geführt hatte, sah er, dass ein Diener einen mit Schlamm bespritzten Boten zu dem Podest führte, auf dem er saß: Alard, einen Stallknecht aus Striguil Castle, das ebenfalls zum Besitz der de Clares gehörte.
Der junge Bursche, sichtlich erschöpft von dem tagelangen Ritt, stolperte, als er den erhöhten Sitzplatz des Earls erreichte, und sank bleich vor Erschöpfung auf die Knie. »Sire, König Stephen ist tot, vor vier Tagen in Faversham an Magenkoliken gestorben.«
Die Worte blieben zunächst auf der Oberfläche von Richards Bewusstsein. Sobald er sicher war, dass sie der Wahrheit entsprachen, drohte die erst kürzlich erlangte Stabilität im Land zusammenzubrechen, und erneut konnte ein Krieg um die Macht und die Wahl des Königs zwischen den rivalisierenden Volksgruppen ausbrechen. Er bat Alard nicht, die Nachricht zu wiederholen. Einmal war genug. Einmal war zu viel. Im Laufe von vier Tagen hatte sich alles geändert, während er ahnungslos im vom Seedunst umwehten Pembroke vor sich hin dämmerte.
Er verabschiedete sich von dem übermüdeten, entkräfteten Boten, wies ihn an, etwas zu essen und sich einen Schlafplatz für die Nacht geben zu lassen. Seine Schale mit Eintopf schob er beiseite, weil ihm der Appetit vergangen war.
»König Stephen ist also tot«, sagte seine Mutter Isabelle, die einer normannischen Adelsfamilie entstammte, mit einem leisen, verächtlichen Schnauben. »Er hat seine Regentschaft zum Gespött aller herabgewürdigt, und jetzt kann er noch nicht einmal ehrenvoll aus dem Leben scheiden.« Auch sie hatte aufgehört zu essen, kaute stattdessen schwer auf dem herum, was sie soeben erfahren hatten. »Was wird das für uns bedeuten?«, fragte sie, heftete ihren Blick auf den Sohn und rechnete ganz selbstverständlich damit, dass er eine Antwort parat hatte.
Leider hatte er keine. Diese Wendung der Ereignisse hatte er nicht in Betracht gezogen. Nachdem König Stephen, ein Neffe von Henry I., fünfzehn Jahre lang mit Matilda, der Tochter von Henry I. und Witwe eines deutschen Kaisers, um den Anspruch auf den englischen Thron gekämpft hatte, war letztes Jahr Frieden geschlossen worden, indem Stephen Matildas inzwischen erwachsenen Sohn adoptierte und ihn zu seinem Nachfolger erklärte. Damit war vereinbart worden, dass die Krone nach Stephens Tod auf Henry II. überging, insofern hatte die Kaiserinwitwe bekommen, was sie seit der frühen Kindheit ihres Sohnes gnadenlos angestrebt hatte. Diejenigen, die lange Stephens Herrschaft unterstützt hatten und dafür zunächst belohnt worden waren, sahen sich plötzlich als ungeliebte Normannen auf den geschenkten Ländereien einer ungewissen Zukunft gegenüber. Richard, dessen Familie selbst normannischen Ursprungs war, fürchtete, dass sich Henry II., der jetzt sein Ziel erreicht hatte und König geworden war, nicht gerade großmütig zeigen würde, denn er wünschte wie vor ihm Stephen keinen großen Einfluss der Normannen, und wurde darin unterstützt von der breiten englischen Adelsschicht der Barone und Landlords.
»Ich weiß es nicht, Mutter, ich denke jedoch, dass wir uns vorbereiten und mit unseren Vorräten haushalten sollten. Henry FitzEmpress, Sohn der Kaiserin, wie er sich gerne nennt, steht im Ruf großer Unerschrockenheit und großen Hochmuts, wer weiß, welche Entscheidungen er treffen wird.«
Seufzend zog er seine Schale wieder heran und zwang sich weiterzuessen, um einen Anschein von Normalität zu demonstrieren. Henry würde König, und alles, was Richard tun konnte, war, standhaft zu bleiben und sich allem zu stellen, was über sie hereinbrechen würde.
Während der Friedensverhandlungen letztes Jahr hatte er den Kandidaten persönlich getroffen, die Begegnung war nicht freundschaftlich verlaufen. Henry betrachtete ihn offenbar als jemanden, der in seine Schranken verwiesen werden musste, vorzugsweise mit einem Fuß im Nacken. Sie waren ungefähr im selben Alter, nicht ganz, denn Richard war etwas älter und eine gute Handbreit größer. Und dass er zu ihm aufblicken musste, war für den künftigen König von England ein Stachel im Fleisch gewesen.
»Noch befindet Henry sich in der Normandie. Er muss erst den Kanal überqueren, bevor er nach Westminster kommt.« Richard verzog das Gesicht. Er hatte eigentlich die Absicht gehabt, Weihnachten in Pembroke zu verbringen, jetzt würde sich durch die bevorstehende Krönung, an der er als Earl teilnehmen musste, alles ändern.
»Du musst dafür sorgen, dass unsere Burgen über ausreichend Vorräte verfügen und mit vollzähligen Garnisonen belegt sind«, schärfte ihm seine Mutter ein. »Wirb noch Männer an, wenn es sein muss.«
Auf diese Bemerkung reagierte er mit Schweigen. Sie hatte wenig Ahnung von der wahren Lage außerhalb ihrer Ländereien, glaubte sogar, dass die de Clares mächtiger waren, als sie annahm, und dass sie eigenmächtig über ihr Schicksal bestimmen konnten. Sie pflegte Richard mit Geschichten zuzusetzen, was für ein großer Mann sein Vater gewesen war, und redete ihm ein, dass er an sein Vorbild heranreichen musste. Und das war leichter gesagt als getan. Dabei hatte der Tod seines Vaters im Grunde einen zu Lebzeiten nicht immer strahlenden Ruf aufpoliert.
»Wir werden das durchstehen«, warf sein Onkel Hervey, der landlose Halbbruder seines Vaters und ewiger Friedensstifter, mit seiner beschwichtigenden Stimme ein. »Wir können nichts tun, bevor wir mehr wissen. Es ist sinnvoll, zu planen, und sinnlos, sich Sorgen zu machen.« Er griff nach seinem Löffel und widmete sich demonstrativ dem Hammeleintopf.
Richard bedachte ihn mit einem dankbaren, wenngleich leicht sarkastischen Blick. Hervey gab gelegentlich solche Weisheiten zum Besten. Er meinte sie ernst, obwohl sie manchmal abgedroschen oder vollkommen banal waren, aber Richard wusste seinen beruhigenden Einfluss auf die Mitglieder seines Haushalts zu schätzen.
»Ja, Onkel«, erwiderte er. »Eine Mahnung zur rechten Zeit für uns alle.«
Nach dem Essen stieg Richard auf die Brustwehr hinaus und stellte fest, dass über der See ein Schleier lag, der so dick war wie Wolle, und dass er kaum eine Handbreit weit sehen konnte. Es kam ihm vor wie ein Spiegelbild seiner Zukunft. Wenn er die Hand in den Nebel streckte, würde sie verschwinden, und wenn er ihr folgte, verschwand er vielleicht mit ihr.
»Richard?«
Er drehte sich um, als jemand seinen Arm berührte, und stand seiner Mätresse gegenüber. Vor zwei Jahren hatte er Rohese Zuflucht gewährt, als ihr Mann, ein Ritter niederen Ranges, der bei ihm im Militärdienst gestanden hatte, bei einem Gefecht mit den Walisern ums Leben gekommen war. Von dem Moment an hatte sich ihre Beziehung entwickelt, und sie waren ein Liebespaar geworden. Vor fünf Monaten hatte sie ihm die Tochter Matilda geboren.
»Du bist bedrückt, Liebster.« Ihr Atem bildete feine Dampfwölkchen, die sich im Nebel kräuselten.
»Ich vermag meinen weiteren Weg nicht zu sehen«, erwiderte er düster.
»Wird es denn so einen großen Unterschied ausmachen, diesen Henry mit seiner Kaiserinmutter als König zu haben?«
»Ich fürchte ja, weil er im Land neue Unruhen bei den verschiedenen Völkern und Stämmen hervorruft. Deshalb hatte ich gehofft, Stephen würde noch etwas länger leben, leider sollte man nie Vertrauen in Könige setzen.« Er lehnte sich gegen den harten grauen Stein und seufzte. »Als ich ein Junge war, habe ich feindliche Soldaten gesehen, die in einem Graben festsaßen und dort abgeschlachtet wurden, weil es keine Fluchtmöglichkeit gab. Wenngleich sie mir Böses wollten, hatte ich Mitleid mit ihnen, und von diesem Moment an wusste ich, dass ich nie derjenige sein wollte, der in einem solchen Graben sitzt. Und jetzt stelle ich fest, dass ich in eine solche Falle geraten bin.«
Sie schob den Arm unter seinen Umhang und legte ihn um seine Taille. »Komm wieder herein, dann bringe ich dir heißen Wein und massiere dir die Füße. Es nutzt nichts, draußen in der Kälte zu stehen, und bis sich dieser Nebel verzogen hat, gibt es ohnehin nichts zu sehen.«
Er nahm sich zusammen und rang sich angesichts der Furcht in ihren sanften haselnussbraunen Augen ein beschwichtigendes Lächeln ab. »Wo wäre ich nur ohne deine Klugheit und deinen gesunden Menschenverstand?«
»Im Nebel verloren?« Sie küsste ihn, und er spürte die Kälte ihrer Lippen und die Wärme ihres Mundes.
»Du weißt gar nicht, wie nah du der Wahrheit gekommen bist«, sagte er und folgte ihr durch die gefrorenen Wolken zu seinem Privatgemach über der Halle. Der große Kamin verströmte die willkommene Wärme glühender Kohlen, die sein Gesicht und seine Hände zum Prickeln brachten. In der Nähe des mit Pelzen bedeckten Kastenbetts stand eine Wiege, und er ging darauf zu, um einen Blick auf seine Tochter zu werfen. Sie war wach und gurrte zufrieden vor sich hin. Er beugte sich vor, um sie unter dem Kinn zu kitzeln, und dankte Gott für solch ein Geschenk in schwierigen Zeiten.
2
Striguil Castle, England, Grenzgebiet zu Wales, Juli 1155
Acht Monate später wachte Richard in seinem Bett in Striguil auf, verschränkte die Hände hinter dem Kopf und betrachtete das frühe Sonnenlicht, das durch die offenen Fensterläden fiel. Er war gestern Abend von Worcester hierhergeritten, begleitet von Fledermäusen, die im Zwielicht des aufgehenden Mondes über dem Wye hin und her schossen. Zwar war er erschöpft gewesen, jedoch angetrieben von unbändigem Groll und wilder Entschlossenheit. Er kam von der Krönung in Westminster zurück. Kaum war Henry König geworden, hatte er es für angebracht gehalten, ihm die Grafschaft Pembroke sowie die Burg zu entziehen. Lediglich den Titel eines Earls durfte er behalten. Warum, wusste er nicht. Jedenfalls schien der neue König eine Umverteilung zu planen. Die Einen bekamen etwas, den Anderen wurde etwas genommen.
Bei der Versammlung des Hofes in Westminster hatte Henry, eine Hand um sein Kinn gelegt, mit wachsamem und mitleidlosem Blick auf seinem großen Stuhl gesessen, während eine Liste der Burgen und Ländereien verlesen wurde, die entweder ohne Möglichkeit auf Widerspruch dem Erdboden gleichgemacht oder an die Krone zurückfallen sollten. Richard gehörte zu den vielen Baronen und anderen Edelleuten, die auf diese Weise enteignet wurden, sogar ehemalige Unterstützer befanden sich darunter, was die Demütigung noch bitterer machte. Zumindest wusste Richard jetzt, wo er stand. Er war auf die Spitze einer Nadel gespießt worden, um dort auf Geheiß des neuen Königs zu zappeln und zu tanzen. Zwar mochte er nach wie vor der Herr von Striguil, Usk und Goodrich sein, aber Pembroke, der Stolz seines Vaters, war verloren, und Richard wurde das Gefühl nicht los, ihn enttäuscht zu haben.
Inzwischen hatte er bereits eine Strafaktion mit dem König mitmachen müssen, bei der es um die Rückgabe von Burgen und Ländereien ging, die seit dem Auftauchen Wilhelm des Eroberers an normannische Familien gefallen waren. Nach den Wikingern waren sie die ersten Fremden gewesen, die sich in England mit einer anderen Sprache, anderen Sitten und einer anderen Religion niedergelassen hatten. Jetzt war er zurück und erwachte gerade.
Sein Blick wanderte zu Rohese, die sich in der Fensternische die braunen Haare kämmte, bis sie in seidigen Wellen herabflossen. Sie sah auf, als er ihren Namen aussprach, und ein Lächeln erhellte ihr Gesicht. Dann hielt sie mit Kämmen inne und brachte ihm einen Becher Wein, der mit Wasser versetzt war. »Du hast lange geschlafen«, sagte sie, als sie sich zu ihm aufs Bett setzte.
Er richtete sich auf und trank langsam. »Wir haben die Pferde unermüdlich angetrieben«, erwiderte er. »Nachdem Hugh Mortimer sich ergeben hat, sind wir erst gestern Mittag von Worcester aufgebrochen. Die ganze Zeit über, als wir Wigmore und Bridgnorth belagert haben, musste ich daran denken, dass ich ebenfalls in eine solche Lage hätte geraten können, wenn ich mich geweigert hätte, Pembroke aufzugeben. Stattdessen habe ich mit den Wölfen geheult und zu Hugh Mortimers Sturz beigetragen.« Seine Züge verzerrten sich vor Ekel. »Es war so, als würde ich süßen Wein trinken, um die Freundschaft aller zu gewinnen, und als würde ich den Wünschen des Königs folgen, damit er mir meine Grafschaft zurückgibt. Was nicht ganz unrichtig ist. Im kalten Tageslicht allerdings musste ich erkennen, dass nichts sich geändert hat. Henry FitzEmpress ist vermutlich der zielstrebigste und rücksichtsloseste Mann, der mir je begegnet ist.«
»Abgesehen von dir selbst«, sagte sie mit einem anzüglichen Lächeln.
Er sah sie verwundert an. »So denkst du über mich?«
Sie faltete die Hände über den Knien. »Du konzentrierst dich auf das, was du willst, wie auf die Mitte einer Zielscheibe. Vielleicht möchte dich der König deswegen auf deinen dir zukommenden Platz verweisen. Er kommt mir wie ein Mann vor, der nicht gern im Schatten eines anderen steht.«
Richard schnaubte. »Wie könnte er in meinem Schatten stehen? Falls ich rebelliere, würde er mich zermalmen, so wie er den armen Mortimer zermalmt hat. Die Wunden des langen Krieges sind kaum vernarbt. Es wäre für meine Feinde ein Leichtes, sich gegen mich zu wenden und mich in Stücke zu reißen.«
»Dann betrachtet er dich möglicherweise als persönliche Bedrohung. Vielleicht fürchtete er deinen Ehrgeiz und das, was du getan hättest, wenn er dir Pembroke gelassen hätte. Mit einem so großen Besitz wärst du mächtiger und eine Gefahr für ihn. Selbst wenn du Rückschläge erleidest, gehst du deinen Weg schließlich unbeirrt weiter.«
Er nippte an dem Wein und dachte über ihre Worte nach. Sie hatte recht. Oft wurde er von Verzweiflung ergriffen, ohne sich das im Umgang mit anderen anmerken zu lassen. Eine stoische Fassade war ein Hilfsmittel, um zu überleben, und gleichzeitig eine Weigerung, eine Niederlage hinzunehmen. Daran klammerte er sich wie ein Schiffbrüchiger, der hoffte, an das rettende Ufer zu gelangen, wenn er sich an einem Wrackteil festhielt.
»Sobald du ein Ziel hast, verwendest du deine gesamte Willenskraft darauf, es zu erreichen.« Rohese änderte ihren Kurs, maß ihn mit einem provozierenden Blick und berührte seinen Oberschenkel.
Richard stellte seinen leeren Becher beiseite. »Ist das so?« Dann drehte er sich zu ihr, umschloss durch ihr Nachtgewand hindurch ihre Brust und spürte die straffe, lockende Schwere unter dem Stoff. »Vielleicht hast du recht. Ich konzentriere mich jetzt ganz auf meine Absichten, und nichts und niemand wird sich mir dabei in den Weg stellen.« Er griff nach dem Saum des Hemds und zog es hoch.
»Ich habe immer recht«, entgegnete sie lachend. »Das solltest du inzwischen wissen.«
Nach ihrem Liebesspiel döste Richard noch eine Weile. Er wusste, dass er aufstehen und seinen Pflichten nachkommen sollte, doch er wollte diese Momente auskosten. Rohese streifte wieder ein Hemd über, stieg aus dem Bett und kam mit ihrer dreizehn Monate alten Tochter zurück. Matilda umklammerte die Hand ihrer Mutter und tapste, einen Fuß unsicher vor den anderen setzend, neben ihr her.
»Sie läuft!«, rief Richard entzückt. »Und wie sie gewachsen ist!« Er schwang die Kleine in die Luft und küsste ihre weichen Locken.
»Und sie spricht«, verkündete Rohese stolz. »Sie sagt schon Mama, Pferd und Brot.«
Der Vater drückte seine Tochter an sich und genoss es, ihren kleinen Körper in seinen Armen zu spüren. Er konnte der nüchterne, sachlich denkende militärische Anführer sein, der gleichmütige Höfling und der fähige Verwalter, aber sobald er seine Rüstung und seine Verantwortung ablegte, waren es die kleinen Dinge, die für ihn am meisten zählten, und die gab es hier in seiner Kammer. Familie, Wärme, Zusammengehörigkeit.
»Man lehrt uns, dass Stolz eine Sünde ist«, sagte er, »ich sehe es nicht so, wenn mein Herz überquillt und mein Stolz zugleich mein Glück ist.«
»Was würdest du sagen, wenn ich erneut ein Kind bekäme?«
Über den Kopf ihrer Tochter hinweg sah er sie an.
Ihre Wangen röteten sich. »Es war die Nacht, bevor du zu dem Feldzug mit dem König aufgebrochen bist.«
Also vor etwas mehr als drei Monaten. Er musterte sie mit gesteigerter Zuneigung und lächelte. »Das sind noch mehr gute Neuigkeiten, die mein Herz erfüllen.« Mit seiner Tochter im einen Arm umarmte er sie mit dem anderen. »Wenn ich das Gefühl habe, dass mir nichts mehr bleibt, kommst du und gibst mir alles.«
Fünf Monate später stützte sich Richard auf einen Ellbogen und sah auf Rohese hinunter, die neben ihm auf dem Bett lag. Beide waren sie vollständig bekleidet. Ihr Bauch war von der Schwangerschaft angeschwollen, und obwohl sie sich nicht geliebt hatten, war es genug für ihn, sie an seiner Seite zu haben.
»Die Hebammen sagen, es wird nicht mehr lange dauern.« Sie tippte mit dem Zeigefinger gegen seine Nasenspitze und lächelte. »Warte, bis du einen gesunden Sohn hast, den du in den Armen wiegen kannst.«
»Ich freue mich bereits darauf.« Er streichelte ihren Bauch. Genau wie sie wollte er am liebsten einen Sohn, Gott würde es so einrichten, wie er es für richtig hielt.
»Ich wünschte …«, begann sie wehmütig und schüttelte den Kopf.
»Was wünschst du dir?«
»Das werde ich für mich behalten.« Sie verflocht ihre Finger mit seinen. »Ich weiß, dass es nicht wahr werden kann, dennoch will ich träumen, und in meinem Traum wird mein Wunsch erfüllt.«
Er ahnte, was das für ein Traum war und dass er sich nie verwirklichen konnte.
Draußen vor der Tür räusperte sich sein Knappe Simon vernehmlich. »Sire, es wird nach Euch verlangt. Eure Mutter ist hier.«
Richard unterdrückte ein Stöhnen. »Sag ihr, ich bin bald bei ihr.« Er küsste Roheses Handfläche. »Ich muss gehen, wir sprechen später weiter.«
Über seine Schulter hinweg lächelte er sie an, als er die Tür öffnete, woraufhin sie ihm eine Kusshand zuwarf.
»Es wird Zeit, dass du eine passende Frau findest«, sagte seine Mutter, als sie am Feuer saßen. »Sich eine Mätresse zum Stillen der Lust zu halten ist ja gut und schön, nur kannst du keine Dynastie mit ihr gründen.«
Richard betrachtete seine Mutter. Ihre Züge waren scharf und streng, wiesen immer noch Spuren der hinreißenden Schönheit auf, die König Henrys Großvater, den ersten Henry, bezaubert hatte, dessen Mätresse sie wenngleich widerstrebend für kurze Zeit gewesen war, um königliche Gunstbezeugungen für ihre Brüder zu erringen. Ihr Sohn hatte kein enges Verhältnis zu ihr. In seiner Kindheit hatte er Liebe und Zuwendung allein von seiner Amme erhalten. Seine Mutter respektierte er, weil sie ohne Falschheit oder Hintergedanken aussprach, was sie dachte. Zugleich war sie unmäßig stolz, und ihren Erwartungen und oft unrealistischen Maßstäben gerecht zu werden konnte eine schwere Bürde sein.
»Ich würde Rohese zur Frau nehmen, wenn ich könnte.«
»Das ist ausgeschlossen.« Sie bedachte ihn mit einem tadelnden Blick. »Sie steht im Rang zu weit unter dir. Es ist deine Pflicht, eine Frau vom selben Stand zu heiraten, die einen berühmten Namen hat und wertvolles Land mit in die Ehe bringt.«
»Und wo soll ich eine solche Frau finden?«, erkundigte er sich verärgert. »Der König legt mir an jeder Ecke Steine in den Weg, und die Männer mit Töchtern von dem Rang und Stand, der dir für mich vorschwebt, hegen nicht den Wunsch, einen Ehemann zu nehmen, der nicht in der Gunst des Königs steht.«
»Das lässt sich ändern. Ich werde an meinen Bruder bei Hof schreiben. Der König wird ihn anhören. Du musst andere bitten, sich für dich einzusetzen. Was würde dein Vater denken, wenn er dich jetzt hören könnte? Er hätte dem König nie gestattet, ihn so zu behandeln.«
Sie war wie ein Hund, der einen Knochen nicht loslassen wollte. Richard erhob sich abrupt und trat ans Fenster. Sein Vater. Immer sein Vater. Ständig musste er sich an dessen Leistungen und seinem Ruf messen lassen. »Da er gestorben ist, bevor Henry auf den Thron kam, werden wir das nie erfahren«, sagte er in einem ausdruckslosen Tonfall, der nichts von den feindseligen Gefühlen verriet, die in ihm brodelten. »Ich tue mein Bestes, und wenn das nicht genug ist, dann kann ich es nicht ändern.«
Seine Mutter erwiderte nichts darauf, doch er konnte ihre Missbilligung spüren.
»Ich werde deinen Rat beherzigen und mich um die Angelegenheit kümmern«, fuhr er mit erzwungener Höflichkeit fort, »bloß dräng mich nicht. Ich bin nicht mein Vater. Ich bin mein eigener Herr, und ich werde meinen eigenen Weg gehen.«
Drei Tage später kehrte seine Mutter zu ihrem Witwensitz in Essex zurück, und Richard seufzte vor Erleichterung. Er schuldete ihr Sohnespflicht, dabei sehnte sich irgendwo tief in ihm ein kleiner Junge nach ihrem Lob und ihrer Anerkennung, was er in sich verschlossen hielt. Es war besser, den Schorf auf der Wunde zu lassen, statt daran herumzukratzen.
Kurz vor Mittag, als er gerade in der Halle saß und speiste, kam seine Schwester Basilia zu ihm, um ihm zu sagen, dass bei Rohese die Wehen eingesetzt hatten und alles gut verlief.
»Sag ihr, ich schicke ihr all meine Liebe und hoffe, bald bei ihr zu sein.«
»Natürlich.«
Seine Schwester verfügte über dieselbe praktische Veranlagung wie seine Mutter. Sie fungierte als Richards Kastellanin und kümmerte sich mit gleichbleibender Tüchtigkeit um seine häuslichen Angelegenheiten. Langjährige Vertrautheit führte dazu, dass er sie fast wie einen erweiterten Teil seiner selbst behandelte, statt sie mit ihrem wachen Verstand wirklich als eigenständige Persönlichkeit zu betrachten. Angesichts des geringen Ansehens, dass sie beide momentan beim König genossen, war es unwahrscheinlich, dass Basilia heiratete und sich an ihrer Position etwas änderte.
Nachdem er seine Mahlzeit beendet hatte, sah Richard nach dem kastanienbraunen Hengstfohlen, das seine Lieblingsstute zur Welt gebracht hatte. Es war zwei Monate alt, hatte ein flauschiges Fell und im Verhältnis zu seinem Körper überproportional lange Beine. Er hatte den kleinen Hengst nach dem griechischen Helden Ajax benannt und beabsichtigte, ihn zu seinem nächsten Schlachtross auszubilden, wenn sich herausstellte, dass er die Anlagen dazu hatte. Während er die Stute streichelte und dem Fohlen über die neugierige Nase rieb, grübelte er über Blutlinien nach. Stuten und Hengste, Männer und Frauen. Er war zufrieden mit Rohese, sie machte ihn glücklich, und er liebte sie. Selbst wenn er eines Tages heiratete, um die Familiendynastie fortzusetzen, was er angesichts seines Verhältnisses zum König bezweifelte, würde das ein reines Lippenbekenntnis sein.
Das Fohlen tat so, als wäre es erschrocken, bäumte sich auf und jagte auskeilend auf seinen spindeldürren Beinen über die Koppel. Richard beobachtete es eine Weile belustigt, bevor er in seine Kammer zurückkehrte, wo er mit seinem Onkel Hervey Schach spielte und abwartete, bis das Kind geboren war.
Seine Hand schwebte gerade über einem Springer, als die Tür geöffnet wurde. Er blickte auf und sah die Hebamme mit blutgetränkter Schürze und angespannter Miene vor ihm stehen. Sie sagte nichts, sondern schüttelte wortlos den Kopf.
Ein eisiger Schauer rann ihm über den Rücken, er sprang auf und stieß Hervey weg, als dieser ihn am Arm packen wollte. »Lasst mich zu ihr.« Er steuerte auf die Tür zu. »Ich muss sie sehen.«
»Sire, Ihr solltet nicht …«
Ohne auf sie zu achten, schob er die Frau zur Seite und rannte die Stufen hoch, stürmte in die Kammer und stürzte an das Bett. Rohese lag unter einer Decke, ihre Arme auf der Brust gekreuzt. Ihre Augen waren geschlossen, die Lippen leicht geöffnet, als würde sie schlafen, aber ihr Körper wies die blutleere Farbe des Todes auf.
»Nein«, keuchte er. »Nein!« Er beugte sich über sie und presste die Lippen auf ihre. Sie waren immer noch warm, immer noch weich. Sie konnte nicht tot sein, ihre Brust allerdings hob und senkte sich nicht mehr, und ihr Gesicht glich einer Maske.
Als er ein klägliches Geräusch hörte, drehte er den Kopf zu der Wiege beim Feuer. Basilia stand daneben und hielt den glasigen Blick auf ihn gerichtet. »Du hast eine Tochter.« Sie bückte sich, um ein gewickeltes Baby herauszuheben. »Wir konnten ihr nicht helfen. Die Nachgeburt kam zu schnell heraus, sodass die Blutung sich nicht stillen ließ. Gib den Hebammen nicht die Schuld daran.«
Er schüttelte den Kopf, war zu benommen, um an Schuldzuweisungen zu denken, außer dass er vielleicht die Verantwortung bei sich selbst suchte, weil er Rohese geschwängert hatte.
»Im Dorf gibt es eine Amme, ich habe gleich nach ihr geschickt.«
Richard bekundete mit einem wortlosen Nicken seine Zustimmung, war dankbar für Basilias praktische Art. Rohese war so sicher gewesen, dass es ein Junge würde. Sie hatte ihm einen Sohn schenken wollen, und nun war sie tot. Er nahm Basilia seine Tochter ab und blickte in ihr runzeliges kleines Gesicht, bevor er sie sacht auf die Stirn küsste und sie auf das verstummte Herz ihrer Mutter legte, bevor er Roheses Arme auseinanderschob und sie um das Baby schlang. »Ein Kind sollte die Berührung seiner Mutter erfahren«, sagte er. »Ein Kind sollte wissen, dass es geliebt wird.«
Die Frauen schnieften und schluchzten, seine eigenen Augen blieben trocken. Trotzdem waren seine Gefühlsregungen so machtvoll wie gleißendes Sonnenlicht. Es war seine Pflicht, in diesem Moment das Richtige zu tun. Er wandte sich an die Frauen. »Ich danke euch für alles, was ihr getan habt, und würde euch jetzt bitten, zu gehen und mich ein paar Momente mit meiner Lady allein zu lassen.«
Basilia zögerte, nickte dann, um alle aus dem Raum zu scheuchen und die Tür zu schließen.
Sobald sie allein waren, legte Richard sich neben Rohese, so wie er es getan hatte, wenn sie alltägliche Dinge besprochen hatten. Er nahm ihre Hand und rieb mit dem Daumen über ihren Ring. »Ich habe dich wie eine mir angetraute Ehefrau geliebt«, flüsterte er. »Und ich ehre dich auch wie eine solche. Ich werde unsere Töchter hüten wie einen kostbaren Schatz und mein Bestes für sie tun.« Er hielt inne, seine Stimme drohte zu brechen. »Ich werde allein weiterleben, dich vermissen und dein Andenken in Ehren halten. Und unseren Mädchen werde ich von dir erzählen, damit sie durch mich lernen, wie du warst.« Er hob ihre Hand und küsste sie. »Leb wohl, meine Liebste. Gott schütze dich.«
Er nahm das Baby, trat vom Bett zurück und öffnete die Tür. »Sorgt dafür, dass alles Nötige für sie getan wird, und zwar das Allerbeste«, befahl er den wartenden Frauen. »Ihre Mutter war die Liebe meines Herzens, und ihr werdet sie durch die Fürsorge für ihre Töchter ehren.«
Basilia berührte seinen Arm. »Es tut mir leid. Ich mochte sie, und ich weiß, was sie dir bedeutet hat.«
Richard dachte bei sich, dass sie überhaupt nichts wusste. Niemand tat das. »Ich habe jetzt zwei Töchter großzuziehen.« Er schluckte seinen aufwallenden Schmerz hinunter. »Sie lebt in ihnen weiter, und ich muss an ihrer Stelle mein Bestes geben.«
Eine Kinderfrau erbot sich, ihm das Baby abzunehmen, er schüttelte den Kopf, war noch nicht bereit, sie herzugeben. Sie war der aus dem Tod geborene Lebensfunke, und solange er sie hielt, konnte er immer noch Rohese neben sich spüren.
3
Ferns Castle, Leinster, Irland, Herbst 1157
Diarmait lachte, schwang Aoife in den Armen hoch und entlockte ihr ein Quieken. »Ah, du bist wirklich eine Schönheit«, brummte er.
Sie schlang die Arme um seinen Hals und drückte ihn so fest, wie sie konnte. »Und du klammerst wie ein kleiner Affe! Ha, soll ich dich jetzt an diesen feinen englischen Kaufmann verkaufen?«
Ein grünes Seidenband schimmerte in Aoifes torfdunklem Haar, das Geschenk eines Händlers aus Bristol, Robert FitzHarding, der bei Diarmait Holz, Marderfelle und Kuhhäute gegen Gascogner Wein und Kisten mit Waffen eingetauscht hatte.
FitzHardings Schiff war das erste gewesen, das nach mehreren Wochen aus Bristol eingetroffen war. Die ganze Zeit hatten heftige Stürme bei aufgewühlter, weiß schäumender See donnernd an der Küste von Leinster getobt und jegliches Anlegen am Ufer unmöglich gemacht.
»Wie viel verlangt Ihr für sie?« FitzHardings Augen funkelten vergnügt, als er spaßeshalber auf Aoife deutete. Seine umgängliche Art war ein Teil seines Erfolgs, ebenso sein beispielloses Handelsgeschick. Er wusste eher, was seine Kunden wollten, als diese selbst. Seine Kundschaft setzte sich aus dem Hochadel des Landes zusammen, er belieferte Earls, Bischöfe und Könige, beschaffte finanzielle Mittel und vermittelte Darlehen. Er war ein Mann, der nicht zu den gewöhnlichen Kaufleuten zählte, da er zudem mit Waffen handelte. Schon sein Wintergewand verriet seinen Anspruch, es war aus schwerem scharlachrotem, mit Zobelpelz besetztem Tuch gefertigt.
»Ah, das wäre ein mit allen Reichtümern dieser Welt nicht zu bezahlender Preis«, erwiderte Diarmait. »Sie ist mein kostbarstes Juwel.« Er küsste seine Tochter auf die Wange und stellte sie wieder auf die Füße. Ihm wurde warm ums Herz. Seine beiden Söhne liebte er auf andere Weise. Ihr Schicksal war es, ihm als Männer und Krieger zu folgen, sie sprachen seine Härte an, wohingegen Aoife die verborgenen weichen Stellen in ihm berührte.
»Ich sehe das«, gab FitzHarding zurück. »Jeder Mann sollte so gesegnet sein.«
Diarmait setzte den Kaufmann mit einem Becher Wein vor den Kamin und ließ seinen Dolmetscher und Barden Maurice Regan kommen. Da er erkannt hatte, wie vorteilhaft es war, fremde Sprachen zu sprechen, hatte er Maurice in seine Dienste genommen, der das Normannische fließend beherrschte. Zum einen unterrichtete er ihn darin, zum anderen dolmetschte er bei Bedarf.
Diarmait füllte die Becher von Neuem. »Und wie macht sich Euer neuer König in England so?«
»Tatsächlich recht gut«, entgegnete FitzHarding. »Als ich meine Abreise vorbereitete, erfuhren wir, dass seine neue Königin ihm einen dritten Sohn geboren hat.«
»Er hat sich also als Mann bewährt«, spottete Diarmait und grinste anzüglich.
Aoife lehnte sich gegen sein Bein. Er streichelte sanft ihr dunkles Haar, dabei notierte er in seinem Gedächtnis, dass Henry drei Söhne hatte, die eines Tages heiraten würden. Warum dann nicht eine irische Prinzessin?
»Ich hoffe, er wird sich an die erinnern, die ihm geholfen haben, als er Hilfe brauchte.«
FitzHarding lächelte verbindlich. »In der Tat, und ich soll Euch Grüße von ihm überbringen.« Er reichte Diarmait einen Brief, an dem ein Siegel an einer geflochtenen roten Kordel hing.
Diarmait nahm das Pergament entgegen, entfernte mit seinem Messer sowohl die Kordel als auch das Siegel und gab beides an Aoife weiter. »Hier, Tochter«, sagte er. »Halt das gut fest, denn es ist der Beweis für das Wort des Königs.«
Sie nickte zum Zeichen, dass sie verstanden hatte, und lächelte FitzHarding schüchtern an, woraufhin dieser ihr zuzwinkerte.
Unterdessen reichte Diarmait seinem Barden das Pergament. »Lies es mir vor.« Der Brief enthielt Glückwünsche und Grüße, alles unbedeutende Worte und nichts Konkretes.
»Dem neuen König von England könnten große Vorteile erwachsen, wenn wir zusammenarbeiten.« Diarmait fuhr sich mit der Zunge über die Zähne.
»Ich bin sicher, dass er gute Beziehungen zu pflegen wünscht«, erwiderte FitzHarding glatt.
Diarmait, der selbst das Naturell eines Räubers hatte, erkannte den Ehrgeiz anderer Männer sofort. König Henry war außerdem Herzog der Normandie, Graf von Anjou und Maine und Herzoggemahl von Aquitanien. Einem solchen Mann war es zuzutrauen, dass er die ganze Welt schlucken wollte, von Irland ganz zu schweigen. Deshalb lag Diarmait, dem König der irischen Provinz Leinster, viel daran, FitzHarding weiter auszufragen, nachdem er ihn mit Speisen und etlichen Hörnern Wein redselig gestimmt hatte.
»Wie geht es Lady Derval mittlerweile?«, erkundigte sich FitzHarding mit einem lauernden Lächeln.
Sein Gastgeber drehte das lange Ende seines Bartes um seinen Zeigefinger. FitzHardings letzter Besuch hatte stattgefunden, kurz nachdem Diarmait das Land seines Feindes und Rivalen Tiernan ua Ruari, des Provinzkönigs von Bréfne, überfallen und seine Frau Derval samt all ihren Besitztümern verschleppt hatte. Dies war auf ihre Bitte hin geschehen, weil sie im Streit mit Tiernan gelegen hatte, und Diarmait hatte der Gelegenheit nicht widerstehen können, den Stolz seines Rivalen in den Schmutz zu treten.
»Es geht ihr gut«, sagte er vorsichtig, »obgleich ich sie eine Zeit lang nicht gesehen habe.«
»Uns sind Gerüchte zu Ohren gekommen, Ihr wolltet sie zu Eurer Königin machen.«
Diarmaits Augen weiteten sich in gespielter Verblüffung. »Warum sollte ich das tun, wo ich schließlich eine hübsche junge Frau mit einem fruchtbaren Schoß habe?« Sein Blick wanderte zu Môr, die mit einer Stickarbeit bei den Frauen saß. »Ihr solltet nichts auf Gerüchte geben, Master FitzHarding. Männer schmücken Geschichten immer aus«, sagte er, wobei ihn der Klatsch eigentlich nicht verdross, denn er wertete seine Tat in gewisser Weise auf – und was war ein Mann wert, wenn sein Leben nicht Stoff für derartige Geschichten lieferte? »Ich habe das einzig Ehrenhafte getan«, fuhr er fort, »und sie zur Halle ihres Vaters zurückeskortiert, wie es ihr Wunsch war.«
»Und ihr Mann?«
»Ich denke, sie sind zu einer Übereinkunft gelangt.« Diarmait betrachtete seine Fingernägel. »Die Lady ist zu ihm zurückgekehrt, zu ihren eigenen Bedingungen.« Er verschwieg, dass ein wutschnaubender und gedemütigter Tiernan seine Ländereien in Kildare zur Strafe verwüstet und wertvolles Vieh und andere Beute gestohlen hatte. Diarmait zog es vor, von seinen Siegen zu sprechen, nicht von seinen Rückschlägen. Er fand immer noch, dass die Entführung Dervals das Risiko wert gewesen war. Tiernan war zu seiner großen Freude für immer als entehrter Hahnrei gebrandmarkt, und es kümmerte ihn keine Sekunde lang, dass er sich einen Feind fürs Leben geschaffen hatte. Er gedachte nämlich, eines Tages Hochkönig von Irland zu werden, der Herrscher zu sein, der über sämtlichen Unterkönigen, Fürsten, Earls und Lords auf der Insel stand.
Aoife wusste, dass sie zu den abseits der Männer sitzenden Frauen und Kindern geschafft würde, wenn man sie entdeckte. Das passierte jedes Mal, ohne dass es sie störte. Manche Dinge lohnten das Risiko einfach, und sie liebte es, die rauen Männerstimmen zu belauschen, wenn sie Angelegenheiten besprachen, die weit über die Schwelle der Halle hinausreichten.
Als die Männer diesmal ihr Gespräch fortsetzten, war sie unter den Stuhl ihres Vaters gekrochen und hatte sich, zusammengerollt wie ein Kätzchen, unter den Falten seines schweren Umhangs versteckt. Sie konnte seine Schuhe und seine dunkelgrüne Hose sehen, seine tiefe, grollende Stimme und das Knarren hören, wenn er sich auf dem Stuhl bewegte. Sie sah noch andere Schuhe und andere Beine. Unter anderem die ihres Bruders Enna, dessen Stiefel an den Kappen so abgewetzt waren, dass ein Loch zu entstehen drohte. Neben ihrem Vater saß sein Dolmetscher und Barde Maurice Regan, der mit einem Fuß auf den Boden tappte, als würde er einer Melodie lauschen, die außer ihm niemand hören konnte.
Zur anderen Seite saß sein Besucher Robert FitzHarding aus Bristol, den ihr Vater mit reichlich Essen und Wein bewirtet hatte im Laufe des Herbstnachmittags, der langsam in den Abend überging. Seine Hose faszinierte sie, die leuchtend rot wie Blut war. Seine Schuhe waren ebenfalls rot, mit Goldborte verziert und passenden Schnürsenkeln über dem Spann. Aoife wünschte, sie hätte selbst solche Schuhe, und beschloss, ihren Vater um ein Paar zu bitten. Er konnte alles tun, was er wollte, und sie setzte alles daran, dass er seine Aufmerksamkeit ihr schenkte und nicht ihrem kleinen Bruder Connor. Er mochte ja den Vorteil haben, ein Junge zu sein, doch er war dem Babyalter kaum entwachsen und bereits eine Nervensäge, sie dagegen war ein großes Mädchen von fünf Jahren.
Zum einen betrachtete sie die Füße, zum anderen lauschte sie der Unterhaltung. Aoife liebte die Melodie und die Wortspiele der Sprache. Sie hatte die Sprachbegabung ihres Vaters geerbt und hatte von Maurice Regan und den Händlern, die an den Hof kamen, regelmäßig ein paar Brocken Latein und Normannisch aufgeschnappt.
»So«, sagte ihr Vater, und sie hörte das bärenähnliche Brummen in seiner Stimme, das Ausdruck seines Zorns war. »Euer König möchte also nach Irland kommen, es sich einverleiben und für sich beanspruchen, um unsere Kirche zu reformieren und unsere heidnischen Sitten abzuschaffen? Ah, dabei würde er am liebsten die ganze Welt verschlingen. Hat er nicht genug damit zu tun, seine eigenen Länder zu regieren, ohne die Gebiete anderer stehlen zu müssen?«
»Der Papst hat ihm einen mit seinem Siegel versehenen Brief ausgestellt, der ihn ermächtigt, in Irland eine Kirchenreform durchzuführen«, erwiderte FitzHarding, »und ihm als Unterpfand seines Willens einen Smaragdring geschickt.«
»Und seit wann verfolgt der König von England derartige Interessen?«, wollte ihr Vater wissen. »Er ist fromm, weil er das will, was es hier in Irland gibt, und das ist keine Kirchenreform.« Er gab einen unwilligen Grunzlaut von sich. »Also, wann müssen wir mit ihm rechnen?«
»Er hat diese Absicht erst einmal verschoben«, sagte FitzHarding. »Wie Ihr selbst sagt, muss er sich noch um die Neuorganisation anderer Ländereien kümmern. Ich warne Euch, er wird seine Pläne trotzdem nicht ganz fallen lassen.«
Der Stuhl ihres Vaters knarrte, als er sein Gewicht verlagerte. »Ich habe Abteien in Baltinglas und Cashiel gegründet, und ich werde hier in Ferns ebenfalls eine bauen. Wenn die Kirche eine Reform benötigt, werden wir das selbst in die Hand nehmen. Ein englischer König hat nicht das Recht, sich da einzumischen.« Aoife hörte zustimmendes Gemurmel und nickte selbst, weil ihr Vater in ihren Augen immer recht hatte.
»Das, was Ihr nicht braucht, und das, was geschieht, sind oft verschiedene Dinge«, versetzte FitzHarding. »Zudem seid Ihr ein Mann, der es versteht, aus allem, mit dem er konfrontiert wird, seinen Nutzen zu ziehen.«
»Und was für ein Nutzen sollte das sein?«
»Ich muss Euch nicht erst sagen, dass sich König Henry, sollte er nach Irland kommen, seinen Verbündeten gegenüber großzügig zeigen wird. Ihr Landbesitz würde unter seinen Schutz gestellt und gleichzeitig im Besitz der Eigentümer verbleiben. Im Übrigen würden gemeinsame Feldzüge zum Vorteil aller unternommen werden.«
»Ihr müsst mir nicht erst sagen, dass er Macht für sich selbst beanspruchen würde«, antwortete ihr Vater höhnisch.
»Nun, da es so viele andere Herrschaftsgebiete zu überwachen gilt, braucht er viele Gefolgsleute, die sich darum kümmern. Ihr seid als König von Leinster lediglich dem Hochkönig von Irland verpflichtet. Ihr würdet nur einen Mann gegen den anderen eintauschen und könntet nach Belieben selbstständig regieren, sobald Henry zu seinen anderen Territorien aufbricht. Und dann wäre noch zu bedenken, dass König Henry seinen Einflussbereich auf Dublin ausdehnen wird.«
Aoife hörte, wie es ihrem Vater den Atem verschlug. »Das ist interessant«, sagte er. »Ihr webt Euren Zauberbann wie ein Barde, und ich würde im Laufe der Zeit gern mehr von Euren Geschichten hören. Im Moment kostet es Euch nichts, mir zu berichten, dass sich Euer König entschieden hat, sein Augenmerk vorerst noch nicht auf Irland zu richten. Ihr warnt mich, dass es dazu kommen könnte.«
»Allerdings«, erwiderte FitzHarding. »Wir haben gemeinsame Interessen, und ich dachte, Ihr solltet Bescheid wissen – Freunde werden immer zuerst berücksichtigt.«
Das lauschende Kind hörte seinen Vater auf die Art lachen, wie er es tat, wenn er jemanden herausforderte, bevor er bereit war, sein Schwert zu ziehen. »Wir haben hier keine Schlangen, obwohl es wahrhaftig genug Schlangen auf zwei Beinen gibt, die sich zu gerne hier einnisten würden.«
»Da pflichte ich Euch bei«, meinte FitzHarding gleichmütig, »wobei die Art und Weise, wie Ihr die Angelegenheit handhabt, letztlich darüber bestimmt, ob Ihr überlebt oder nicht. Wenn es Euch lieber wäre, dass Eure Feinde von Schlangen gebissen werden statt Ihr selbst …«
Aoife sah, wie sich sein Bein wieder in Bewegung setzte. Ihr gefiel das Gerede von Schlangen, die einen bissen, nicht, und sie schlang die Falten des Umhangs enger um sich.
»Man muss in Gegenwart von Schlangen immer Vorsicht walten lassen, selbst wenn sie schwören, dass sie einen nicht beißen werden«, erwiderte ihr Vater. »Er hat Söhne, wie ich höre, und ich habe eine Tochter. Ich werde über Euren Rat nachdenken.«
Was er wohl damit meinte? Aoifes Lider wurden schwer, ihre Aufmerksamkeit sank. Die Unterhaltung war ein Strom unaufhörlichen Gemurmels, der über ihren Kopf hinwegflutete. Die tiefe Stimme ihres Vaters, FitzHardings Antworten, gelegentliche Einwürfe ihrer Brüder. Lachen und Schwingen des roten Schuhs unter dem Tisch, vor und zurück, vor und zurück …
Sie hörte weder, wie eine Magd ihren Vater fragte, wo sie steckte, noch bekam sie mit, wie die verzweifelte Suche sich nicht mehr allein auf die Halle erstreckte, sondern dass Kammern und Truhen und sogar Hundezwinger und Misthaufen sowie der Brunnen untersucht wurden.
Diarmait entdeckte sie, als er seinen Umhang von seinem Stuhl ziehen wollte und darin etwas Eingewickeltes am Boden spürte. Er stieß einen überraschten Laut aus, ließ sich auf Hände und Knie nieder, spähte unter den Stuhl und sah sie. »Bei der heiligen Bridget, Kind, was tust du da unten?«
Verwirrt und desorientiert rieb sie sich die Augen. Er zog sie unter dem Stuhl hervor, hob sie hoch und zupfte Halme des Bodenstrohs aus ihren Haaren. »Deine Mutter hat sich zu Tode geängstigt«, rügte er sie und schüttelte sie kurz, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen. Das Kind barg das Gesicht an dem weichen Stoff seiner Tunika.
»Ihr habt sie gefunden«, sagte FitzHarding. »Christus sei Dank.«
»Schlafend unter meinem Stuhl, ob man es glaubt oder nicht.« Diarmait stieß ein raues Lachen aus und hob ihr Kinn an. »Also gut, meine kleine Spionin, was hast du in Erfahrung gebracht?«
Aoife zog den Kopf ein. Seine Haut war feuchtwarm und roch nach Rauch. »Ich will nicht, dass mich eine Schlange beißt«, sagte sie mit zitternder Stimme.
Die Brust ihres Vaters vibrierte an ihrem Körper, als er lachte. »Aha, wir werden sehen, was wir dagegen tun können, meine kleine Prinzessin. Ich möchte genauso wenig, dass dich eine Schlange beißt. Komm jetzt, ab zu deiner Mutter.«
Die Tochter klammerte sich noch einen Moment länger an ihm fest, brannte in Wahrheit allerdings darauf, zu den Frauen und der Sicherheit ihres Bettes zurückzukehren. Daher protestierte sie nicht, als sie aus seinen Armen gezogen, begütigt und gescholten wurde.
»Lasst sie«, befahl Diarmait. Seine Stimme klang barsch und liebevoll zugleich. »Sie war nicht in Gefahr. Steckt sie ins Bett und lasst sie schlafen.«
Während die Frauen mit Aoife beschäftigt waren, nutzte er die Gelegenheit, nach seinem kleinen Sohn zu sehen, der, den Daumen im Mund, in seiner Wiege schlief. Seine Tochter, die Milch aus ihrem eigenen Kuhhornbecher trank, verging vor Eifersucht, als sie sah, wie ihr Vater Connors Kopf streichelte, als würde er ihn segnen.
»Hat FitzHarding irgendetwas Interessantes gesagt?«, fragte Môr.
Ihr Mann hob den Kopf und zuckte die Achseln. »Nur dass der König von England ein Auge auf Irland geworfen hat, ihm im Moment zum Glück die Zeit fehlt, um mehr zu tun, als uns so anzusehen, wie ein Mann das Hinterteil einer Frau ansieht, wenn sie an ihm vorbeigeht.« Er wandte sich von der Wiege ab und kam zu ihr, um einen Arm um sie zu legen und den Nacken unter ihrem Zopf zu küssen. »Und dass es in der Zukunft Raum für Ehearrangements und Brautwerbung gibt.«
»So?«
»Wirklich. Ich komme später wieder und erzähle dir alles.«
Als sie den zärtlichen Unterton in seiner Stimme hörte und sah, wie er ihre Mutter in die Taille zwickte, tat Aoife lautstark so, als würde sie sich an ihrer Milch verschlucken. Ihre Kinderfrau Ainne war augenblicklich bei ihr, schimpfte und klopfte ihr auf den Rücken. Als sie wieder aufblickte, musterte ihr Vater sie mit wissendem Blick. »Gute Nacht, mein tapferes und kostbares Mädchen«, sagte er, gab ihr einen Kuss auf die Wange und kitzelte sie mit seinem Bart. »Jetzt sei brav.«
Als er weg war, rollte sich Aoife unter dem sauberen Leinenbetttuch zusammen und ballte die Fäuste unter dem Kinn.
»Ach, meine Tochter«, sagte Môr, als sie die Marderfelldecke über ihre Schultern zog. »Was hält die Welt wohl für dich bereit?«
Aoife, die schon in den Schlaf hinüberglitt, murmelte: »Rote Schuhe.«
Ihre Mutter setzte sich neben sie und sang leise ein Schlaflied von wilden Meeren und norwegischen Wikingern, die während der Stürme gekommen waren. Ganz am Rand ihres Bewusstseins hörte das Mädchen die Kinderfrau raunen, sie hoffe, rote Schuhe würden nicht bedeuten, dass das Kind in Blut waten würde.
4
Ferns Castle, Leinster, Irland, Sommer 1159
Darauf konzentriert, keinen Tropfen zu verschütten, bot Aoife den silbernen Kelch mit Wein ihrem Onkel Lorcan dar, der zu Besuch bei ihnen weilte. Ihr Vater hatte den Kelch gestohlen, als er in seiner Jugend die Abtei von Kildare ausgeraubt hatte. Jeder kannte die Geschichte, aber niemand erzählte sie je in Gegenwart ihres Onkels, der Abt ihrer Abtei war.
Lorcans dunkles Haar kräuselte sich um seine Tonsur, und seine zwinkernden blauen Augen waren von Lachfältchen umgeben. Er war nicht übermäßig gottesfürchtig, obwohl er sich ernst und feierlich geben konnte, wenn der Anlass es erforderte. Er nahm ihr den Kelch gerade noch rechtzeitig ab, bevor der Wein über den Rand schwappte, und betrachtete ihn schweigend mit einem leicht gequälten Gesichtsausdruck.
»Du wirst langsam eine prachtvolle junge Dame, Nichte«, meinte er mit einem Lächeln. »Wie alt bist du jetzt?«
Aoife hob das Kinn. »Fast acht Jahre«, sagte sie und folgte dem Prinzip: Immer auf mehr hinweisen, nie auf weniger.
»Es ist lange her, seit ich in diesem Alter war.« Er wandte sich an Môr. »Was ist mit dir, Schwester? Erinnerst du dich noch?«
»Ich erinnere mich, dass du mir einmal eine Maus in mein Essen getan hast.« Sie sah ihre Tochter verschmitzt an. »Kannst du dir vorstellen, dass dein Onkel solche Scherze getrieben hat? Und jetzt ist er Abt.«
Aoife kicherte, war erleichtert, lachen und die Spannung abmildern zu können, mit der alle lebten, seit ihr Vater mit seiner Kriegerschar fortgeritten war. Sie hatte zugesehen, wie sich Speere und Waffen immer höher stapelten und Männer mit vor Entschlossenheit und Kampfeslust verhärteten Gesichtern herumstolzierten. Zwar verstand sie nicht genau, was vor sich ging, sie wusste bloß, dass etwas Bedeutsames in der Luft lag. Das Lächeln ihrer Mutter wirkte zunehmend verkrampfter, und sie betete wesentlich mehr als sonst.
Um sich die Aufmerksamkeit ihres Onkels zu erhalten, holte seine Nichte ihre Harfe aus Weidenholz, um für ihn zu spielen.
»Sie hat ein Talent, das über ihre Jahre hinausgeht, und eine außergewöhnliche Stimme«, erklärte Môr stolz.
Aoife stimmte die Harfe und sang eine Hymne zum Lob der Jungfrau Maria. Jeder Ton war rein und klar wie Glas, während ihre Finger zwischen den Saiten hindurchwehten wie eine sanfte Brise durch das Gras.
»Engelsgleich«, lobte ihr Onkel und wischte sich über die Augen.
»Wenn sonst nichts, so gleicht zumindest ihre Stimme denen der Engel«, meinte ihre Mutter wehmütig.
Lorcan hob die Brauen. »Sie ist Diarmaits Tochter. Kein Hindernis ist für sie zu groß. Sie wird sich voll und ganz auf das konzentrieren, was sie will – manchmal ist das gut, manchmal nicht. Vermutlich dürfte sie eher selbst zerbrechen als ihre Entschlossenheit.«
Draußen erscholl ein Horn. Orca, der Hund ihrer Mutter, hob den Kopf und knurrte, sodass sein Halsband bebte. Das Horn erklang erneut, klarer und kräftiger, und verkündete die Ankunft von Reitern. Da die Sonne bereits unterging, musste es sich um wichtigere Männer handeln als um müde Reisende.
»Es ist Daidí!« Aoifes Herz machte einen Satz wie ein im Wasserfall hochspringender Lachs. Sie ließ ihre Harfe im Stich, rannte zum Tor und erreichte es in genau dem Moment, als ein Wachposten von der anderen Seite öffnete.
»Der König ist zurück!«, verkündete er, so laut er konnte. »Siegreich! Der König ist daheim!«
Aoife schlängelte sich an ihm vorbei und stürmte in den Hof hinaus. Der Himmel war bis auf einen blutroten Streifen am Horizont kohlengrau. Berittene Männer strömten in den Hof, Speere glitzerten im letzten Licht. Aoife sah ihren Vater auf seinem großen braunen Hengst, sein Haar wehte im Wind. Am Brustband des Pferdes baumelten, an Haaren und Bart befestigt, die Köpfe feindlicher Krieger. Einer starrte sie hasserfüllt an. Einem anderen fehlte ein Ohr, und Fleischfetzen hingen von seinen zerschmetterten Wangenknochen herunter. Die Schultern des Hengstes wiesen dunkle Blutstreifen auf.
Entsetzt starrte Aoife auf das Bild, das sich ihr bot, war zugleich fasziniert, weil ihr Vater inmitten all des geronnenen Blutes auf diesem Pferd saß und mit gebleckten Zähnen lächelte. Auch Enna und Domnall trugen Trophäen an ihren Pferdegeschirren.
Eines der Tiere drehte sich zu ihr, rieb seinen Kopf an ihrer Stirn, sodass der beißende Gestank verwesenden Fleisches ihre Lunge füllte. Zum Glück kam ihr Onkel Lorcan zu ihr und schwang sie zu sich herum, um ihr Gesicht in seinem Gewand zu verbergen.
»Das ist kein Ort für dich«, sagte er streng und zog sie in die Halle zurück. Sie wand sich in seinem Griff, doch er hielt sie fest. »Ruhig, Kind. Dein Vater ist wieder zu Hause, und siegreich dazu. Geh und mach dich fertig, um ihn so gebührend zu empfangen, wie es sich für eine Angehörige seines Haushalts ziemt.«
An der Tür übergab er sie mit einem warnenden Blick an Ainne. Die Kinderfrau packte sie am Arm und führte sie zu den Frauengemächern. Vergeblich versuchte Aoife, sich loszumachen, war im Grunde froh, den Hof und das, was sie gesehen hatte, hinter sich lassen zu können. Bald würde sie mit einem strahlenden Lächeln zu ihrem Vater laufen müssen, ohne sich ihr Entsetzen anmerken zu lassen.
Die Kammerfrauen flatterten um ihre Mutter herum, halfen ihr, das beste Kleid aus violetter Wolle anzulegen, und flochten ihr goldene Bänder ins Haar.
»Warum hatte Papa all diese Köpfe am Geschirr seines Pferdes?«
»Weil er einen großen Sieg über seine Feinde errungen hat«, erwiderte ihre Mutter. »Das ist die Art, wie man mit seinen Gegnern verfährt. Dein Vater ist ein bedeutender Mann, er kommt gleich nach dem Hochkönig, und du bist eine Prinzessin.«
Aoife nahm die Worte in sich auf und fragte sich, was geschehen würde, wenn die Feinde ihres Vaters kamen, um sie zu suchen. Würden sie ihr den Kopf abschlagen und ihn an einen Sattel hängen? »Was wird mit den Köpfen passieren?«
Ihre Mutter schlang sich ihren Umhang um die Schultern. »Das hat dein Vater zu entscheiden und geht dich nichts an. Komm, zieh dein bestes Kleid an, um ihn daheim willkommen zu heißen, rasch jetzt.«
Als Aoife die Halle betrat, waren die Krieger schon mit Essen versorgt worden, hauptsächlich mit dickem Eintopf, da keine Zeit geblieben war, ein Festmahl vorzubereiten. Dafür waren die Fässer mit Wein aus Rouen und mit heimischem Met angestochen worden, und die Männer prosteten sich mit bis zum Rand gefüllten Trinkhörnern zu. Ihr Vater hatte seine Rüstung gegen eine scharlachrote Tunika und einen goldenen Stirnreif vertauscht und beherrschte von seinem mächtigen Stuhl aus die Versammlung.
»Ah, da ist ja mein Lieblingsmädchen, meine Prinzessin!«
Diarmait nahm sie der Kinderfrau ab, setzte sie auf sein Knie und ließ sie aus seinem Elfenbeinhorn trinken. Sie nahm einen zu großen Schluck und musste husten, was ihm ein dröhnendes Lachen entlockte. Das Getränk schmeckte nach Gewürzen, daher wusste sie, dass es sich um einen besonderen Anlass handelte. Die Tunika ihres Vaters duftete nach den Kräutern aus der Kleidertruhe, gepaart mit dem scharfen Geruch von Männerschweiß. Seine Arme fühlten sich hart an, und seine Augen leuchteten noch vor Kampfeslust.
»Was meinst du?«, fragte er. »Dein Papa ist ein mächtiger König, und wir haben eine große Schlacht gewonnen.« Seine Faust krachte auf den Tisch. »Niemand darf es wagen, sich gegen uns zu stellen.«
Aoife blickte sich in der Halle um und entdeckte hinter den jubelnden Männern die auf Speere aufgespießten Köpfe, die die Wände säumten. Sie presste das Gesicht in die Tunika ihres Vaters.
»Unsere Festgäste gefallen dir nicht?«
Sie schüttelte den Kopf und spürte, wie seine Brust vor Belustigung vibrierte. »Sie werden sich bald verabschieden, sie sind bloß als Zeugen hier. Dein Onkel sagt, es sei gottlos und wir müssten uns an das halten, was die Kirche vorschreibt.« Sein Blick wanderte zu Lorcan. »Ich habe versprochen, dass ich als Wiedergutmachung hier eine Abtei bauen werde, und dein Onkel mag die Toten so begraben, wie er es wünscht.« Er hob sie von seinem Knie und reichte sie Ainne zurück. »Geh jetzt, Kind, und vergiss nicht, dass sie dir nichts zuleide tun können, solange ich hier bin, um dich zu beschützen.«
In dieser Nacht träumte Aoife, die Köpfe würden in ihr Bett starren und ihre Kiefer beim Sprechen wackeln. Wie konnte das sein, wenn die Stimmbänder der Männer durchtrennt waren? Sie wachte vor nacktem Entsetzen auf, schnappte nach Luft, erstickte dabei jedes Geräusch, damit die Köpfe sie nicht hören konnten, denn ihre Ohren hatten sie ja noch. Dann rollte sie sich herum und vergrub das Gesicht in der Matratze. Ihre Blase war voll, und sie erwog kurz, lieber das Bett nass zu machen, als es zu verlassen- Sie tat es nicht, weil sie wusste, dass es ihr eine Strafe eintragen würde.
Zitternd kroch sie unter der warmen Sicherheit ihrer Decken hervor und tappte zu dem Topf hinüber. Die Tür stand einen Spaltbreit offen, und als sie sich hinhockte, stellte sie sich vor, was aus der anderen Welt vielleicht um den Türrand herumkommen könnte. Sie kniff die Augen fest zu, packte mit beiden Fäusten ihre Haare und zerrte daran, bis der Schmerz stärker war als ihre Angst.