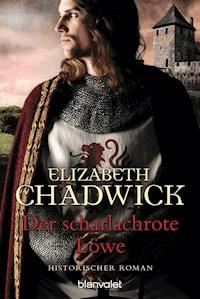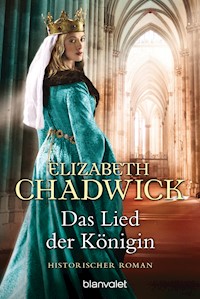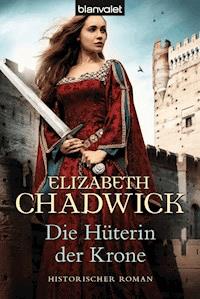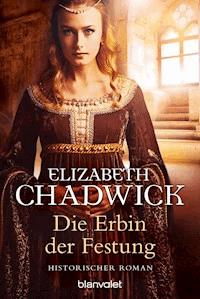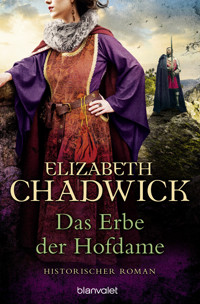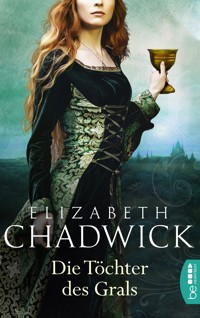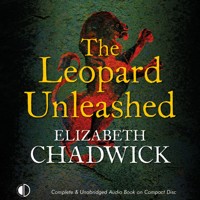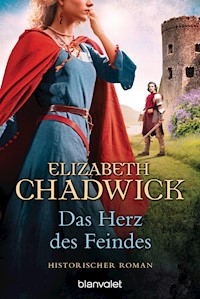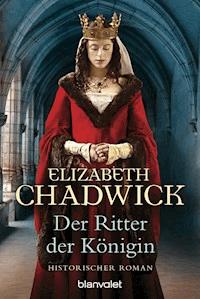
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
England im 12. Jahrhundert: Für den jungen Adeligen William Marshal nimmt das Leben eine entscheidende Wende, als er der faszinierenden Eleonore von Aquitanien das Leben rettet. Fortan ist er Ritter in ihrem persönlichen Gefolge und Tutor des Thronfolgers. Doch in der Gunst der Königin zu stehen, ruft auch viele Neider auf den Plan. Und so muss einer der edelsten und loyalsten Ritter der englischen Geschichte im bewegten 12. Jahrhundert hässliche Intrigen erleiden, viele Kämpfe überstehen und mehreren Herren dienen - bis er endlich die Liebe seines Lebens finden kann …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 838
Ähnliche
Buch
William Marshal, ein mittelloser junger Ritter aus niederem englischem Adel, betritt die Bühne des Weltgeschehens, nachdem er das Leben einer der aufregendsten Frauen des Mittelalters, Eleonore von Aquitanien, rettete. William ist tief beeindruckt von der faszinierenden Frau des englischen Königs Heinrich II. Aus Dankbarkeit beruft diese ihn zum Ritter in ihrem persönlichen Gefolge und ernennt ihn zum Tutor des Thronerben. Aber die Gunst der Königin zu genießen, beschert einem nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch jede Menge Neid. Nachdem Heinrich 1170 von seinem Vater noch zu dessen Lebzeiten zum König gekrönt wird, erwachsen Spannungen im Hause Plantagenet. Auch wenn William den Machthunger des jungen Königs nicht gutheißt, folgt er ihm loyal in eine Schlacht gegen dessen eigenen Vater. Williams Einfluss auf Heinrich ist missgünstigen Höflingen ein Dorn im Auge, und so setzen sie das Gerücht in die Welt, William habe eine Liaison mit der jungen Gattin des Königs. Trotz all der Jahre unbedingter Treue will Heinrich seinen Ritter William in der Sache nicht einmal anhören. So verlässt William zutiefst enttäuscht den Hof und macht sich auf nach Jerusalem. Einige Zeit später kehrt er an Heinrichs Hof zurück. Da lernt er in London in der schönen und wohlhabenden Isabelle de Clare endlich die Frau seines Lebens kennen. Während William nun eine Zeit des privaten Glücks erlebt, braut sich über England neues Unheil zusammen. Richard Löwenherz, Eleonores Lieblingssohn, geht auf Kreuzzug nach Jerusalem. Das nutzt sein jüngerer Bruder Johann, um seine Macht auszubauen…
Autorin
Elizabeth Chadwick lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in Nottingham. Sie hat zahlreiche historische Romane geschrieben, deren Handlung stets im höfischen Mittelalter angesiedelt ist. Vieles von ihrem Wissen resultiert aus ihren Recherchen als Mitglied von Regia Anglorum, einer renommierten historischen Vereinigung, die das Leben und Wirken der Menschen im frühen Mittelalter nachstellt und so Geschichte lebendig werden lässt.
Inhaltsverzeichnis
1
Festung von Drincourt, Normandie,Sommer 1167
In der dunklen Stunde kurz vor Tagesanbruch waren die Fensterläden der großen Halle noch fest vor den Unbilden der Nacht geschlossen, und die letzte Glut unter der mächtigen Esse über der Feuerstelle erinnerte an das erloschene Auge eines Drachens. Auf den zahlreichen Strohsäcken entlang den Wänden gewahrte man die Umrisse der schlafenden Ritter und Gefolgsleute. Ihre Atemzüge erfüllten die Luft mit leisem Seufzen, von Zeit zu Zeit hallte auch ein kehliges Schnarchen durch den Raum.
Auf einem der ungemütlicheren Plätze am äußersten Ende der großen Halle, nahe beim zugigen Tor und weitab vom heimeligen Feuer, wälzte sich ein junger Mann schlaftrunken hin und her. Er runzelte die Stirn, als er im Traum aus der mächtigen normannischen Festung in die sehr viel kleinere, vertraute Halle von Hamstead, der Burg seiner Familie in Berkshire, zurückgetragen wurde.
Im Traum war er gerade einmal fünf Jahre alt. Er trug seine beste blaue Tunika, und seine Mutter presste ihn an ihren Busen, während sie ihm mit beinahe versagender Stimme einschärfte, sich gut zu benehmen. »Denk immer daran, dass ich dich liebe, William.« Der Kleine bekam kaum Luft, so fest drückte sie ihn an sich. Als sie ihn endlich losließ, rang er nach Atem – und sie um Fassung. »Küss mich und dann geh mit deinem Vater«, sagte sie.
Der kleine William drückte die Lippen auf die weiche Wange seiner Mutter und sog ihren Duft ein. Den süßen Duft nach frisch gemähtem Gras. Plötzlich wollte er nicht mehr fort. Sein Kinn begann zu zittern.
»Hört auf zu weinen, Frau. Ihr macht ihm nur Angst.«
William spürte, wie sich die Hand seines Vaters hart und unerbittlich auf seine Schulter legte. Mitten im von der Sonne durchfluteten Raum, in Gegenwart aller Mitglieder des Haushalts, drehte er ihn zu sich herum. Seine drei großen Brüder Walter, Gilbert und John verfolgten die Szene mit ernsten Mienen. Johns Lippen bebten ebenfalls.
»Bist du bereit, mein Sohn?«
William hob den Blick. Geschmolzenes Blei vom Dach einer brennenden Kirche hatte das rechte Auge seines Vaters zerstört. Obendrein hatte das heiße Metall eine grausige Narbe von der Stirn bis zur Wange in die Haut gegraben, sodass die eine Hälfte seines Gesichts einer wahren Teufelsfratze nahekam, während die andere dem Antlitz eines Engels glich. Da William seinen Vater jedoch nicht ohne diese Male kannte, erwiderte er seinen Blick fest.
»Ja, Sir«, gab er zurück und wurde durch ein kurzes Aufleuchten in den Augen seines Vaters belohnt.
»Braver Junge.«
Unten im Burghof warteten bereits die Stallburschen mit den Pferden. John Marshal schob seinen Fuß in den Steigbügel und schwang sich auf seinen Hengst. Dann beugte er sich hinunter, zog den kleinen William empor und setzte ihn vor sich in den Sattel. »Denke immer daran, dass du der Sohn des königlichen Hofmarschalls und Neffe des Earl of Salisbury bist.« Er gab seinem Pferd die Sporen, und bald darauf trabten sie zusammen mit ihren Begleitern durch das Burgtor hinaus. Dabei beobachtete er die von vielen Schlachten gezeichneten, großen Hände seines Vaters, die vor ihm die Zügel hielten, und darüber die leuchtend bunte Stickerei an den Ärmeln seiner Tunika.
»Werde ich lange wegbleiben?«, fragte die kleine Traumgestalt mit heller Kinderstimme.
»Das hängt davon ab, wie lange König Stephan dich behalten möchte.«
»Warum will er mich denn haben?«
»Weil ich ihm etwas versprochen habe. Du sollst so lange beim König bleiben, bis mein Versprechen erfüllt ist.« Die Stimme des Vaters klang so rau wie eine Schwertklinge auf dem Wetzstein. »Sozusagen als Pfand für meine Ehre.«
»Und was habt Ihr ihm versprochen?«
William spürte erneut, wie sich die Brust seines Vaters ruckartig zusammenkrampfte, und vernahm eine Art Grunzen, das fast an ein Lachen erinnerte. »Etwas, das nur ein Dummkopf von einem Verrückten fordern würde.«
Eine merkwürdige Antwort. Der kleine William drehte sich um und sah zum entstellten Gesicht seines Vaters empor, während sich der große William wieder unruhig auf seiner Schlafstatt herumwälzte. Die Furchen auf seiner Stirn vertieften sich, und die Augäpfel rollten hinter den Lidern heftig hin und her, als die Stimme seines Vaters im Nebel des Traums verklang und er stattdessen hörte, wie eine Frau und ein Mann in der Nähe miteinander stritten.
»Der Bastard ist auf Ehrenwort heimgekehrt, hat seine Burg befestigt, sie bis zum Dachstuhl mit Männern und Vorräten vollgestopft und sämtliche Breschen abgesichert.« Verachtung schwang in der rauen Stimme mit. »Der hatte niemals vor, sich zu ergeben.«
»Aber was wird jetzt aus seinem Sohn?«, flüsterte die Frau mit banger Stimme.
»Das Leben des Kleinen dient dem König als Pfand. Der Vater sagt jedoch, dass ihn das nicht schere und er noch Manneskraft genug besäße, um weitere und bessere Söhne zu zeugen als diesen einen, den er nun womöglich verlieren wird.«
»Das meint er doch nicht im Ernst …«
Der Mann spuckte aus. »Ich rede von John Marshal – und der ist ein verrückter Hund. Niemand weiß, wozu der imstande ist. Aus diesem Grund hat sich der König ja den Jungen als Pfand ausbedungen.«
»Aber Ihr … Ihr werdet doch nicht … das könnt Ihr nicht tun!« Vor Entsetzen wurde die Stimme der Frau immer lauter.
»Nein, nein, ich doch nicht. Das hat allein der König mit seinem Gewissen zu entscheiden. Und der verfluchte Vater. Das Essen brennt an, Frau. Kümmert Euch lieber um Eure Pflichten.«
Im nächsten Moment wurde die kleine Traumgestalt am Arm gepackt und unsanft durch ein weitläufiges Feldlager gezerrt. William spürte den bläulichen Rauch, der aus den Feuerstellen quoll, in der Nase kitzeln und beobachtete, wie die Soldaten ihre Waffen schärften. Eine Gruppe Söldner baute etwas zusammen, das, wie er heute wusste, eine Steinschleuder war.
»Wohin gehen wir?«, fragte er.
»Zum König.« Plötzlich trat das bisher verschwommene Gesicht des Mannes in aller Deutlichkeit hervor. Unter der lederbraunen Haut zeichneten sich scharfkantige Knochen ab. Der Mann hieß Henk. Ein flämischer Söldner in Diensten König Stephans.
»Und warum?«
Ohne ein weiteres Wort bog Henk unvermittelt nach rechts ab, wo zwischen einer Belagerungsmaschine und einem geräumigen Zelt aus blau und gold gestreiftem Tuch einige Männer beisammenstanden und sich miteinander unterhielten. Zwei Wachsoldaten versperrten Henk und William mit ihren Lanzen den Weg, doch als sie den Söldner erkannten, traten sie zurück und winkten die beiden durch. Nach zwei weiteren Schritten sank Henk auf die Knie und zog William mit sich auf die Erde. »Sire.«
William wagte einen kurzen Blick durch seine fransigen Haare, da er nicht erkennen konnte, welchen der Männer Henk angesprochen hatte. Keiner von ihnen trug eine Krone oder sah so aus, wie er sich einen König vorstellte. Lediglich einer der Lords hielt eine Lanze in der Hand, an der ein seidenes Banner befestigt war.
»Dies ist also der Junge, der seinem Vater nicht mehr als einen läppischen Zeitgewinn wert war«, bemerkte der Mann neben dem Lanzenträger. Sein helles Haupthaar ergraute bereits, seine Züge waren zerfurcht und sorgenvoll. »Steh auf, Junge. Wie heißt du?«
»William, Sir.« Die kleine Traumgestalt erhob sich artig. »Seid Ihr der König?«
Überrascht zwinkerte der Mann einige Male. Dann zog er die Brauen über den blassblauen Augen zusammen und presste die Lippen aufeinander. »Ja, der bin ich – fürwahr. Auch wenn dein Vater das zu bezweifeln scheint.« Einer der Lords beugte sich zu ihm hinüber und flüsterte etwas in sein Ohr. Der König lauschte, dann schüttelte er heftig den Kopf. »Nein«, sagte er.
Ein Windstoß ließ das seidene Banner flattern, sodass der daraufgestickte rote Löwe sich zu strecken und zu räkeln schien. Der Anblick fesselte den Jungen. »Darf ich die Lanze einmal halten?«, fragte er voller Eifer.
Der Lord runzelte die Stirn. »Als Bannerträger scheinst du mir ein bisschen klein, mein Junge.« Er schmunzelte und übergab William dann zögerlich die Lanze. »Also sei vorsichtig.«
Der Griff war noch warm, als Williams kleine Faust sich darum legte. Er schwenkte die Lanze hin und her und lachte vor Begeisterung, als das Banner durch die Luft zischte.
Inzwischen hatte sich der König von seinem Ratgeber abgewandt und vollführte negierende Gesten.
»Sire, falls Ihr Euch jetzt erweichen lasst, werdet Ihr nur John Marshals Verachtung ernten …«, wiederholte der Höfling.
»Bei Christus am Kreuz! Ich würde meine Seele ins Fegefeuer stürzen, wollte ich dieses unschuldige Wesen für die Untaten seines Erzeugers hängen! Seht ihn Euch doch nur an … seht nur!« Mit dem Zeigefinger deutete der König auf den Jungen. »Nicht um alles Gold der Christenheit werde ich diesen Jungen am Galgen aufknüpfen! Seinen Höllenhund von Vater ja, aber nicht ihn.«
Ohne zu ahnen, in welcher Gefahr er schwebte, wirbelte William die Lanze durch die Luft.
»Komm her, Junge.« Der König winkte ihn zu sich. »Du gehst jetzt in mein Zelt und wartest dort, bis ich entschieden habe, was mit dir geschehen soll.«
William war nicht allzu enttäuscht, als er das Spielzeug an seinen Besitzer zurückgeben musste, der sich später als Earl of Arundel entpuppte. Dafür durfte er schließlich das aufregende gestreifte Zelt betreten, in dem sich vielleicht noch andere Waffen befanden. Und womöglich sogar mit diesen spielen – mit den Waffen des Königs. In freudiger Erwartung eilte er an dessen Seite.
Vor dem Zelt standen zwei Ritter in voller Rüstung auf Posten, außerdem waren dem König mehrere Diener und Knappen zu Diensten. Den Eingang deuteten zwei schmale Stoffbahnen an, die man zur Seite geschlagen hatte. Der Boden innerhalb des Zelts war mit frisch gemähtem Gras bestreut, sodass die Luft im Inneren betäubend duftete. Neben dem großen Bett des Königs, auf dem zahlreiche bestickte Polster und Kissen aus Seide lagen ebenso wie flauschige Felldecken, stand genau wie im Zimmer seiner Eltern in Hamstead eine verzierte Truhe. Außerdem fanden auch noch eine Bank und ein Tisch mit silberner Karaffe und Bechern Platz. Zwei graue gekreuzte Stangen trugen die glänzend polierte Rüstung des Königs, obenauf thronte der Helm. Schild und Schwertscheide lehnten an der Konstruktion. Sehnsüchtig betrachtete William die prächtige Rüstung.
Der König lächelte. »Möchtest du eines Tages auch ein Ritter werden, William?«
Der Junge nickte eifrig, und seine Augen leuchteten.
»Und deinem König die Treue schwören?«
Wieder nickte William. Dieses Mal verriet ihm sein Instinkt, was von ihm erwartet wurde.
»Ich muss nachdenken.« Seufzend bedeutete der König einem Knappen, einen der Becher mit blutrotem Wein zu füllen. »Junge, sieh mich an.«
William hob den Kopf. Der harte Blick des Königs erschreckte ihn ein wenig.
»Ich möchte, dass du dich später genau an diesen Tag erinnerst«, erklärte König Stephan langsam und deutlich. »Du sollst wissen, dass ich dir trotz allem, was dein Vater mir angetan hat, erlaube, erwachsen zu werden und seinen Fehler auszugleichen. Präge dir den folgenden Satz auf ewig ein: Ein König schätzt die Treue höher als alle anderen Tugenden.« Er trank einen Schluck und drückte dann den Becher in Williams kleine Hände. »Trink und versprich mir, dass du dich immer an diesen Tag erinnern wirst.«
William gehorchte, obgleich der Wein wie Feuer in seinem Hals brannte.
»Versprich es mir«, wiederholte der König, als er den Becher wieder an sich nahm.
»Ich verspreche es«, sagte der kleine William. Und als ihm der Wein glühend heiß in den Magen fuhr, war der Traum mit einem Mal zu Ende.
Der erste Hahn krähte, und die Schlafenden in der großen Halle von Drincourt wurden langsam munter. Auch William schlug leise stöhnend die Augen auf. Einige Augenblicke lang verharrte er ganz still und versuchte, sich in seiner Umgebung zurechtzufinden. Es war längere Zeit her, seit ihn seine Träume zuletzt in den Sommer der Schlacht um Newbury zurückversetzt hatten, die er als Geisel auf König Stephans Seite miterlebt hatte. Im Wachen dachte er so gut wie nie mehr daran zurück. Doch es war kein besonderer Anlass nötig – und schon wurde aus dem gerade Zwanzigjährigen im Traum wieder der kleine blonde Junge von fünf Jahren.
Trotz all seines Geschickes und trotz der Bereitschaft, seinen viertgeborenen Sohn zu opfern, hatte Williams Vater die Burg von Newbury damals nicht halten können und in der Folge auch die Lehnsherrschaft über Marlborough eingebüßt. Doch trotz alledem hatte sich letztlich das Schicksal zu seinen Gunsten gewendet. König Stephan war ohne Erben ins Grab gesunken, und Kaiserin Matildas Sohn Heinrich, der Spross ihrer zweiten Verbindung mit Gottfried Plantagenet von Anjou, saß als Heinrich II. seit nunmehr dreizehn Jahren fest auf dem englischen Thron.
»Und ich wurde vor kurzem zum Ritter geschlagen«, murmelte William. Ein bitteres Lächeln umspielte seine Lippen, wenn er an seine Knappenzeit zurückdachte, als er Rüstungen poliert, Botengänge erledigt und sich unter der Anleitung von Guillaume de Tancarville, dem Großkämmerer der Normandie und entfernten Verwandten seiner Mutter, alle Fertigkeiten seines zukünftigen Handwerks angeeignet hatte. Die Schwertleite hatte ihn endlich unter die erwachsenen Männer eingereiht und ihn auf einer äußerst schlüpfrigen Leiter eine Stufe nach oben befördert. Dadurch war sein Verbleib im Gefolge de Tancarvilles jedoch nicht sicherer geworden. Im Grunde hatte Lord Guillaume keinen Platz für frisch geschlagene Ritter, die sich noch nie in einem wirklichen Gefecht hatten beweisen müssen.
Für kurze Zeit hatte William mit dem Gedanken geliebäugelt, nach Hamstead zurückzukehren und sich seinem Bruder John als Verteidiger des Familienbesitzes zur Verfügung zu stellen. Doch im Grunde betrachtete er die heimatliche Burg eher als letzte Zuflucht, und obendrein fehlten ihm die Mittel, um die Rückfahrt über die Meerenge nach England zu bezahlen. So gesehen boten die ständigen Zwistigkeiten zwischen der Normandie und Frankreich die beste Gelegenheit, gleich an Ort und Stelle die notwendigen Erfahrungen und Fertigkeiten zu erwerben. Überall entlang der Grenze versuchten französische Truppen in die Normandie vorzudringen, wobei sie große Verwüstungen anrichteten. Da die Festung von Drincourt die nördlichen Straßen in Richtung Rouen absicherte, waren gerade hier bewaffnete Verteidiger dringend erforderlich.
Während die Traumbilder langsam verblassten, glitt William in eine Art Dämmerschlaf, und endlich lockerte sich auch seine Anspannung. Das Blondhaar seiner Kinderzeit war im Lauf der Jahre etwas nachgedunkelt und hatte inzwischen fast einen kastanienbraunen Ton angenommen. Aber im Sommer zauberte die Sonne noch immer goldene Strähnen hinein. Wer John Marshal gekannt hatte, der bemerkte stets, dass der Sohn seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten war – bevor das schmelzende Blei des Daches von Wherwell Abbey dessen Züge verunstaltet hatte. Außerdem war ihnen die dunkelgraue Iris gemein, die sich wie das lebhafte Farbenspiel eines winterlichen Flusses ständig änderte.
»Guter Gott! Ich gehe jede Wette ein, dass du sogar die Trompeten des Jüngsten Gerichts verschläfst. Steh endlich auf, du fauler Kerl.« Die laute Stimme wurde von einem unsanften Knuff begleitet. Stöhnend schlug William die Augen auf, um Gadefer de Lorys zu erblicken, einen von de Tancarvilles älteren Rittern, der sich über ihn beugte.
»Ich bin doch längst wach.« Er dehnte seinen Brustkorb und setzte sich auf. »Darf ein Mann nicht einmal seine Gedanken sammeln, ehe er aufsteht?«
»Ha! Die würdest du noch bei Sonnenuntergang suchen, wenn man dich ließe. Ein solcher Langschläfer ist mir noch nie untergekommen. Wenn du nicht mit unserem Lord verwandt wärst, hätte ich dich längst mit einem Tritt an die Luft befördert!«
Es war allgemein bekannt, dass Gadefer morgens immer schlecht gelaunt war. Am besten stimmte man ihm in allem zu und machte, dass man schnell fortkam. William wusste, dass einige der Ritter nicht gut auf ihn zu sprechen waren, weil sie um ihren Platz in de Tancarvilles Gefolge fürchteten. So gesehen war seine Verwandtschaft mit dem Lordkämmerer ebenso hinderlich, wie sie andererseits von Vorteil war. »Ihr habt recht«, sagte er und grinste entschuldigend. »Ich werde mich also höchstselbst an die frische Luft befördern und mich lieber meinen Reitübungen widmen.«
Brummelnd stapfte Gadefer davon. William schnitt verstohlen eine Grimasse. Dann rollte er seinen Strohsack zusammen, faltete die Decke und ging nach draußen. Beinahe meinte er schon den feinen Staub des Mittsommertags riechen zu können, obgleich sich noch die Feuchte der Nacht im Schatten der Wälle hielt. Sie würde erst durch die Kraft der aufgehenden Sonne von den mächtigen Mauern vertrieben werden. Er blickte kurz zu den Ställen hinüber, doch dann besann er sich eines Besseren und folgte zunächst einmal seinem knurrenden Magen in die Küche jenseits des Hofs.
Die Köche der Festung waren an Williams häufige Besuche gewöhnt, und so dauerte es nicht lang, bis er an einem der Tische lehnte und gierig ein noch ofenwarmes Brot mit schmelzender Butter und süßem Kleehonig verzehrte. Die Frau des Kochs schüttelte nur den Kopf. »Gott weiß, wohin Ihr das alles steckt. Würde es mit rechten Dingen zugehen, dann müsste Euer Bauch so rund sein wie der einer Frau kurz vor der Niederkunft.«
Grinsend klopfte William auf seinen flachen Bauch. »Ich arbeite eben hart.«
Mit einem tiefen Blick, der mehr sagte als viele Worte, wandte sich die Frau wieder ihrer Arbeit zu und hackte weiter Gemüse klein. Genüsslich leckte sich William die letzten Honigtropfen von den Fingern, stützte sich gegen den Türbalken und sah in den wunderschönen Sommertag hinaus. Doch plötzlich wurde die friedliche Stille des Burghofs jäh von lautem Rufen unterbrochen. Gleich darauf eilte der Earl of Essex in voller Rüstung quer über den Hof zu den Ställen. Weitere Ritter und Sergeanten folgten ihm auf dem Fuße. William stürzte ihnen nach. »Was ist los?«, rief er. »Was ist geschehen?«
Einer der Ritter sah über die Schulter zurück. »In den Außenbezirken der Stadt wurden Franzosen und Flamen gesichtet!«, keuchte er.
Seine Worte durchzuckten William wie ein Blitz. »Sie haben die Grenze überschritten?«
»Genau. Sie haben die Bresle überquert und sind von dort aus nach Eu marschiert. Inzwischen stehen sie vor unseren Mauern. Matthew of Boulogne führt sie an. Lauf und hol deine Waffen, Marshal. Das Essen muss vorerst warten.«
In riesigen Sätzen rannte William zurück in die große Halle. Sein Herz hämmerte wie verrückt. Mit einem Mal war ihm übel, und er wünschte, nicht so viel Brot und Honig in sich hineingestopft zu haben. Ein Knappe stand schon bereit, um ihm beim Anlegen des wattiertes Wamses und des Kettenhemds zu helfen. Guillaume de Tancarville lief in seinem Harnisch rastlos auf und ab und stieß mit schnarrender Stimme knappe Kommandos aus, während seine Ritter in großer Eile ebenfalls ihre Rüstungen anlegten.
William presste die Lippen zusammen. Seine Übelkeit steigerte sich für kurze Zeit, ehe sie endlich abebbte. Als er in sein Kettenhemd schlüpfte, beruhigte sich auch sein Herzschlag. Doch seine Handflächen waren noch immer von kaltem Schweiß bedeckt, sodass er sie an seinem Wams abwischen musste. Dies war der Moment, auf den er sich seit so vielen Jahren vorbereitet hatte. Endlich konnte er beweisen, dass sehr viel mehr in ihm steckte als ein gefräßiger Langschläfer und dass er seinen Platz im Gefolge allein seinen Fähigkeiten und nicht den verwandtschaftlichen Beziehungen verdankte.
Als sich Guillaume de Tancarville und seine Ritter an der westlichen Brücke mit den Männern des Earl of Essex vereinigten, hatten die flämischen Söldner bereits den vorgelagerten Teil der Stadt in ihre Gewalt gebracht. Überall flohen ihre entsetzten Bewohner um ihr Leben. Der Rauch der Herdfeuer wurde vom beißenden Qualm willkürlich gelegter Brände überlagert, und in der Rue Chaussée rotteten sich die Ritter aus Boulogne zusammen, um das westliche Tor zu erstürmen und in die Stadt selbst einzudringen.
Nervös und zum Äußersten entschlossen drängte William seinen Hengst an einigen anderen Rittern vorbei ganz nach vorn, bis er sich auf derselben Höhe wie de Tancarville befand. Mit einem warnenden Blick parierte dieser sein Schlachtross, als es gegen Williams schweißglänzenden Braunen auskeilte. »Du bist zu stürmisch, mein Junge«, brummte er verärgert und belustigt zugleich. »Lass dich lieber zurückfallen und mach den Rittern Platz.«
William wurde feuerrot und schluckte gekränkt seinen Protest hinunter, dass er ebenfalls ein Ritter sei. Mit finsterer Miene ließ er drei der erfahrensten Männer vorbei, doch ehe noch ein vierter folgen konnte, gab er seinem Braunen die Sporen und drängte mit Feuereifer wieder nach vorn.
Mit einem lauten »Tancarville!« auf den Lippen sprengte der Großkämmerer seinen Männern voran über die Brücke und die Rue Chaussée entlang den heranbrandenden Truppen aus Boulogne entgegen. William presste seinen Schild eng an den Körper, senkte die Lanze und ließ dem Braunen seinen Willen. Sein Blick erfasste die roten Farben eines Ritters auf einem schwarzen Hengst, und er ließ das Ziel keine Sekunde mehr aus den Augen, während ihn sein Schlachtross in gestrecktem Galopp dem Zweikampf entgegentrug. Blitzschnell erfasste William, dass der Gegner die Lanze nicht völlig flach ausgerichtet hatte und der rote Schild leicht nach innen geneigt war. Er packte den Lanzenschaft fester und hielt die Augen bis zum letzten Moment weit geöffnet. Als seine Waffe mit voller Wucht gegen den Schild prallte und ihn durchbohrte, brach der Schaft seiner Lanze. Doch der Stoß war heftig genug, um den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Mit dem Holzstumpf schlug William wie mit einem Knüppel zu und stieß den Mann aus dem Sattel. Als der schwarze Hengst daraufhin mit schleifenden Zügeln durchging, zog William sein Schwert.
Nach dem ersten heftigen Zusammenprall der Gegner folgten rasch einzelne Gefechte Mann gegen Mann. Rein gar nichts in seiner Ausbildung hatte William auf die Verbissenheit und Wucht dieser Kämpfe vorbereitet. Trotzdem ließ er sich nicht abschrecken, sondern stürzte sich voller Eifer ins Getümmel. Und sein Zutrauen wuchs, je öfter er als Sieger aus einem Gefecht mit einem viel erfahreneren Ritter hervorging. William war entsetzt und zugleich völlig beschwingt: Er fühlte sich wie ein Fisch, der aus einem stillen Teich in einen blitzschnell dahinschießenden Fluss entschlüpft war.
Der Count de Boulogne brachte ständig weitere Männer ins Gefecht, sodass eine verzweifelte Schlacht um die Brücke entbrannte. Die Einwohner der Stadt unterstützten die Soldaten der Festung nach Kräften mit ihren Knüppeln und Steinschleudern, und lange Zeit wogte das Glück wie die Wellen in der Brandung abwechselnd von einer Seite auf die andere. Das Ganze war ein mühsames, grausiges Schauspiel. Irgendwann konnte William das Schwert kaum noch in seiner von Schweiß und Blut triefenden Hand halten.
»Tancarville!«, brüllte er heiser, während er seinen Braunen ein weiteres Mal herumriss, um einen französischen Ritter anzugreifen. Der Hengst seines Gegners scheute und warf seinen Reiter in den Staub, wo dieser reglos liegenblieb. William entriss dem Gefallenen die Lanze und steuerte seinen Braunen auf eine Gruppe flämischer Söldner zu, die gerade im Begriff waren, eines der Häuser zu plündern. Einer der Männer hatte eine Truhe auf die Straße gezerrt und schlug mit dem Schwertgriff donnernd gegen ihr Schloss. Auf den warnenden Zuruf seiner Gefährten hin sauste er herum, aber Williams Lanze war schneller und hatte bereits seine Brust durchbohrt. Sofort kesselten die anderen William ein und versuchten, ihn vom Pferd zu zerren.
William riss den Hengst herum, verschanzte sich hinter seinem Schild und schlug mit dem Schwert in alle Richtungen auf die Angreifer ein, bis einer von ihnen einen stählernen Fischhaken zu fassen bekam, der an einer Hausmauer lehnte. Sekunden später drang die Spitze der ungewöhnlichen Waffe an der Schulter durch Williams Kettenhemd, und der Haken sprengte einige der eisernen Ringe. Er bohrte sich durch Wams und Tunika tief in Williams Fleisch. Vom Kampfgetümmel aufgewühlt, verspürte der Ritter keinerlei Schmerz, so heftig kreiste sein Blut durch die Adern. Als die Gegner ihn erneut einkreisten und seine Zügel zu packen versuchten, um ihn endgültig vom Pferd zu zerren, bohrte William dem Hengst die Sporen in die Weichen, woraufhin das Tier heftig auskeilte. Ein Schrei ertönte, als der mit Eisen beschlagene Hinterhuf auf Fleisch traf und einer der Gegner wie ein Stein zu Boden ging. William klammerte sich an den Brustriemen des Braunen und setzte erneut die Sporen ein, doch dieses Mal ein Stück weiter vorn. Der Hengst stieg in die Höhe und schoss mit einem gewaltigen Satz nach vorn, sodass die flämischen Soldaten die Zügel fahren lassen und zur Seite hechten mussten, um nicht unter die Hufe zu geraten. Der Söldner, der sich noch immer an den Fischhaken klammerte, taumelte, worauf William sein Pferd wendete und sich auf den Angreifer stürzte. Unter Tränen stieß er den Namen seines Lords hervor und vollführte einen heftigen Streich mit seinem Schwert. Er sah, wie der Mann fiel, und zwang seinen Braunen, den Körper in den Staub zu treten. Als er dem schlimmsten Getümmel entronnen war, schloss er sich wieder den Rittern Tancarvilles an. Sein Brauner jedoch hatte eine tiefe Wunde am Hals davongetragen, und die Zügel waren glitschig vor lauter Blut.
Inzwischen hatte der Feind die Soldaten der Festung bis an die Brücke zurückgedrängt. Rauch und Feuer hatten die Außenbezirke in einen Vorhof der Hölle verwandelt, doch die Stadt selbst war noch unversehrt, und die französische Armee rannte noch immer ebenso heftig gegen die normannische Besatzung an, wie die Brandung gegen die Granitfelsen an der Küste schlug. Während William wie wild einen Hieb nach dem anderen austeilte, tanzten helle Flecken der Erschöpfung vor seinen Augen. Von Kriegskunst war in diesem Kampf nicht mehr viel zu erkennen. Es ging lediglich noch darum, die nächste Attacke zu überleben. Und die nächste … Darum, standzuhalten und keinen Schritt zurückzuweichen. Jedes Mal, wenn William dachte, dass nun das Ende gekommen sei, überwand er sich aufs Neue und fand wieder Kraft, um noch ein weiteres Mal auf die Gegner einzuschlagen.
Irgendwann schallte lauter Hörnerklang über die Köpfe der verbissenen Kämpfer hinweg – und dann verebbte der Angriff der Gegner abrupt. Der Franzose, der William soeben noch übel zugesetzt hatte, ließ von ihm ab. »Sie blasen zum Rückzug!«, keuchte einer von de Tancarvilles Rittern. »Beim Blut Unseres Herrn, sie hauen ab! Tancarville! Tancarville!« Und schon gab er seinem Schlachtross die Sporen. Als William begriff, was da vor sich ging, erwachten seine ermatteten Glieder zu neuem Leben. Und als sein Hengst unter ihm zu wanken begann, sprang er unerschrocken aus dem Sattel, um die Verfolgung zu Fuß fortzusetzen.
Auf der Flucht vor den aufgebrachten Einwohnern hetzten die Franzosen durch die brennende Vorstadt von Drincourt. Ständig mussten sie sich in kleinen Scharmützeln der Ritter und normannischen Burgsoldaten erwehren. Irgendwann bekam William keine Luft mehr und brach erschöpft über dem Zaun eines Schafpferchs zusammen. Seine Kehle brannte, solchen Durst hatte er, und sein Schwert war durch die zahllosen Hiebe auf Rüstungen und Kettenhemden ganz schartig. Er nahm den Helm ab und tauchte seinen Kopf tief in den steinernen Trog. Dann schöpfte er einige Handvoll Wasser aus dem Becken und trank voller Gier. Als der erste Durst gestillt war und William wieder atmen konnte, wischte er mit einem Büschel Schafwolle, die sich im Gatter verfangen hatte, das Blut von seiner Klinge, steckte sie in die Scheide zurück und machte sich auf den Rückweg zur Brücke. Mit einem Mal fühlte er sich so erschöpft und müde, als wären seine Schuhe mit Blei besohlt.
So wie sein Brauner auf der Seite lag, wusste William, noch ehe er neben dem Kopf des Tieres auf die Knie sank und die stumpfen Augen erblickte, dass der Hengst tot war. Er legte die Hand auf den noch warmen Hals und spürte die starren Mähnenhaare über seine aufgerissenen Fingerknöchel kratzen. Anlässlich seines Ritterschlags hatte ihm Guillaume de Tancarville den Braunen samt Schwert, Rüstung und Mantel zum Geschenk gemacht. Auch wenn er ihn nicht lange besessen hatte, so war er doch ein wunderbares Tier gewesen – stark, mutig und gehorsam zugleich. Offenbar hatte William mehr Stolz und Zuneigung zu dem Braunen entwickelt, als klug gewesen wäre, denn mit einem Mal spürte er, wie sich seine Kehle schmerzhaft zusammenzog.
»Es wird nicht das letzte Pferd sein, das du verlierst«, meinte de Lorys barsch. Mit diesen Worten beugte er sich von seinem Apfelschimmel herunter, der nur einige oberflächliche Wunden davongetragen hatte und noch immer fest auf seinen vier Beinen stand. »So ist der Krieg nun einmal, mein Junge.« Er streckte seine Hand aus, die gleich der von William blutig von ihrem Tagwerk war. »Komm, steig hinter mir auf.«
William gehorchte, obwohl es ihn arge Mühe kostete, seinen Fuß über dem von Gadefer in den Steigbügel zu zwängen und sich über die Kruppe hinaufzuschwingen. Die Schnitte und Prellungen, die er im Lauf des Gefechts gar nicht gespürt hatte, zerrten nun schmerzhaft an ihm. Besonders am rechten Schulterblatt.
»Bist du verletzt?«, fragte Gadefer, als William nach Luft schnappte. »Der Riss im Kettenhemd sieht böse aus.«
»Der stammt von einem Fischhaken. Ist nicht weiter schlimm.«
De Lorys brummte. »Die Schlafmütze und den Vielfraß nehme ich auf gar keinen Fall zurück, aber so, wie du heute gekämpft hast … nun, das hat alles aufgewogen. Vielleicht war Mylord Tancarvilles Ausbildung ja doch keine reine Zeitverschwendung.«
Am Abend veranstaltete der Sire de Tancarville ein Fest, denn es galt, einen Sieg zu feiern, mit dem seine Mannen nicht nur eine drohende Niederlage abgewehrt hatten, sondern vielmehr aus dem Schlund der Vernichtung entkommen und ins Leben zurückgekrochen waren. Aufs Schwerste misshandelt hatten sich Frankreichs Truppen zurückgezogen, um ihre Wunden zu lecken, und Drincourt war für den Augenblick gesichert, wenngleich sich die übrige Grafschaft von Eu als gebrandschatzte und ausgeplünderte Wüstenei darbot.
William thronte auf einem Ehrenplatz an der Hohen Tafel und wurde von den älteren Rittern für den ausgesprochenen Wagemut gefeiert, mit dem er seinen ersten Kampf bestritten hatte. Erschöpft, wie er war, sonnte er sich dennoch im Lob der Kameraden, und dank Täubchen in Weinsauce, dampfend süßem Brei und in Mandelmilch gekochten Äpfeln wuchsen ihm sichtlich neue Kräfte zu. Der süße starke Eiswein, den sie ihm einflößten, tat sein Übriges dazu. Williams Wunden waren glücklicherweise zum größten Teil oberflächlicher Natur. De Tancarvilles Wundarzt hatte sie ausgewaschen und die tiefste an der Schulter mit einigen Stichen genäht und mit einem weichen Leinenverband versorgt. Diese Wunde schmerzte beträchtlich, aber außer einer Narbe als Erinnerung würde William keinen bleibenden Schaden zurückbehalten. Das Kettenhemd befand sich längst in der Waffenkammer, wo die beschädigten Ringe ersetzt wurden, und die Frauen in der Burg kümmerten sich um das zerrissene Wams, das sie säuberten und mit Flicken benähten. Ständig versicherten ihm alle, dass er großes Glück gehabt hätte. Was vermutlich auch stimmte, denn einige der Kameraden hatten ihr Leben auf dem Schlachtfeld gelassen, wohingegen er nur ein Pferd eingebüßt hatte – und seine jungfräuliche Unerfahrenheit. Dennoch fühlte es sich nicht gerade wie Glück an, als ihm jemand versehentlich einen anerkennenden Schlag auf die verwundete Schulter versetzte.
William de Mandeville, der junge Earl of Essex, hob seinen Becher und prostete William mit blitzenden Augen zu. »Na los, Marshal, wie wäre es denn mit einem Geschenk – um unserer Freundschaft willen!«
Vor Müdigkeit und Stolz war William schon schwindlig. Aber er war nicht betrunken, und er wusste auch nicht recht, warum de Mandeville ein solch breites Grinsen zur Schau trug. Trotzdem ließ er sich auf das Spiel ein. Schließlich war es bei Siegesfeiern Sitte, Preise und Geschenke unter die Ritter zu verteilen.
»Nur zu gern, Mylord«, antwortete er mit einem Lächeln. »Was genau sollte ich Euch denn geben?«
»Nun, lass mich überlegen.« Mit gespielter Pose rieb sich de Mandeville das Kinn und sah einen der Ritter nach dem anderen an, um sie in sein Spiel einzubeziehen. »Einen Schwanzriemen könnte ich mir vorstellen oder einen verzierten Brustgurt. Oder vielleicht sogar schöne Zügel?«
William riss die Augen auf und spreizte die Hände. »Aber so etwas besitze ich doch gar nicht«, entfuhr es ihm. »Alles, was ich habe – sogar die Kleider, die ich am Leib trage –, verdanke ich nur der Großzügigkeit meines Lords.« Er verneigte sich vor Guillaume de Tancarville, worauf dieser seinen Pokal schwenkte und leise aufstieß.
»Aber ich habe doch gesehen, dass du heute all diese Dinge erbeutet hast. Und zwar mit meinen eigenen Augen«, spottete de Mandeville. »Es müssen wenigstens ein Dutzend gewesen sein – und dennoch willst du mir kein einziges Teil schenken?«
Benommen starrte William vor sich hin, während rund um den Tisch leises Lachen aufbrandete, das angesichts seines dummen Gesichtsausdrucks immer lauter wurde.
»Ich will damit nur sagen«, erklärte de Mandeville zwischen zwei Lachanfällen, »dass du heute Abend ein reicher Mann hättest sein können, wenn du nur von jedem Ritter, den du geschlagen und aus dem Sattel gehoben hast, das übliche Lösegeld eingefordert hättest. Verstehst du mich jetzt?«
Eine neue Welle dröhnenden Gelächters ergoss sich über den bekümmerten William. Da er derlei Spott nicht zum ersten Mal erlebte, wusste er nur zu gut, dass es jetzt das Dümmste wäre, sich schmollend in einer Ecke zu verkriechen oder gar wütend um sich zu schlagen. Der Rüffel war eine Warnung und ein gut gemeinter Rat zugleich. »Ihr habt recht, Mylord«, stimmte er de Mandeville zu. Als er bekräftigend die Schultern in die Höhe zog, stöhnte er vor Schmerzen, was eine weitere Lachsalve hervorrief. »So weit habe ich überhaupt nicht gedacht. Beim nächsten Mal werde ich klüger sein. Ihr werdet Euer Zaumzeug schon noch bekommen. Das verspreche ich.«
»Ha!«, rief der Earl of Essex. »Dazu musst du dir erst einmal ein neues Pferd besorgen. Und billig sind die nicht gerade.«
Als sich William in dieser Nacht auf seinem Strohsack ausstreckte, lag er trotz großer Müdigkeit noch lange Zeit wach. Sein Kopf fühlte sich mindestens so zerschlagen an wie sein Leib, während vor seinem inneren Auge die Bilder des Tages in schneller Folge vorbeizogen: Einige, so der verbissene Kampf mit dem flämischen Fußsoldaten, kehrten immer wieder, während andere wie Sonnenstrahlen auf dem Wasser aufblitzten, um ebenso rasch wieder zu verschwinden. Aber genauso wie die Nadel einen Faden durch den Wandteppich zieht, so blitzte Mandevilles Botschaft immer wieder zwischen den Szenen auf. Allerdings war es diesmal kein Spaß, sondern die harte Wahrheit: Kämpfe für deinen Lord und kämpfe für seine Ehre, aber vergiss dabei nie, dass du auch für dich selbst kämpfst.
2
Der Mantel, den William anlässlich seiner Schwertleite von seinem Lord zum Geschenk erhalten hatte, war aus flämischer Wolle gefertigt und mit einer Borte aus Zobelfell besetzt. Um ein derart tiefes Blau zu erreichen, hatte man das Tuch dreimal mit Waid gefärbt und dann einen halbkreisförmigen Umhang daraus genäht, der seinen Träger vom Hals bis zu den Knöcheln mit üppiger Fülle umhüllte. Als William mit der flachen Hand über den kostbaren Flor strich, war sein Herz von Scham und tiefem Bedauern erfüllt.
»Ich gebe Euch fünfzehn Shilling«, bot der Händler an. Dabei rieb er sich mit dem Zeigefinger die Nase und beäugte seinen Kunden mit listigem Blick.
»Er ist mindestens doppelt so viel wert!«, protestierte William.
»Dann behaltet ihn eben, Messire.« Der Händler zuckte die Achseln. »Ich muss eine Frau und zwölf Kinder ernähren. Da kann ich mir keine Wohltätigkeiten leisten.«
William rieb seinen Nacken. Er musste das gute Stück verkaufen, denn er brauchte unbedingt Geld für ein neues Pferd. De Tancarville hatte keinerlei Anstalten gemacht, ihm den Braunen zu ersetzen. Die Großzügigkeit eines Lords gegenüber seinen Gefolgsleuten bewegte sich innerhalb bestimmter Grenzen. Für alles darüber hinaus waren die Männer selbst verantwortlich. Williams Verfehlung bestand nicht darin, ein wertvolles Streitross verloren zu haben – nur leider hatte er es versäumt, sich seinen Verlust von den Besiegten ersetzen zu lassen. Der kürzliche Friedensschluss zwischen den Königen von England und Frankreich verschärfte Williams Lage noch zusätzlich, da Lord Guillaume in Zukunft nicht mehr so viele Ritter in seinem Gefolge benötigen würde wie zu Kriegszeiten – und vor allem keine unerfahrenen jungen Männer, denen es sowohl an Ausrüstung als auch an Geld mangelte.
»Nun gut. Es ist ein edles Stück und kaum getragen. Ich gebe Euch achtzehn«, lenkte der Händler ein.
Mit stahlhartem Blick sah William den Mann an. »Nicht weniger als fünfundzwanzig.«
»Dann müsst Ihr Euch eben einen anderen Käufer suchen. Zweiundzwanzig – das ist mein letztes Wort. Ihr bringt mich noch um Hab und Gut.« Der Händler verschränkte die Arme, und William begriff, dass der Spielraum ausgereizt war. Am liebsten hätte er wortlos kehrtgemacht, doch seine Not war einfach zu groß. Auch wenn es ihn bitter ankam, schluckte er seinen Stolz hinunter und stimmte dem Handel zu.
Rasch verstaute er die Münzen im Beutel und verließ den Stand. Zweiundzwanzig angevinische Shilling waren nicht annähernd genug für ein gutes Schlachtross. Bestenfalls konnte er davon die Überfahrt nach England für sich selbst, ein Reitpferd und ein Packtier bestreiten. Doch derart mittellos zu Hause anzuklopfen, würde für ihn heißen, dass er der Familie die Bettlerschale entgegenstreckte. Schon zu Lebzeiten seines Vaters wäre ihm die Heimkehr schwergefallen. Doch nun, da sein ältester Bruder John das Land der Marshals geerbt hatte, wollte er lieber hungern, als widerwillig erwiesene Wohltaten annehmen.
In seiner Zwangslage entschied sich William für den Kauf eines Reitpferds, das die Witwe eines Sergeanten zum Kauf anbot, nachdem ihr Mann in der Schlacht um Drincourt gefallen war. Das Tier war hervorragend ausgebildet, auch wenn es nicht mehr das Jüngste war, und besaß durchaus reiterliche Qualitäten – aber ein Schlachtross war es trotzdem nicht.
Nachdem William das Pferd im Stall untergebracht hatte, wollte er in der Küche den bitteren Nachgeschmack seiner Unternehmung mit einem Stück Brot, etwas Käse und einem Krug Apfelwein hinunterspülen. Der warme Mantel war vermutlich nur der Anfang. Als Nächstes würde er den seidenen Umhang und danach den mit Messing besetzten Schwertgurt verkaufen müssen. Er sah schon bildlich vor sich, wie er seine Besitztümer Stück für Stück veräußerte, bis er letzten Endes in der ledernen Bekleidung eines gewöhnlichen Fußsoldaten dastehen würde. Oder er müsste sogar im Dienst seines Bruders unbedeutende Streitereien um Haus und Hof ausfechten und seine Tage in Langeweile fristen, wobei er ständig fetter und träger würde.
Der Koch warf eine Hand voll gehackter Kräuter in einen Kessel und rührte einige Male kräftig um, ehe er sich zu William umdrehte. »Ich hätte eigentlich gedacht, dass Ihr bei den anderen in der Halle seid.«
»Und weshalb sollte ich dort sein?« William trank einen großen Schluck Apfelwein.
»Demnach wisst Ihr noch nichts von dem Turnier.« Die Augen des Mannes glänzten, so sehr genoss er, dass er besser informiert war als sein Gegenüber.
Williams Augen verengten sich. »Was redest du da?«
»Ich rede von dem Turnier, das in zwei Wochen auf dem Feld zwischen Sainte Jamme und Valennes stattfindet. Vor ungefähr einer Stunde kam ein Herold in den Burghof geritten, der Lord Guillaume eingeladen hat, daran teilzunehmen.« Der Mann deutete mit dem tropfenden Löffel auf sein Gegenüber. »Eine gute Gelegenheit, um Euer Vermögen aufzubessern.«
Vorfreude flammte in William auf – und erlosch sogleich wieder. »Aber ich habe doch kein Schlachtross mehr. Mit einem normalen Gaul kann ich mich bei einem Turnier unmöglich blicken lassen.«
»Stimmt.« Der Koch kratzte sich am Kopf. »Das ist schade. Aber sicher wird Euch unser Lord ein Streitross zur Verfügung stellen. Er möchte so viele Ritter wie nur möglich aufbieten. Warum fragt Ihr ihn nicht einfach?«
Ein leiser Hoffnungsschimmer kehrte zurück, doch im selben Moment wurde William übel. Falls seine Bitte auf taube Ohren stieß, musste er wohl oder übel nach England heimkehren. Und das mit eingezogenem Schwanz. Schon die Frage war im Grunde beschämend für ihn, aber er hatte keine Wahl. Der erste Schlag war seinem Stolz ja bereits versetzt worden. Tiefer konnte er nicht mehr sinken. Er stürzte den restlichen Apfelwein hinunter, ließ das Essen Essen sein und lief geschwind in die große Halle.
Dank der Neuigkeit waren alle in bester Stimmung. William hielt sich abseits von den anderen, seine Seele schwankte zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Er ließ sich auf den Strohsack plumpsen und begutachtete seine Ausrüstung: das Kettenhemd mit dem ausgebesserten Schulterstück, das fein säuberlich geflickte Wams, seinen Schild, die Lanze und sein Schwert. Die Knappen rannten nach den Befehlen ihrer Lords so eilig durch den Saal, als ob ihre Füße Feuer gefangen hätten.
Von Zeit zu Zeit kam einer der Männer zu William herüber, schlug ihm auf den Rücken und redete aufgeregt über das bevorstehende Turnier. William lachte, nickte und gab sich alle Mühe, seine Sorgen zu verbergen. Und während er seinen Helm mit einem weichen Tuch polierte, fragte er sich, ob er sein Geld nicht doch besser für die Überfahrt nach England ausgegeben hätte, anstatt ein Pferd davon zu kaufen. Seine Mutter wäre bestimmt überglücklich, ihn wiederzusehen, und seine Schwestern vermutlich ebenfalls. Doch was seinen Bruder John anging, so hatte er seine Zweifel. John war außer sich gewesen, als man William zur Ausbildung in die Normandie geschickt hatte. Er selbst hatte in Hamstead bleiben und den beiden älteren Brüdern Walter und Gilbert aus der ersten Ehe ihres Vaters zur Hand gehen müssen. Wie das Schicksal es so wollte, waren sowohl Walter als auch Gilbert inzwischen gestorben, und John hatte das Erbe der Marshals angetreten. Trotzdem war er nicht der Mann, der frühere Eifersüchteleien und alten Groll vergaß.
Auch Williams jüngerer Bruder Henry hatte das elterliche Nest vermutlich längst verlassen, um sich auf sein Leben als Priester vorzubereiten. Und der Jüngste, der zarte, sommersprossige Ancel, den William zuletzt als Neunjährigen gesehen hatte, dürfte allmählich das Knappenalter erreicht haben. Falls John seine Ausbildung in die Hand nahm, so konnte dem Kleinen nur noch der Herrgott beistehen.
William rieb und rieb, bis das Metall so blank war wie der Handspiegel einer Frau. Er mochte nicht als Habenichts heimkehren, aber dennoch hätte er die Seinen liebend gern wiedergesehen. Sogar John. Und er hätte auch gern das Grab seines Vaters besucht, an dessen Beisetzung er einst wegen der großen Entfernung nicht hatte teilnehmen können.
»Du wirkst bedrückt, William.«
Er hob den Kopf und sah, dass Guillaume de Tancarville mit in die Hüften gestützten Händen vor ihm stand und auf ihn hinuntersah. In seinen Augenwinkeln blitzte der Schalk auf. Den schwindenden Haaransatz versteckte er unter einer bunten Kappe, die bis zu den Brauen herabreichte und deren Rand mit kleinen Halbedelsteinen bestickt war.
William beeilte sich aufzustehen. »Ich bin nicht bedrückt, Mylord. Ich war nur in Gedanken versunken.«
»Und worüber muss ein junger Mann wie du so gründlich nachdenken, hmm?«
William besah sich sein verzerrtes Spiegelbild in dem blanken Metall. »Ich habe überlegt, ob ich zu meiner Familie nach England zurückkehren soll.«
»Ein Mann sollte seine Familie zwar stets im Herzen tragen und in seine Gebete einschließen – aber ich habe eigentlich erwartet, dass sich deine Gedanken im Moment um das Turnier drehen würden. Wie die aller anderen hier.« Lächelnd wies er in die Runde.
»Ja, Mylord. Die anderen haben ja auch die richtige Ausrüstung, um daran teilzunehmen. Im Gegensatz zu mir.« Er zwang sich, dem Blick des königlichen Statthalters standzuhalten.
»Hm.« De Tancarville rieb sich das Kinn.
Und William schwieg. Schließlich konnte er seinem Lord ja schlecht sagen, dass er den geschenkten Mantel versetzt hatte, um einen ganz gewöhnlichen Gaul zu kaufen.
De Tancarville trieb die Spannung auf die Spitze, aber schließlich beendete er die Qual mit einem Grinsen. »In der Schlacht um Drincourt hast du sehr viel Mut und Tapferkeit bewiesen – auch wenn du dich beim Beutemachen wie ein unerfahrener Narr angestellt hast. Du wirst meine Mannschaft beim Turnier aufs Trefflichste verstärken. Morgen bringt uns ein Pferdehändler auf mein Geheiß hin einige Tiere zum Turnierplatz. Du bist nämlich nicht der Einzige, der sein Streitross eingebüßt hat. Da du deine Lektion gelernt hast, werde ich dir dieses eine Mal deinen Hengst ersetzen. Für alles andere musst du allerdings selbst sorgen. Falls du einige Ritter besiegst und Lösegeld einforderst, wirst du dein Vermögen schnell aufbessern. Falls du jedoch versagst …« Er zuckte die Achseln und ließ den Satz unvollendet in der Luft hängen. Aber mehr musste er dazu auch nicht sagen.
»Ich danke Euch, Mylord!« Mit einem Mal strahlten Williams Augen mit dem Helm um die Wette. »Ich werde mich Eurer Großzügigkeit würdig erweisen. Das schwöre ich!«
De Tancarville grinste. »Du bist ein guter Junge, William«, sagte er und schlug ihm auf die Schulter. »Wollen wir hoffen, dass eines Tages ein noch viel besserer Mann aus dir wird.«
William riss sich zusammen, um trotz des Schmerzes, der ihm sogleich in die Schulter fuhr, nicht laut zu stöhnen. In seinen Augen war das kein hoher Preis. Überhaupt zerstreuten sich all seine Probleme in alle Winde. Er würde de Tancarville beweisen, dass er längst ein Mann war und sehr wohl auf seinen beiden Beinen stehen konnte.
William betrachtete den Hengst, der vor de Tancarvilles Stallung stand, wo er von zwei Pferdeknechten festgehalten wurde. Sein Fell war beinahe so cremeweiß wie frische Milch, und seine Mähne und Schweif schimmerten silbrig wie ein Wasserfall. Der Umriss des Pferdekopfes, die kleinen Ohren, der starke Hals, die breite Brust und der mächtige Rumpf ließen spanisches Blut vermuten. Im Grunde hätte das Tier als Erstes ausgesucht werden müssen, anstatt bis zuletzt übrig zu bleiben. William war länger als erwartet mit dem Aufbau seines Zelts beschäftigt gewesen, und er wusste nicht, ob die anderen ihm nur versehentlich nicht gesagt hatten, dass der Pferdehändler bereits eingetroffen war und die Verteilung schon begonnen hatte, oder ob das wieder einmal einer ihrer bösen Streiche war.
»Wir haben dir ein wunderschönes Pferd übrig gelassen, Marshal!«, rief Adam Yqueboeuf, ein streitlustiger, etwas untersetzter Ritter, der William nicht ausstehen konnte und bei jeder Gelegenheit auf ihm herumhackte. »Wie immer nur das Beste für den Verwandten unseres Lords!«
William tat, als habe er den Spott nicht gehört, und ging langsam auf das Tier zu. Aus dem getrockneten Schweiß an Satteldecke und Geschirr schloss er, dass die anderen ihn bereits ausgiebig geritten hatten. Wie eine neue Dirne im Freudenhaus, dachte er. Gleich in der ersten Nacht missbraucht, bis auch der Letzte in der Reihe nichts mehr damit anfangen konnte. Besorgt registrierte William die angelegten Ohren, die gespannten Muskeln und die Kraft, mit der die Pferdeknechte die Leinen festhalten mussten.
»Er ist äußerst ungebärdig, Sir«, warnte einer der Männer, als William sich dem Hengst von der Seite näherte, damit dieser ihn sehen konnte. Sein Fell erzitterte in ungleichmäßigen kleinen Wellen ähnlich der Oberfläche eines Teichs, auf den Regentropfen fallen. William streckte die Hand aus, um den feuchtglänzenden Hals zu tätscheln, und sprach dabei beruhigend auf das Tier ein. Dann ließ er ihm Zeit, sich an seine Gegenwart zu gewöhnen.
»Ungebärdig?«, fragte er den Stallburschen leise. »Inwiefern?«
»Er ist ein Puller, Sir – ständig zerrt er an der Trense. Von den anderen ist keiner mit ihm zurechtgekommen.«
»Ah.« William sah kurz zu den feixenden Zuschauern hinüber, während er in einem fort den bebenden Hals und die Schulter des Hengstes streichelte. Nach einiger Zeit glitt seine Hand zum Sattelbogen, schließlich schob er einen Fuß in den Steigbügel und schwang sich hinauf. Sofort keilte der Hengst aus und tänzelte seitwärts. »Ist ja gut. Ruhig bleiben. Ganz ruhig«, raunte William ihm zu und ergriff die Zügel, ohne jedoch den geringsten Druck auszuüben. Die Ohren des Hengstes sausten wie wild vor und zurück, und er tänzelte unaufhörlich. Als William kraftvoll die Schenkel zusammenpresste, sprang das Tier in einem gewaltigen Satz auf die Zuschauer los, und sobald er die Zügel anzog, um den Hengst herumzureißen, warf sich dieser nach vorn und preschte mit wehendem Schweif los. Fluchend stoben die Zuschauer auseinander. William blieb keine Zeit zum Lachen, denn er hatte seine liebe Mühe, sich überhaupt auf diesem tanzenden Derwisch zu halten. Er ließ die Zügel fahren und packte stattdessen die Mähne des Tieres, presste die Schenkel mit aller Kraft zusammen und hielt sich wie eine Klette auf dem Pferderücken. Sobald der Druck im Maul nachließ, beruhigte sich das Tier wenigstens so weit, dass William gefahrlos abspringen konnte.
»Ich bin gespannt, wie du mit dem da beim Turnier einen Preis gewinnen willst!«, zischte Yqueboeuf aus der Ecke, in die er sich geflüchtet hatte. Staub und Spinnweben zierten seine Tunika.
Die gerunzelten Brauen und das Keuchen straften Williams breites Lächeln Lügen. »Worum wetten wir?«
»Du kleiner Habenichts«, spottete Yqueboeuf und klopfte sich den Staub aus den Kleidern. »Sag, was besitzt du denn schon, was ich mir wünschen könnte?«
»Mein Schwert zum Beispiel. Ich setze mein Schwert. Und womit haltet Ihr dagegen?«
Yqueboeuf ließ ein hässliches Lachen hören. »Wenn du dein Schwert unbedingt verlieren willst, so setze ich meines dagegen – obwohl es wertvoller ist.«
William zog eine Braue in die Höhe und sparte sich die Bemerkung, dass ein Schwert immer nur so wertvoll war wie die Faust, die den Hieb führte. »Einverstanden«, erwiderte er knapp. Dann wandte er sich ab, um den Hengst von den Zügeln zu befreien und sich sein Maul genauer anzusehen.
Strahlend hell zog der Morgen des Turniertags herauf, und alle Ritter waren bereits zeitig auf den Beinen.
»Wo ist Marshal?«, fragte de Tancarville, als er das Zelt leer und verlassen vorfand. Der Strohsack war bereits zusammengerollt. Eigentlich hatte er erwartet, dass der junge Mann um diese Zeit noch schlafen würde, wie das seine Gewohnheit war.
»Wahrscheinlich frühstückt er gerade an einer der Bäckerbuden«, bemerkte Gadefer de Lorys und rollte vielsagend die Augen.
»Nein, Mylord«, meldete sich einer der Knappen zu Wort. »Er hat die halbe Nacht an einem neuen Zaumzeug für seinen Hengst gewerkelt und ist augenblicklich draußen, um seine Arbeit auszuprobieren.«
Erstaunt zog de Tancarville eine Braue in die Höhe. »Welchen Hengst hat er sich denn ausgesucht?«, fragte er de Lorys.
»Den spanischen Grauen«, antwortete dieser gleichmütig. »Er hatte sich verspätet, und dies war der Letzte, der noch übrig war. Sein Gebiss ist nicht gerade im besten Zustand.«
De Tancarville runzelte die Stirn und zog dann leicht verärgert seinen Gürtel zurecht. »Das ist nicht das, was mir vorschwebte. Ich wollte dem Jungen eine wirkliche Chance geben.« Als sein Blick über die lange Reihe der gestreiften Zelte glitt, entdeckte er William, der mit fröhlicher Miene auf ihn zukam, und schüttelte den Kopf. Wie nicht anders zu erwarten, hielt der junge Mann einen großen Kanten Brot in der Rechten, und seine Kiefer mahlten eifrig. Wenigstens trug er bereits die wattierte Tunika und war somit schon zur Hälfte angekleidet. Er schien sich wie ein Kind auf das Turnier zu freuen. Als der junge Mann den Großkämmerer und de Lorys vor seinem Zelt gewahrte, stutzte er, schluckte hastig den letzten Bissen hinunter und eilte besorgt auf die beiden zu.
»Mylord? Ist etwas vorgefallen? Habt Ihr mich gesucht?«
»Ich wollte nur wissen, wo du steckst. Man hat mir berichtet, dass du dich um dein Pferd gekümmert hast. Wie ich gehört habe, hattest du gestern Schwierigkeiten.«
»Keine, die man nicht hätte ändern können«, entgegnete William voller Eifer. »Ich musste nur die Zügel um drei Finger verlängern, damit das Gebiss tiefer im Maul sitzt und nicht auf die schmerzende Stelle drückt.«
De Lorys verschränkte die Arme. »Ich fürchte, dass du dadurch wichtigen Einfluss einbüßen wirst.«
»Aber wenigstens habe ich ein Pferd, auf dem ich reiten kann. Ich habe draußen im Gelände geübt und denke, dass ich genau das Richtige getan habe.«
De Lorys runzelte die Stirn und verzog die Mundwinkel, sagte aber nichts.
»Es war nicht meine Absicht, dass du ein schlechtes Pferd bekommst«, bemerkte de Tancarville barsch.
»Der Hengst ist kein schlechtes Pferd, Mylord«, antwortete William lächelnd. »Wahrscheinlich ist er sogar der Beste von allen.« Bevor er ins Zelt schlüpfte, zögerte er kurz. »Ich möchte Euch allerdings bitten, Adam Yqueboeuf nichts davon zu sagen, Mylord. Er hat nämlich sein Schwert verwettet, dass ich mit Blancart keinen Preis gewinnen werde, und ich möchte ihn gern überraschen.«
De Tancarville ließ ein belustigtes Schnauben hören. »Ich fürchte, du überraschst uns alle, mein lieber William. Ich werde jedenfalls nichts sagen. Es wird sich ohnehin bald genug zeigen, wer recht hat. Beeil dich, sonst versäumst du noch die Aufstellung.«
»Ja, Mylord.« William stopfte sich das letzte Stückchen Brot in den Mund und nahm einen Schluck Wein aus einem Krug, der auf dem Hocker stand. Mit vollem Mund bat er anschließend einen Knappen, ihm beim Anlegen der Rüstung behilflich zu sein.
Im Vergleich zu Williams Feuertaufe in der blutigen Schlacht um Drincourt war das Turnier der reinste Spaziergang. Zwar waren auch bei einem solchen Wettkampf Tod und Verletzungen unvermeidlich, aber es ging in erster Linie darum, Gefangene zu nehmen und ein ordentliches Lösegeld zu erstreiten. Obwohl sich Williams Hengst feurig und ungestüm gebärdete, kam der junge Ritter gut mit ihm zurecht. Er konzentrierte sich darauf, die Zügel locker zu lassen und vor allem mit Schenkeln und Fersen zu arbeiten. Als er sich neben den anderen Rittern aufstellte, schwoll sein Herz vor Stolz. Auch wenn er sich in einiger Entfernung von Adam Yqueboeuf eingereiht hatte, war sich dennoch jeder der beiden der Gegenwart des anderen bewusst. William verbot sich jeden Gedanken an ein Scheitern. Dies war der Tag, an dem seine Ehre und Selbstachtung auf dem Spiel standen, und er wollte lieber sterben, als sein Schwert einem eingebildeten Mistkerl wie Yqueboeuf zu überlassen.
Auf der anderen Seite des Platzes nahm eine Gruppe von französischen, flämischen und schottischen Rittern Aufstellung, die ebenso wie die Normannen, Engländer und Angeviner auf den Kampf brannte. De Tancarville hielt sich im Rücken seiner Truppe. Für einen Mann wie ihn war das Turnier eine willkommene Gelegenheit, Freunde und Gleichgesinnte zu treffen und gleichzeitig die Wichtigkeit seiner Person und seiner Stellung durch die Anzahl und die Tüchtigkeit seiner Gefolgsleute zu unterstreichen. Der körperliche Wettstreit war für die Jungen und Wagemutigen reserviert, während sich die Älteren aufs Zusehen beschränkten.
Als das Trompetensignal des Herolds erschallte, sprengten die beiden Reihen aufeinander los. William spürte, wie Blancart ihn geschmeidig und kraftvoll wie eine Welle mit sich forttrug. Sein Blick fasste ein Ziel ins Auge: einen Ritter in mit Gold und Silber verzierter, schillernder Rüstung, dessen Streitross in leuchtendes Safran und Gold gewandet war. Als die beiden Hengste heftig zusammenprallten, gleich der Brandung des Ozeans, die gegen die Klippen schlägt, sich wieder voneinander lösten und erneut zusammenstießen, schlang William im Getümmel die Hand um die Zügel seines Gegners und zerrte ihn mit aller Kraft in Richtung der normannischen Zeltreihen davon. »Ergebt Euch!«, bellte er mit erstickter Stimme durch die Sehschlitze seines Helms.
»Niemals!« Der Ritter zog sein Schwert und versuchte, William abzuwehren, doch dieser ließ nicht locker. Er duckte sich unter den Hieben hinweg, ja, er erwiderte sogar die Angriffe, und die ganze Zeit über zerrte er seinen Gegner den eigenen Reihen entgegen. Ein zweiter Franzose, der dem Ersten zu Hilfe eilen wollte, wurde von Gadefer de Lorys abgedrängt. William dankte mit einem Nicken, duckte sich unter einem weiteren Schwertstreich seines inzwischen völlig verzweifelten Kontrahenten hinweg und gab Blancart die Sporen.
»Ergebt Euch, Mylord!« kommandierte er noch einmal, während er sein Opfer weit hinter die normannischen Linien schleppte.
Der Ritter schüttelte den Kopf, doch diesmal nicht, um seinen Widerstand zu bekunden, sondern in Anerkennung von Williams Kampfgeist. »Ich ergebe mich«, zischte er. »Ich bin Philipp de Valognes. Ihr bekommt Euren Preis.« Er winkte ab. »Ihr hattet Glück. Ihr habt mich überwältigt, bevor ich überhaupt richtig warm war.« Sein Ton ließ anklingen, dass er Williams heftigen Angriff und seine Hartnäckigkeit nicht unbedingt als ritterlich ansah. »Lasst jetzt von mir ab … und verratet mir, wem ich soeben mein Schlachtross übergeben habe.«
»Ich bin William Marshal, Mylord«, gab William zurück. Seine Brust hob und senkte sich wie wild, und er hielt noch immer die Zügel fest in der Hand. »Ich bin mit Guillaume de Tancarville verwandt, außerdem Neffe des Earl of Salisbury und Cousin des Count of Perche.«
»Und dem Anschein nach einer von de Tancarvilles jungen Heißspornen ohne einen einzigen Penny«, brummte de Valognes.
»Nur bis eben, Mylord«, ergänzte William fröhlich.
De Valognes quittierte die Stichelei mit belustigtem Schnauben.
»Mein Diener wird Euch mein Pferd samt Rüstung als Kriegsbeute überbringen«, sagte er.
Mit einer Verbeugung ließ William die Zügel los und erlaubte de Valognes, ins Turnier zurückkehren – wie ein Angler, der einen gefangenen Karpfen wieder in den Teich zurückwirft. »Ha!«, rief er, als er Blancart erneut antrieb, um sich weitere Fische aus dem Netz zu angeln.
Die Muskeln an Yqueboufs Kinn mahlten heftig, als er seinen Schwertgurt löste und ihn William übergab. »Du hast die Wette gewonnen«, stieß er missmutig hervor. »Ich kenne keinen, der so viel Glück hatte.«
Im Lauf des Turniers hatte William insgesamt vier Streitrösser erbeutet, ein weiteres musste er sich mit Gadefer de Lorys teilen. In Philipp de Valognes’ und Guillaume de Tancarvilles Augen war das wahrscheinlich nicht gerade eine große Ausbeute, aber für William war es ein kleines Vermögen und obendrein der Beweis, dass er für sein Auskommen sorgen konnte.
Lächelnd verbeugte er sich. »Manch einer würde sagen, dass jeder Mann seines eigenen Glückes Schmied ist, aber was wissen die schon?« Er betrachtete den Gürtel samt Schwertscheide, ließ die Klinge aber stecken. »Ein Schwert wird allein für die Hand seines Besitzers geschmiedet. Deshalb gebe ich es dir als Zeichen meines guten Willens zurück.« Mit einer höflichen Verbeugung reichte er Yqueboeuf den Gürtel und grinste über das ganze Gesicht.
Wenn Yqueboeuf seine Niederlage zuvor schon kaum verkraftet hatte, so schien er jetzt daran zu ersticken. Er stieß ein paar gepresste Worte der Dankbarkeit hervor, dann packte er sein Schwert, machte auf dem Absatz kehrt und ging davon.
»Denk immer daran, dass man sich im Leben Freunde wie Feinde macht, mein Junge.« De Tancarville zog William zur Seite, um vor der Zecherei noch ein paar ruhige Worte mit ihm zu wechseln. »In dieser Hinsicht scheinst du wahrlich begabt zu sein, und weniger bedeutende Männer werden dir das übelnehmen.«
»Ja, Mylord.« William wirkte verunsichert. »Aber Yquebouefs Schwert hätte doch keinerlei Nutzen für mich gehabt. Ich habe mir zuerst überlegt, den Wert in Silber einzufordern, aber es erschien mir edler, ihm die Waffe zurückzugeben.«
De Tancarville spitzte die Lippen. »Deine Begründung klingt vernünftig, aber solcher Edelmut wird dich nicht vor Gehässigkeit schützen.«
»Das weiß ich, Mylord.« Williams Augen wurden schmal. »Ich habe jahrelang ertragen, dass man mich Schlafmütze oder Vielfraß nannte. Manche Worte hatte ich sicher verdient, aber der Großteil war wohl eher meiner Stellung als Euer armer Verwandter geschuldet. Falls es nötig sein sollte, kann ich sehr wohl auch ohne Schlaf und Essen auskommen.«
»Davon bin ich absolut überzeugt.« Der Großkämmerer räusperte sich unnötig heftig. »Was wirst du jetzt anfangen?«
Die Frage erschreckte William, denn er wusste sehr genau, worauf sie abzielte. De Tancarville hatte nicht die Absicht, ihn länger in seinen Diensten zu behalten, und sei er auch noch so tüchtig. Das Turnier war ein großer Erfolg gewesen, doch nun war es vorüber, und de Tancarville hatte plötzlich mehr junge Ritter in seinem Gefolge, als er brauchen konnte. Außerdem gab er William gerade zu verstehen, dass er zu viel von einem Unruhestifter an sich hatte, als dass er ihn behalten wollte.
»Ich denke über einen Besuch bei meiner Familie nach«, gab er zur Antwort und schluckte seine Enttäuschung hinunter.
»Du warst viele Jahre nicht mehr dort. Deine Familie wird sich sicher freuen.« Aus reiner Verlegenheit rieb de Tancarville mit dem Zeigefinger über den bestickten Rand seiner Kappe.
»Vielleicht erkennen sie mich gar nicht mehr wieder«, sagte William. »Oder ich sie?« Er blickte nachdenklich drein. »In England ist das Turnierreiten verboten. Aber nur einen Dreitagesritt von hier findet demnächst ein weiteres Turnier statt, wie Gadefer de Lorys bereits erwähnte. Ich überlege, ob ich dort noch einmal mein Glück versuchen soll – natürlich nur mit Eurer Erlaubnis.«