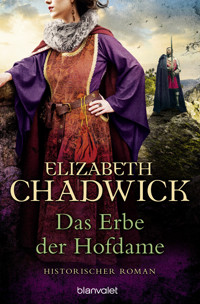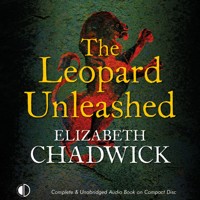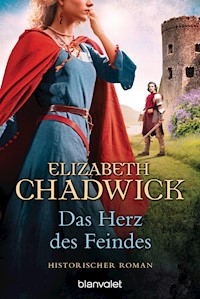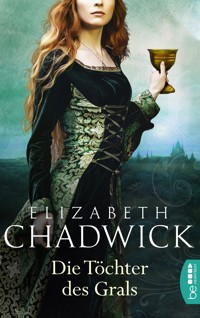
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein gefährliches Vermächtnis und eine Liebe, stark wie der Tod.
Südwestfrankreich im 13. Jahrhundert. Bridget bewahrt das Wissen und die heilenden Kräfte, die seit Generationen von Frauen an ihre Töchter weitergegeben werden und zurückgehen auf ihre Urahnin - Maria Magdalena. Doch die mächtige katholische Kirche trachtet schon lange danach, diese Blutlinie auszulöschen. In den Wirren eines Religionskrieges trifft Bridget auf Raoul de Montvallant. Kann ausgerechnet der katholische Adlige ihr dabei helfen, das Erbe fortzuführen und vor der Kirche zu schützen?
Ein bildgewaltiger historischer Roman aus der Zeit des Albigenserkreuzzugs, spannend wie ein Verschwörungsthriller - für alle Fans von Dan Brown und Kathleen McGowans Magdalena-Reihe.
Dieser Roman ist in einer früheren Ausgabe unter dem Titel "Schicksalsgefährten" erschienen. Von New-York-Times-Bestseller-Autorin Elizabeth Chadwick ebenfalls bei beHEARTBEAT lieferbar: Die Ravenstow-Trilogie. Band 1: Die Gefährtin des Normannen.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin bei beHEARTBEAT
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
TEIL I Verwüstetes Land 1207 – 1218
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
TEIL II Der Speer 1232 – 1235
33
34
35
36
TEIL III Der Kelch 1242 – 1245
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Weitere Titel der Autorin bei beHEARTBEAT
Die Ravenstow-Trilogie:
Die Gefährtin des Normannen
Die Frau mit dem kupferroten Haar
Die Geliebte des Kreuzritters
Über dieses Buch
Ein gefährliches Vermächtnis und eine Liebe, stark wie der Tod.
Südwestfrankreich im 13. Jahrhundert. Bridget bewahrt das Wissen und die heilenden Kräfte, die seit Generationen von Frauen an ihre Töchter weitergegeben werden und zurückgehen auf ihre Urahnin – Maria Magdalena. Doch die mächtige katholische Kirche trachtet schon lange danach, diese Blutlinie auszulöschen. In den Wirren eines Religionskrieges trifft Bridget auf Raoul de Montvallant. Kann ausgerechnet der katholische Adlige ihr dabei helfen, das Erbe fortzuführen und vor der Kirche zu schützen?
Ein bildgewaltiger historischer Roman aus der Zeit des Albigenserkreuzzugs, spannend wie ein Verschwörungsthriller.
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Elizabeth Chadwick gilt laut Historical Novel Society, Großbritannien, als gegenwärtig beste Autorin mittelalterlicher Romane. Sie hat mehr als 20 historische Romane geschrieben, viele davon Bestseller. Ihr Debüt »Die Gefährtin des Normannen« (vormals »Die wilde Jagd«) wurde mit dem Betty-Trask-Award ausgezeichnet und ist seit 2019 erstmals als eBook erhältlich, ebenso wie die weiteren Bände ihrer Ravenstow-Trilogie und ihr historischer Roman »Die Töchter des Grals« (zuvor erschienen unter dem Titel »Schicksalsgefährten«).
Die Autorin lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in Nottingham.
Homepage: http://elizabethchadwick.com/.
Elizabeth Chadwick
Die Töchter des Grals
Aus dem Englischen von Eva Malsch
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1993 by Elizabeth Chadwick
Titel der englischen Originalausgabe: »Children of Destiny«, später neu veröffentlicht unter dem Titel »Daughters of the Grail«
Originalverlag: Sphere, an Imprint of Little, Brown Group Book
Für diese Ausgabe:
Copyright © 1994/2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titel der deutschsprachigen Erstausgabe: »Schicksalsgefährten«
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven © iStock/ Grape_vein; iStock/ ord_Kuernyus; iStock/ gremlin
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 978-3-7517-0300-0
be-ebooks.de
lesejury.de
TEIL IVerwüstetes Land1207 – 1218
1
Südwestfrankreich, April 1207
Raoul de Montvallant bewies eine Klugheit, die über seine einundzwanzig Jahre hinausging, als er den Kopf schüttelte und eine Hand auf den venezianischen Kelch legte, den der Knappe nachfüllen wollte. Es lag nicht an der Qualität des Weins. Der schmeckte großartig, und normalerweise hätte er ihm genauso eifrig zugesprochen wie all die anderen anwesenden jungen Männer. Aber an diesem Abend wollte er nüchtern bleiben, mit gutem Grund.
Sein schneller, rastloser Blick glitt zu diesem Grund hinüber, seiner Braut Claire, mit der er seit Kindertagen verlobt war. Er kannte sie, seit sie zahnlos gelächelt und beim Spiel in den Regenpfützen des Burghofs ihren Rocksaum beschmutzt hatte. Nun entblößte ihr Lächeln fast ebenmäßige, strahlend weiße Zähne – nur die beiden vorderen standen ein wenig übereinander. Und am Saum ihres Kleids hoben sich Goldfäden in Zickzackstichen vom kostbaren italienischen Samt ab.
Um ihre Jungfräulichkeit zu unterstreichen, fiel das Haar offen auf ihre Schultern und schimmerte wie kupferrote Seide. Es drängte Raoul, diese Locken zu berühren und herauszufinden, ob sie sich genauso weich anfühlten, wie sie aussahen. Ihre Augen, glänzend wie frische Kastanien, erwiderten seinen Blick, dann senkte sie die Wimpern, und er konnte nur noch die hellen Halbmonde ihrer Lider betrachten, die glatte, gerundete Stirn. Er überlegte, was er ihr sagen könnte – etwas, das nicht abgeschmackt und banal klang. Aber die Nähe der schönen jungen Frau lähmte seine Zunge. Nichts an ihr ähnelte dem mageren kleinen Mädchen in seiner Erinnerung. Bald würden sie allein miteinander sein, im Bett – nackt. Bei dieser Vorstellung wurde seine Kehle trocken. Unwillkürlich griff er nach seinem Kelch, doch der war leer, wie er sich sofort entsann, und so legte er seine Hand flach auf den Tisch.
»Fiebert Ihr vor Ungeduld?« Vater Otho grinste ihn an, der Priester, der die Trauung in der selten benutzten Burgkapelle vorgenommen hatte. »Das kann ich Euch nicht verübeln. Nur zu gern würde ich mich selbst mit ihr vergnügen.« Genüsslich biss er in einen Marzipanapfel und glich dem reich geschmückten, gefüllten Eberkopf, der im Lauf der festlichen Mahlzeit aufgetischt worden war.
Raoul ballte die Hand. Am liebsten hätte er seine Faust in das feiste Gesicht neben sich geschmettert. Otho war ein Lügner, ein Vielfraß und berüchtigter Schürzenjäger, der seine prallvolle Börse und sein Wohlleben über die Bedürfnisse seiner Gemeinde stellte. Niemanden konnte es verwundern, dass sich die Religion der Katharer so rasch ausbreitete, wenn ein so nichtswürdiger Fettwanst die katholische Gegnerschaft repräsentierte.
»Wie schade, dass Ihr zum Zölibat verpflichtet seid ...«, bemerkte Raoul sarkastisch. Seine Augen funkelten kalt wie Lapislazuli.
»Ja, nicht wahr?« Ein lautes Rülpsen unterbrach das Kichern des Priesters, dann schmatzte er anzüglich. »Aber wir alle müssen Opfer bringen. Gieß mir noch was ein, Junge!« Gebieterisch winkte er den Knappen zu sich, der mit steinerner Miene näher trat, hielt ihm seinen Kelch hin und neigte sich zu Raouls Vater. »Ihr besitzt einen großartigen Keller, mein Herr.«
Berenger de Montvallant schenkte ihm ein gequältes Lächeln, wandte sich, sobald die Aufmerksamkeit des Priesters von anderen Dingen gefesselt wurde, zu seinem langjährigen Freund, dem Brautvater, und murmelte: »Und den wird er leer trinken, ehe der Morgen graut.«
Seufzend faltete Huon d’Agen die Hände über dem runden Bauch. »Er zählt wohl kaum zu der Sorte von Klerikern, die unsere wahre Kirche brauchen würde, um die Leute wieder an sich zu binden. Der Erfolg dieser Katharer ist keineswegs erstaunlich, wo sie doch offenbar die Einzigen sind, die sich an das Gebot der Reinheit halten, das sie predigen.«
Berenger zuckte die seidenumhüllten Schultern. »Ich selbst möchte mich ihrem Glauben nicht verschreiben, aber ich habe nichts gegen die Versammlungen, die sie in der Stadt abhalten. Wie du sehr richtig sagst – ihr Beispiel muss die römische Kirche beschämen.«
»So tolerant ist Papst Innozenz nicht«, erwiderte Huon und kräuselte die Lippen. »Sicher hast du schon gehört, dass Rom sich wieder einmal in unsere Angelegenheiten einmischen will. Man munkelt von einem Kreuzzug, der den Katharern Einhalt gebieten soll, falls unser Graf Raymond das nicht aus eigener Kraft schafft.«
Nachdenklich strich Berenger über seinen frisch gestutzten Bart. Seine tief liegenden Augen, von feinen Runzeln umrahmt, leuchteten aber immer noch in jenem durchdringenden Blau, das er Raoul vererbt hatte. »Seit ich in dem Alter war, das mein Sohn mittlerweile erreicht hat, spricht man von einem Kreuzzug. Und das liegt so lange zurück, dass ich mich gar nicht mehr daran erinnern mag. Also dürfte wohl nichts daraus werden.« Vielsagend schaute er Vater Otho an, der gerade Claires hübsche Zofe begaffte. »Die Kirche sollte besser in ihrem eigenen Haus für Ordnung sorgen, ehe sie Steine woandershin wirft.«
»Immerhin hat sie’s versucht.«
»Du meinst Dominic Guzman und seine Prediger?« Berenger war unbeeindruckt. »Das sind armselige Imitationen der tugendhaften Katharer und keine richtigen Priester, und ich zweifle an ihrem Erfolg.«
Huon zog die Brauen zusammen. »Wusstest du, dass die Nordfranzosen diesen Kreuzzug angeblich befürworten?«
»Auch das ist nicht neu«, entgegnete Berenger und beobachtete missgelaunt einige Musiker. Mit Lauten und Tamburinen näherten sie sich den Harfenisten, die während des Hochzeitsmahls leise aufgespielt hatten. »Schon seit Jahren suchen sie nach einem Vorwand, um in Toulouse einzumarschieren.«
»Und den könnten ihnen die Katharer liefern.«
»Niemals würde Graf Raymond ein französisches Heer auf seinem Grund und Boden dulden«, versicherte Berenger, aber er musterte das bestickte weiße Kleid seiner Frau, weil er Huons Blick ausweichen wollte.
Graf Raymond von Toulouse war sein Oberherr, ein etwas träger, duldsamer Mann, der sich nur selten mit Problemen belastete, die außerhalb seiner Reichweite lagen und größere Anstrengungen erforderten. In seinen zivilisierten Ländereien herrschte Ruhe. Deren Bewohner zeigten sich großteils zufrieden, und er sah keinen Grund, ihr und sein eigenes beschauliches Leben zu stören, nur weil der Papst murrte und ihn unter Druck zu setzen versuchte.
Am Hochzeitstag seines Sohnes wollte Berenger nicht an Schwierigkeiten denken, nur an Frieden und Wohlstand und an die ersehnten Enkelkinder. »Es wird vorübergehen wie ein Sturm in den Bergen, Huon«, fügte er im Brustton der Überzeugung hinzu.
Erleichtert hörte er den veränderten Klang der Musik. Immer lauter und lebhafter erfüllte sie den Saal. Berenger blickte wieder zur Seite und sah, wie der Fuß seiner Frau rhythmisch auf den Boden klopfte. Unter dem Seidenschleier schimmerte ihr Haar wie poliertes Ebenholz. Zehn Jahre jünger als er, war sie immer noch atemberaubend schön – besonders wenn sie lächelte, so wie jetzt. Ohne Zögern verdrängte er seine düsteren Gedanken und mischte sich mit ihr unter die Tänzer.
Die Abenddämmerung brach herein, und die Soldaten wollten gerade das Tor schließen, als drei Reisende eintrafen und um Gastfreundschaft für die Nacht baten.
»Ihr habt Glück!«, rief der Torhüter fröhlich und trat beiseite, um sie in den Burghof einzulassen. »Heute feiert der Sohn unseres Herrn Hochzeit. Im Saal wird getafelt und getanzt, also beeilt Euch und nehmt am Fest teil! Da drüben am Trog könnt Ihr Eure Pferde tränken.« Abschätzend musterte der Soldat die Neuankömmlinge – zwei Männer, einer um die Vierzig, der andere über Fünfzig, beide in den dunklen Roben der Katharer-Perfecti, und eine junge Frau. Ihr Gesicht, von Brusttuch und Schleier umrahmt, lag im Schatten eines breitrandigen Pilgerhuts. Es schien von innen her zu leuchten, in feingemeißelter Schönheit, nicht makellos, aber fesselnd. Das helle Opalgrau der Augen unter den markanten dunklen Brauen spiegelte die Farben ihrer Kleidung und der Umgebung wider. Und die Stimme, die dem Wächter dankte, erinnerte ihn an dunklen, gehaltvollen Gascogner Wein. »Habt Ihr noch einen weiten Weg vor Euch?«, fragte er.
»O ja«, antwortete der jüngere Mann und hob einen Arm, um die Frau in den Hof zu geleiten, eine schützende Geste, mit der er gleichzeitig die Neugier des Soldaten abwehrte. Rasselnd sank hinter ihnen das Fallgatter an seinen Flaschenzügen herab, dröhnend hob sich die Zugbrücke zur roten Ziegelmauer empor. Vor zweihundert Jahren war Montvallant erbaut worden, eine Festung, die den maurischen Angreifern getrotzt hatte. Jetzt stellten die Mauren keine Bedrohung mehr dar, doch die dicken Wälle erinnerten eindrucksvoll an den ursprünglichen Zweck der Burg.
Als die Reisenden ihre Pferde versorgt und ein kleines Zelt an einer Mauer errichtet hatten, war das Tageslicht erloschen, bis auf einen dünnen, grünlich schimmernden Streifen am westlichen Horizont. Lauten- und Flötenklänge, untermalt vom Rhythmus der Tamburine, lockten sie durch den Fackelschein zur Halle. Heitere Stimmen drangen ihnen entgegen, einige Festgäste kamen in den Burghof, glänzten in ihrem Staat aus Samt und Seide wie bunte Nachtfalter. Einer prostete den drei Fremden mit seinem Becher zu und begrüßte sie lallend.
»Wir hätten nicht herkommen dürfen«, meinte der ältere Mann besorgt, die Hände um seinen abgewetzten Ledergürtel gekrallt. An seiner Rechten fehlten der Zeige- und Mittelfinger, an den drei restlichen wuchsen keine Nägel.
»Keine Bange, Matthias.« Die junge Frau strich besänftigend über seinen Ärmel. »Hier sind wir nicht in Gefahr, und wir müssen wenigstens in dieser Nacht essen und uns ausruhen. Onkel Chretien soll für uns sprechen.«
»Kann uns hier wirklich nichts zustoßen?« Unsicher flackerten seine Augen.
»Nichts, glaub mir.« Sie drückte seinen Arm und wandte sich zu ihrem anderen Begleiter. Chretien verstand die stumme Bitte, glättete sein schütteres dunkles Haar und betrat die Halle. Die Frau führte den widerstrebenden Matthias hinein und fragte sich, ob er jemals überwinden würde, was man ihm angetan hatte.
Mit einiger Mühe fand Montvallants zweiter Hausverwalter am unteren Ende der Tafel Plätze für die neuen Gäste. Sie saßen etwas beengt, aber das machte ihnen nichts aus. Sie waren froh, dass sie ihre Müdigkeit mit Speise und Trank bekämpfen konnten. Die Tischnachbarn, sichtlich beschwipst und in bester Festlaune, schenkten ihnen keine Beachtung, doch das störte sie ebenso wenig.
»Noch etwas Brot, Bridget?« Onkel Chretien reichte der jungen Frau einen randvollen Korb.
Lächelnd schüttelte sie den Kopf. »Danke, ich könnte keinen Bissen mehr hinunterbringen.« Sie nahm ihren Hut ab, stützte die Arme auf den Tisch und beobachtete wehmütig die Tänzer. Dies war eine andere Welt, in die sie nur ab und zu einen Blick werfen durfte, ohne sie jemals näher kennenzulernen. Sie wusste auch gar nicht, ob sie dieser Welt angehören wollte – höchstens für eine Nacht und einen Tag. Sie sah die Farbenpracht, die unbeschwerte Fröhlichkeit, die nichts über den Augenblick hinaus ersehnte. Manchmal fiel es ihr schwer, Pflichten zu erfüllen, die das Schicksal ihr auferlegt hatte.
Die Tänzer wirbelten zum Ende der Tafel. Ein junger Mann, von ausgelassenen Leuten mitgerissen, versuchte ihnen lachend – und nicht allzu nachdrücklich – zu entrinnen. Bridgets Atem stockte, als ihr seine stolze männliche Schönheit auffiel, die Anziehungskraft seines starken Körpers. Plötzlich fühlte sie die Freude, die ihn durchströmte, so lebhaft, dass sie selbst davon erfüllt wurde. Er schaute kurz in ihre Richtung, und sie senkte rasch den Blick, starrte einen Weinfleck auf der Tischplatte an, und ihr Herz pochte schmerzhaft. Was für Augen – so blau wie ein Eichelhäherflügel ...
»Was hast du?« Chretien hatte ihre Verwirrung sofort bemerkt.
»Nichts«, erwiderte sie und zwang sich zu einem Lächeln. »Vielleicht steigt mir die Musik genauso zu Kopf wie der Wein.« Beunruhigt runzelte er die Stirn, aber ehe er sie ermahnen konnte, dem frivolen Überschwang zu widerstehen, brach im ganzen Saal heller Jubel aus. Die Leute johlten und pfiffen anerkennend. Bridget beobachtete, wie der junge Mann von seinen Freunden zur Turmtreppe gezerrt wurde, und reckte den Hals. »Was geschieht denn da?«
Die Frau, die neben ihr saß, neigte sich kichernd herüber, ohne das Getümmel aus den Augen zu lassen. »Ihr meint wohl, was geschehen wird! Die Zeremonie des Hochzeitsbetts ... Nun wird’s Zeit, dass sich Herr Raoul und seine junge Frau näher kennenlernen.«
»O ...« Bridget nickte, von unbewusster Enttäuschung erfasst. Also deshalb spürte ich die Kraft, die er ausstrahlt – die ihrem Ziel entgegenstrebt, dachte sie. Eine junge Frau verließ das Podest am Kopfende der Tafel und wurde von mehreren Damen und Zofen zu einem anderen Treppenaufgang geführt. Sie bewegte sich anmutig wie ein Reh und wirkte genauso scheu.
Bridget spielte mit dem Hut auf ihren Knien. Entschlossen wünschte sie dem Brautpaar alles Gute. Neid passte weder zu ihrer Erziehung noch zum Katharer-Glauben ihrer Beschützer, aber an diesem Abend brannte er in ihrem Herzen. Sie spürte, wie Chretien und Matthias sie prüfend musterten. Beide waren erregt und angespannt. Lächelnd hob sie den Kopf und stand auf. »Ich bin müde und möchte mich hinlegen ... Nein, nein, trinkt nur euren Wein aus, ich bin gern ein bisschen allein.«
Eine Falte bildete sich zwischen Chretiens buschigen Brauen. »Du würdest uns doch Bescheid geben, wenn etwas nicht stimmt?«
»Natürlich«, versicherte Bridget und zögerte kurz. »Ich empfinde etwas Seltsames, ein Licht in meiner Seele, geheimnisvoll wie der Mond. Noch kann ich nicht hindurchschauen.«
Ein Licht innerhalb des Lichts, dachte er und wusste, wie hell es zu glühen vermochte. Das Licht, das die Welt bewegt, das Licht des reinen Geistes ... Ihre Finger berührten seine Schulter. Als sie davonging, drehte er sich um und schaute ihr nach. Sie war so geschmeidig wie ein junger Baum und doch erfüllt von uralter Weisheit – und so verletzlich ...
Prachtvolle Farben beherrschten das komfortable, kostbar ausgestattete Schlafgemach, wo das jungverheiratete Paar die Hochzeitsnacht verbringen sollte. Wandteppiche in Scharlachrot, Blau und Gold hielten die Zugluft fern, die Fresken dazwischen stellten Szenen des täglichen Lebens dar, vor allem ländliche Motive wie Schafzucht und Weinbau.
In der Mitte stand das Nussbaumbett, eher ein reich geschmücktes Podium für die Rituale der Empfängnis, der Geburt und des Todes. Vorhänge aus blauem und rotem Brokat, bestickt mit den Sinnbildern der Jungfrau und des Einhorns, schirmten das Lager gegen den restlichen Raum ab. Eine Tagesdecke aus dunkelblauem Sarsenett verbarg die weißen Kissen und Leintücher. Sterne aus Silberfäden, rings um die aufsteigende Venus, symbolisierten den Nachthimmel, im Baldachin wiederholte sich das Muster.
Flammen loderten im Herd, und eine Zofe ließ ein Getränk aus Wein und Gewürzen darauf sieden, während mehrere weibliche Hochzeitsgäste die Braut auszukleiden begannen. Beatrice, die Schwiegermutter, führte sie zum Feuer und bat sie, auf ein Mufflonfell zu treten. »Damit deine Füße nicht frieren ...« Warmherzig umarmte und küsste sie Claire. »Welch ein Glückstag für mich! Ich bin so stolz, weil ich dich endlich zu Recht meine Tochter nennen darf.«
Claire erwiderte die Umarmung, aber ihr Magen krampfte sich zusammen, als sie daran dachte, was ihr bevorstand. Alle Frauen würden sie küssen und ihr Glück wünschen, ebenso die Männer in Raouls Gefolge – und zuletzt er selbst ...
Ein paarmal hatten sie sich schon geküsst, aber immer unter strenger Aufsicht, und nie eine Gelegenheit gefunden, intimere Zärtlichkeiten auszutauschen. Sie erschauerte und fragte sich fast verzweifelt, worüber sie reden würden. An diesem Tag war ihnen im Zwang all der Zeremonien und Traditionen ein normales Gespräch unmöglich gewesen. Wie zwei unsichere Fremde hatten sie beisammengesessen und kaum ein Wort hervorgebracht.
Und jetzt wurde von ihnen erwartet, dass sie miteinander schliefen und am nächsten Morgen ein beflecktes Laken vorzeigten, zum Beweis der Jungfräulichkeit, die männlicher Kraft zum Opfer gefallen war. Claire hätte gelacht, wäre ihr nicht so unbehaglich zumute gewesen.
Aus ihrem Haar wurden die Nadeln gezogen, die den Gazeschleier und den Kranz aus steifen goldenen Blumen festgehalten hatten. Ihre Mutter ergriff eine Bürste aus Eberborsten, um den rotgoldenen Locken noch mehr Glanz zu verleihen. »Wie schön du bist, mein Kind ...« Stolz, aber auch Trauer schwangen in Alianor d’Agens verhaltener Stimme mit. Es war schmerzlich, die Tochter gehen zu lassen, trotz der guten Partie.
»Mama, pass heute Nacht auf Isabelle auf«, bat Claire leise und neigte den Kopf zur Seite, als die Bürste an ihren Haaren zog.
Ihre Mutter hielt inne und hob fragend die Brauen, dann schaute sie zur Zofe hinüber, die das Brautgewand ordentlich an einen Kleiderständer hängte. Sie war nur ein Jahr jünger als Claire, ein sanftmütiges, fügsames Mädchen aus einer Katharer-Familie von etwas niedrigerem Stand.
Claire mochte sie sehr und sah eher eine Freundin in ihr als eine Dienerin. »Ich traue Vater Otho nicht. Den ganzen Abend starrte er sie an, und einmal kniff er sie sogar in die Hüfte, als er glaubte, niemand würde hinschauen. Mama, du weißt ja, wie still sie ist. Sie würde niemals ein Aufheben machen, und ich möchte nicht, dass ihr etwas zustößt.«
Erbost presste Alianor die Lippen zusammen, nicht wegen der Bitte, die an sie gerichtet wurde, sondern wegen deren Grund. »Sorg dich nicht, doucette, ich will gut auf sie achten. Der Mann macht seinem Amt nur Schande, und man sollte ihn auspeitschen.« Sie hatte leise gesprochen, denn Vater Otho war der Geistliche der Montvallants, denen sie freundschaftlich verbunden war und Höflichkeit schuldete.
Aber Beatrice de Montvallant besaß scharfe Ohren. »O ja, du hast recht«, stimmte sie grimmig zu. »Er ist entfernt mit Berenger verwandt, und wir hatten seiner Familie versprochen, ihm die Kirche von Montvallant zu überlassen, wenn er die Priesterweihe erhalten würde. Damals war Raoul noch ein kleines Kind, und seither bereuen wir unseren Entschluss. Zehn Jahre lang bin ich nicht mehr zur Beichte gegangen, weil ich es nicht ertrage, diesem Mann etwas anzuvertrauen.«
»Warum behaltet Ihr ihn dann?«
Ärgerlich zuckte Beatrice die Achseln. »Aus Pflichtbewusstsein – aus Schuldgefühlen unserem vernachlässigten Glauben gegenüber ... Wenn der Bischof zu Besuch kommt, können wir wenigstens einen Priester vorweisen, obwohl zwei Drittel der Stadtbewohner keinen Fuß in die Kirche setzen. Aber du hast recht, wir zahlen einen zu hohen Preis für diesen Vorteil.« Sie legte eine Hand auf Claires Arm und beteuerte: »Was in meiner, Berengers und Raouls Macht steht, soll geschehen, um deine Zofe zu schützen, solange sie in Montvallant bleibt.«
»Danke – Mutter.« Das letzte Wort kam nur mühsam über Claires Lippen. Obwohl sie Beatrice mochte, fiel es ihr schwer, sie so vertraut anzusprechen. Mit der Zeit würde sie es sicher lernen, aber nun erschien es ihr – so wie alles andere – neu, fremdartig und beängstigend.
Die kalte Nachtluft wehte über ihre nackte Haut und ließ sie erschauern. Isabelle hängte das leinerne Unterhemd an den Kleiderständer zu den anderen Brautsachen, und ihre Tochter setzte sich ans Fußende des Betts, wo ihr die Frauen die Strumpfbänder lösten. Im Hintergrund spielten zwei Musiker Laute und Harfe.
Kühle Seide glitt über ihre Schultern, als man ihr in ein weit geschnittenes Nachthemd half, dann wurde ihr schimmerndes rötliches Haar auf dem zarten Stoff drapiert. Ihre Zähne klapperten, ihre Hände waren eiskalt. Die Frauen sprachen mit ihr, aber das Blut rauschte in ihren Ohren, und so verstand sie kein einziges Wort. Dann merkte sie, dass es nicht an ihren heftigen Herzschlägen lag, sondern an der lautstarken Ankunft der Männer, die mittlerweile ein anderes Turmzimmer verlassen hatten.
In ihrer Mitte zogen sie Raoul mit sich, der unter seinem grünen Wollumhang nackt war. Gellendes Gelächter und gutmütige Scherze klangen auf. Claire hob die Lider und sah, wie das Blut in die Wangen ihres Bräutigams stieg. Mit einer bedauernden kleinen Geste und einem Lächeln – so nervös und gezwungen wie ihr eigenes – erwiderte er ihren Blick. Sie nickte ihm zu, dann starrte sie wieder auf die helle Seide hinab, die ihre Knie bedeckte.
Beatrice drückte ihr einen Becher Glühwein in die Hände. »Trink das und fasse Mut«, wisperte sie, umarmte sie aufmunternd und trat beiseite.
Der Wein schmeckte nach Zimt und heißen roten Trauben. Raoul ließ sich neben seiner Braut nieder, nahm ihr den Becher aus der Hand und setzte den Rand an seine Lippen, die gleiche Stelle, wo sie zuvor getrunken hatte. Dann schlang er einen Arm um ihre Schultern.
Wieder schrien und jubelten die Männer. Claires Gesicht brannte, als sie Raouls Hand durch die dünne Seide ihres Nachthemds spürte. Mit beiden Ellbogen bahnte sich Vater Otho einen Weg durch die Menge, um dem Paar den Segen zu erteilen, der es endlich von den Zuschauern befreien, das Bett reinigen, Gottes Gnade auf die Ehe und deren künftige Früchte herabbeschwören würde. Er war berauscht, seine feuchten schwarzen Augen glitzerten. Lüstern starrte er die Braut an. »Noch vor Kurzem wart Ihr eine zarte Knospe, und jetzt seid Ihr eine voll erblühte Rose – bereit, gepflückt zu werden.« Einen zitternden Finger an die Nase gelegt, zwinkerte er dem Bräutigam zu.
Zorn und Scham stiegen in Claire auf. Harmlose Scherze konnte sie hinnehmen, sie gehörten zur Hochzeitstradition. Jedes jungvermählte Paar wurde geneckt, aber nicht von einem Priester, dessen Züge sich vor Trunkenheit und Wollust verzerrten. Raoul wollte sich auf ihn stürzen, aber seine Mutter umklammerte ihres Sohnes Arm.
Berenger, dessen Wangen der Wein ebenfalls leicht gerötet hatte, wandte sich in sanftem Ton an den Geistlichen. »Ich schlage vor, Ihr begnügt Euch mit den Segensworten.«
Plötzlich war still im Raum geworden, bis auf die leise Musik im Hintergrund. Der Priester versuchte, sich aufzurichten, stand aber auf unsicheren Beinen und fiel seitwärts gegen einen der Gäste. »Kein Humor«, lallte er und wahrte mühsam sein Gleichgewicht. »Niemand kann einen Witz vertragen.« Wie ein schmollendes Kind schob er die Unterlippe vor, war aber klug genug, um ans Bett zu treten und die lateinischen Segensworte zu murmeln, wenn auch kaum verständlich und nicht in der richtigen Reihenfolge. Nachlässig versprühte er Weihwasser und hielt den jungen Eheleuten ein Kreuz hin, das sie küssen mussten.
Claire fühlte sich elend. Der Priester atmete röchelnd wie eine Dogge und stank überwältigend nach Schweiß. Sie wäre nicht überrascht gewesen, hätte sie unter dem Saum seiner Kutte die gespaltene Spitze eines Schweifs zucken sehen.
Unfähig, das Kreuz mit ihren Lippen zu berühren, küsste sie nur die Luft darüber. Isabelle hatte erklärt, es sei nur ein Symbol, das Falschheit verkörpere, und in diesem Augenblick begann Claire, ihr zu glauben. Auch Raoul deutete den Kuss nur an, das Gesicht von mühsam unterdrückter Wut verkrampft. In kurzen Abständen blitzte die goldene Schließe seines Umhangs auf, von der breiten Brust bewegt, die heftige Atemzüge hoben und senkten.
Vater Otho bekam einen Schluckauf und rülpste grinsend. »Nun geht ans Werk, mein Junge. Hoffentlich könnt Ihr uns morgen ein blutgetränktes Laken zeigen, eh?« Sein anzügliches Kichern ging abrupt in einen Schreckensschrei über, als Raoul aufsprang, ihn am Halsausschnitt der schmutzigen, mit Speiseresten befleckten Kutte packte und hochhob.
»Schade, dass Ihr nicht lange genug leben werdet, um es zu sehen!«, fauchte der Bräutigam und zog den Ausschnitt noch enger zusammen.
Der Priester lief dunkelrot an, ein halb erstickter Laut entrang sich seiner Kehle, die Adern an seinen Schläfen schwollen. Nur widerstrebend griff Berenger ein und löste die Finger seines Sohnes von Othos Luftröhre. »Lass ihn, Raoul. Du willst deine Hochzeitsnacht doch nicht mit einem Mord besudeln.«
»Nein?«, stieß Raoul zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Aber er gab nach und schüttelte die schmerzende Hand, während er den halb Bewusstlosen anstarrte, der ihm zu Füßen sank.
Gebieterisch winkte Berenger zwei Diener herbei. »Bringt Vater Otho hinaus und lasst ihn irgendwo liegen. Da soll er seinen Rausch ausschlafen.«
»Draußen, Herr?«
»So nahe beim Misthaufen, wie es sein Benehmen erfordert.«
»Sehr wohl, Herr.« Von grimmiger Genugtuung erfüllt, hoben die beiden Männer den Priester hoch und schleppten ihn aus dem Zimmer. Achtlos ließen sie seinen Kopf gegen die Wand prallen.
Berenger entschuldigte sich bei allen Anwesenden, immer noch hochrot im Gesicht. »Nun ist es höchste Zeit, dem Brautpaar Ruhe zu gönnen«, fügte er barsch hinzu. Erst umarmte er Raoul, dann Claire in angstvoller Fürsorge. »Dieser Mann soll euch beiden nicht die Nacht verderben.«
»Nein, Papa.« Raouls Lächeln wirkte zuversichtlicher, als er sich fühlte. An seiner Seite zitterte Claire, das Gesicht reglos wie durchscheinendes Eis.
Die Gäste beglückwünschten sie und entfernten sich. Dann ging Raoul zu den Musikern, die immer noch leise spielten, gab ihnen eine Handvoll Silberlinge und entließ sie. Das Schweigen, das nun eintrat, nachdem alle gegangen waren, erschreckte Claire.
Sie nippte am Wein, doch er war inzwischen kalt geworden. Um ihre Panik zu bekämpfen, eilte sie zu dem Krug, den Isabelle auf den Herd gestellt hatte, schüttete den Rest aus dem Becher ins Feuer und füllte ihn noch einmal.
Das Zischen der Tropfen durchbrach die Stille. Wie gebannt schaute Claire in die tanzenden Flammenspitzen. Die Hitze wärmte ihre Wangen, und als sie den Wein kostete, glaubte sie, das Herz des Feuers zu trinken. Sie versuchte die Füße zu bewegen, doch sie gehorchten ihr nicht, ebenso wenig wie ihr Blick, der sich nicht vom lodernden Spiel aus Licht und Schatten losreißen konnte.
Raoul hatte die Tür verriegelt. Nun kehrte er zu seiner Frau zurück und sah, dass sie Gefahr lief, ihr Nachthemd zu versengen. Warnend schrie er auf und zog sie vom Herd weg. Sie blinzelte durch unzählige Flammenzungen, die sich in ihren Augen zu spiegeln schienen, und berührte ihre Stirn. »Claire?« Er umfasste ihre Schultern und musterte besorgt ihr Gesicht, das nicht mehr bleich war, sondern vom Feuerschein gerötet.
»Tut mir leid. Es war ein langer Tag, das ist alles.«
»In so mancher Hinsicht ...« Er schnitt eine Grimasse. »Und ich schwöre dir, ich würde es nicht bereuen, hätte ich Vater Otho erwürgt.«
Die Erinnerung an den Priester, der das Hochzeitsgemach verunreinigt hatte, statt es zu segnen, verstärkte ihre Müdigkeit und innere Anspannung. Ein schmerzhafter Klumpen saß in ihrem Hals und ließ sich nicht hinunterschlucken. Eine Hand an die Lippen gepresst, unterdrückte sie ein Schluchzen. »Es tut mir so leid, Raoul ...«
Ihr Kummer schnürte auch ihm die Kehle zu. Er nahm eine Hand von ihrer Schulter, um ihre Wange zu streicheln. Ihre Haut fühlte sich so zart an wie eine feuchte Rosenblüte. »O Gott, du brauchst dich wirklich für nichts entschuldigen ...« Was er nun tun sollte, wusste er nicht so recht. Schließlich zog er sie an sich, um sie zu trösten, und spürte, wie ihr Körper bebte. Sie vergrub das Gesicht in seinem Umhang und erstickte ihr Schluchzen zwischen den weichen Falten. Raoul presste seine Lippen in ihr Haar, das nach Kräutern duftete, an ihre Schläfe – noch heiß vom Herdfeuer.
Dann nahm er ihr Gesicht in beide Hände, küsste eine tränennasse Wange, einen Mundwinkel, die vollen Lippen. Wenn er auch keine reichhaltigen Erfahrungen mit Frauen gesammelt hatte, so war er nicht unschuldig. Gelegentlich hatte er die maisons lupanardes in Toulouse besucht, wo eine der Huren eifrig bestrebt gewesen war, ihm beizubringen, dass man bei der körperlichen Liebe größere Freuden genießen konnte als die schlichte Erfüllung seiner früheren kurzfristigen Begegnungen.
Trotzdem wuchs seine Nervosität. Claire war noch Jungfrau, außerstande, ihm zu helfen, wenn er sie berührte, und genauso aufgeregt wie er selbst – aber auch sehr begehrenswert. Und so mischte sich in seine Unsicherheit das Prickeln jungen, erhitzten Blutes. Zwischen seinen Küssen flüsterte er beruhigende Worte, hielt sie ganz sanft umfangen und achtete nur auf ihr Verhalten, um sich von seiner eigenen, drängenden Sinnenlust abzulenken. Er wusste, dass sie sein Verlangen spürte, denn es ließ sich unmöglich verbergen, da er nur einen Umhang und sie das dünne, seidene Nachthemd trug.
»Du bist so schön«, murmelte er mit belegter Stimme. »Um nichts auf der Welt möchte ich dir wehtun.«
»Das – weiß ich. Und vor dir fürchte ich mich nicht.«
Die seltsame Betonung entging ihm nicht. »Wovor dann?«
Sie lehnte an Raouls Brust, ihre Wange fühlte seinen Herzschlag. »Vorhin blickte ich in die Flammen, und da wurde ich von unheimlichem Grauen erfasst – als würde die ganze Welt brennen und ich könnte nichts tun, um die Gefahr abzuwenden. In meiner Kindheit träumte ich, ein Feuer würde mich verschlingen. Eines Tages kam ein Priester nach Agen und predigte von der Höllenglut, die alle Ketzer verzehren würde. Meine Mutter sagte, danach sei ich monatelang von Albträumen heimgesucht worden.«
»Diese Priester!«, stieß Raoul hervor. »Sicher fahren sie alle zur Hölle. Vergiss sie, Claire. Heute Nacht geht es nur um uns beide.« Er presste seinen Mund wieder auf ihre Lippen, griff verstohlen nach dem Band, das ihr Hemd zusammenhielt. »Und wenn wir brennen, dann nur vor Freude.« Seine Hände glitten über ihre nackte Haut.
Mit einem leisen, atemlosen Schrei überließ sie sich seinen Zärtlichkeiten. An seinen kraftvollen Körper geschmiegt, verbannte sie ihre bösen Ahnungen und sehnte sich ebenso begierig nach dem Ehebett wie er, wenn auch aus anderen Gründen.
2
Bridget saß mit gekreuzten Beinen vor den hohen, stillen Zinnen von Montvallant und atmete tief die frische Luft ein, in der immer noch nächtliche Kälte lag. Ihr Blick suchte den Osten, wo die Sonne bald aufgehen würde. Der Himmel jenseits der Schartenbacken schimmerte wie das perlweiße Innere einer Austernschale. Leise begann sie heilige Worte zu singen, die ihr die Mutter beigebracht hatte und die seit über tausend Jahren alle Frauengenerationen in der Familie kannten.
Vor ihren Augen begannen sich die Mauern ringsum aufzulösen. Licht pulsierte in ihr, wechselte die Farbe, durchströmte und erfüllte sie, bis sie einem Becher glich, voll bis zum Rand mit übergroßer Macht. Ein Sonnenstrahl brach aus den Wolken und fiel zwischen den Zinnen auf Bridgets Gesicht. Der Schmerz war fast unerträglich. Flüssiges Feuer verzehrte ihren Körper, bis sie heller strahlte als das Licht und sich in eine brennende Scheibe verwandelte, die darüber schwebte, wie ein Rad kreiste. Als wäre sie ein Adler, der hoch in den Lüften seine Schwingen ausbreitete, blickte sie mit scharfen Augen auf die winzigen Gestalten hinab.
Der Himmel glühte schwarz, und ein Mann wurde an ein Kreuz genagelt. Heftiger Schmerz durchfuhr sie, als sich Nägel in seine Füße und Hände bohrten. Vor dem Kreuz sah sie eine dunkelhaarige Frau weinen. Ein Kind klammerte sich an ihre Röcke, ein kleines Mädchen mit Bridgets Kristallaugen. Immer schneller drehte sich das Rad, leuchtete immer heller. Flammen loderten, dichter Rauch quoll empor, und in den dunklen Schwaden erklangen das Geheul der Männer, die Klagen der Frauen.
Das Feuer nährte sich von Blut, und Bridget zuckte unwillkürlich zurück. Die Hitze versengte ihr Haar und Brauen. Sie war nicht mehr eins mit dem Himmel, sondern mit den Flammen, mit all den Menschen, die darin brannten. Ein stummer Schrei drängte sich über ihre Lippen, und sie kämpfte, um sich zu befreien.
Durch das Feuer schritt ein junger Mann auf sie zu, ein Schwert in der Hand, das Gesicht von Verzweiflung gezeichnet. Er kam ihr so nahe, dass sie die Sparren im Wappen des Überwurfs sah, der seine Rüstung bedeckte, die braunen Bartstoppeln an seinem Kinn, die Tränen, die seine ausdrucksvollen blauen Augen blendeten. Hinter ihm stand eine Frau mit offenem, kupferrotem Haar.
Auch sie weinte, streckte die Arme nach ihm aus, aber das Feuer loderte wild empor und trennte die beiden. Ohne zurückzuschauen, eilte der junge Mann zu Bridget und kniete vor ihr nieder. Ihre Blicke trafen sich, und der Name Raoul de Montvallant durchzuckte ihren Geist wie eine Flammenspitze. Er legte sein Schwert in ihre Hände, und sie schloss die Finger darum, immer fester, bis beide Klingen in ihre Haut schnitten und ihr Blut wie ein dünner scharlachroter Faden über den geschnitzten Griff rann. Als der Sonnenball im vollen Glanz am Horizont erschien, begann sie, alles zu verstehen.
Im Brautgemach warf sich Raoul stöhnend hin und her, von einem wirklichkeitsnahen Traum gequält. Bilder von Flammen und funkelnden Waffen flackerten durch sein Gehirn. Er hörte Männergeschrei, triumphierend oder schmerzlich, und das angstvolle Wiehern der Pferde.
Und er wusste, dass er um sein Leben kämpfte. Sein Arm tat so weh, dass er das Schwert kaum noch heben konnte, um die Hiebe abzuwehren, die auf ihn herabregneten. Das an sich war seltsam, denn er hatte noch nie in einer Schlacht gefochten, geschweige denn bis zur Erschöpfung. Ein Ritter sprengte ihn nieder. Ein weißes Pferd, ein weißer Waffenrock, mit einem blutroten Kreuz geschmückt, weißes Licht an der Spitze des Schwerts, das herabsauste ...
Mühelos bohrte sich die Schneide in Raouls Schild, als bestünde er aus Brotteig. Die Welt umschattete sich, und durch das Dunkel suchte ihn eine Frauenstimme, fragte nach seinem Namen, zog ihn zum Licht. In der Ferne sah er sie, wehendes schwarzes Haar, ausgestreckte Hände. Er folgte der Lockung, die ihn aufwühlte bis in die Tiefen seiner Seele, und plötzlich schaute sie ihn an. Ihre grauen Kristallaugen schnitten in sein Fleisch, bis er blutete.
»Raoul, um Himmels willen, wach auf! Raoul!«
Sein Schrei, von Furcht und Schmerz durchdrungen, hallte in seinem Schädel wider, als er sich von der Traumfrau losriss und in den Sonnenschein seines Schlafgemachs emportauchte, die Augen weit geöffnet.
Immer noch rief eine Stimme nach ihm, aber sie klang sanft und besorgt. Kupferrotes Haar kitzelte seine nackte Brust, Claires ängstliches Gesicht neigte sich über ihn. »Du hast geträumt.«
»Geträumt!« Er erschauerte. »Beim Himmel, noch nie im Leben empfand ich ein solches Entsetzen!« Gepeinigt legte er eine Hand über seine Augen. Schweiß tränkte das Laken, das wie ein Leichentuch an seinem Körper klebte. Durch das geölte Leinen, das die Bogenfenster verhüllte, sickerte Sonnenlicht, draußen auf dem Sims gurrten die Tauben seiner Mutter. Neben ihm lag Claire, das Haar zerzaust und bildschön, aber er fühlte sich wie ein Kater, der von achtloser Hand gegen den Strich gestreichelt wurde.
»Was hast du geträumt?«
»Ich erinnere mich nicht genau – nur an eine Schlacht und eine Frau, die immer wieder nach meinem Namen fragte, bis ich gezwungen war, ihn zu verraten.« Wieder überlief ihn ein Schauer. »O Gott, es kommt mir so vor, als wären meine Adern mit Eis gefüllt.«»Vielleicht wegen der Ereignisse in der letzten Nacht?«
Raoul wandte ihr den Kopf zu und runzelte die Stirn. »In der letzten Nacht?«
Unter seinem prüfenden Blick errötete sie. Viele Dinge waren in dieser Nacht geschehen, nicht nur unangenehme. »Ich meine Vater Otho – den dummen Zwischenfall. Vielleicht hast du deshalb von einem Kampf geträumt.«
»Mag sein.« Aber er war nicht überzeugt.
Draußen polterten Wagenräder, und man hörte die fröhliche Stimme eines Wächters, als das Burgtor geöffnet wurde. Raoul schob das feuchte Laken beiseite und setzte sich auf. Das Leintuch unter ihm hatte bräunliche Flecken, getrocknetes Blut, und seine Schultern waren wund, weil Claire im Augenblick der Entjungferung ihre Fingernägel in seine Haut gegraben hatte. Schuldbewusst schaute er sie an, und sie erwiderte seinen Blick, die volle Unterlippe zwischen den Zähnen. »Tut mir leid, wenn ich ungeschickt mit dir umgegangen bin«, sagte er verlegen. »Vielleicht siehst du es anders, aber es war eine Huldigung an deine Schönheit. Ich konnte nicht länger warten.«
Da lächelte sie. »Es tat nur am Anfang weh. Und dann vergaß ich den Schmerz.« Errötend senkte sie den Kopf.
»Du bist mir also nicht böse?«
Die Röte überflog sie bis hinab zu den Brüsten, die von dem Laken bedeckt wurden, und ließ neues Verlangen in ihm aufsteigen.
»Nein, ich bin nicht böse ...« Als er sich zu ihr beugte, fügte sie rasch hinzu: »Es ist nur – es brennt ein bisschen, aber deine und meine Mutter versicherten mir, das würde bald nachlassen.«
Weder ihre Stimme noch ihre Haltung drückten Abwehr aus, aber er spürte, wie sich ihr Körper ein wenig anspannte. Da erkannte er, dass es an diesem Morgen besser wäre, seine Bewunderung mit sanften Worten und Liebkosungen auszudrücken, statt sie erneut mit seiner Leidenschaft zu bestürmen. Nun brauchte sie erst einmal etwas Zeit für sich allein, dann mit den anderen Frauen; und er musste sich von dem Schrecken seines Traums erholen. Zärtlich küsste er ihre Nasenspitze und einen Mundwinkel, dann verließ er das Bett, um sich anzukleiden. »Ich schicke deine Zofe zu dir«, versprach er auf dem Weg zur Tür.
Dankbar lächelte sie und sank ins Bett zurück.
Chretien stand am Brunnen und füllte die Wasserflaschen für die weite Reise, als Bridget von den Zinnen herunterstieg. Wortlos half sie Matthias, die Schlafmatten zusammenzurollen und das Zelt abzubauen.
Sie hatte sich angewöhnt, bei Sonnenaufgang nach Einsamkeit zu suchen, und manchmal, wenn sie von ihren Meditationen zurückkehrte, schien die Luft rings um sie zu schimmern – so wie an diesem Morgen.
Beklommen dachte Chretien an das geheime, kaum zu fassende Wissen, das sie zu dritt teilten – den mächtigen Faden, der den gesamten Webteppich des Lebens verändern konnte. Hin und wieder jagte ihm dieses Wissen Angst ein. Es hatte seinen Bruder und die Frau seines Bruders getötet, und es bedrohte Bridget, Matthias und ihn selbst sogar noch schrecklicher.
Unentwegt wurden sie von Innozenz’ Häschern gejagt, die verzweifelt danach strebten, sich das Wissen anzueignen, es zum Schweigen zu bringen, zu vernichten. Er verschloss die Flaschen, schlenderte vom Brunnen zu seinen Gefährten und den Pferden.
Obwohl Matthias von seiner verstümmelten Hand behindert wurde, schnallte er seinen Packen geschickt auf die Kruppe seines Hengstes. Die Verunstaltung war eine Strafe für die Übersetzung hebräischer Schriften, die Rom verboten hatte, deren Existenz es nicht wünschte. Jetzt schrieb er mit seiner linken Hand.
»Sind wir bereit?« Chretien verteilte die gewünschten Flaschen. Die Frage war nicht an Matthias gerichtet, der sich zu Recht an allen Orten, wo Menschen hausten, unsicher fühlte und nur zu gern weiterzog, sondern an Bridget.
Ein geistesabwesender Ausdruck lag in ihren Augen, während sie die Riemen ihres Bündels festzurrte. Er musste sie berühren und seine Frage wiederholen, ehe sie ihn verstand, und ihre Antwort ließ ihn schaudern.
»Wir werden immer vorbereitet sein, aber niemals bereit.« Geschmeidig wie ein Jüngling schwang sie sich in den Sattel und ergriff die Zügel.
Chretien öffnete die Lippen, doch dann beschloss er, die Bedeutung ihrer Worte lieber nicht zu erforschen, nicht hier und jetzt. Er stieg auf sein eigenes Pferd und zog an der Leine den Packesel mit. Auf dem Weg zum Tor ritten sie an einem Misthaufen vorbei, und daneben sahen sie einen schnarchenden Priester auf dem Bauch liegen, durchnässt wie ein marinierter Kalbsschlegel.
Der Anblick überraschte Chretien nicht, stimmte ihn aber sehr traurig.
»Verstehst du nun, was ich meine?«, fragte Bridget leise, als sie das Dunkel zwischen dem Fallgatter und dem Tor erreichten. »Vorbereitet – aber niemals bereit ...«
3
Friedliche Stille herrschte am Flussufer. In der Mittagshitze spendeten die Bäume entlang des Flusses Tarn willkommenen Schatten. Die Familie Montvallant war mit ihren Gästen, befreundeten Nachbarn, von der Burg heruntergeritten, um eine Mahlzeit am Wasser einzunehmen. Aimery de Montréal und Berenger kannten einander seit der Kindheit, und gemeinsame Leidenschaft für die Falkenjagd verband sie umso enger.
Aimerys Schwester Geralda, châtelaine des Schlosses Lavaur im Süden von Montvallant, war Beatrices Vertraute und eine formidable Persönlichkeit. Sie pflegte unverblümt ihre Meinung zu äußern und kümmerte sich nicht um die etwaigen Folgen ihrer Offenherzigkeit – eine gefährliche Neigung, da sie felsenfest an die Katharer-Religion glaubte, auch wenn sie die endgültigen Gelübde noch nicht abgelegt hatte.
Ein wenig abseits von den vier älteren Leuten, hinter einem Schutzschild aus Weiden, jungen Eschen und hohem Gras, hob Raoul den Kopf, um ihn noch bequemer in Claires Schoß zu betten, und schloss die Augen. Lächelnd neigte sie sich über ihn, und ihr Herz schlug schneller, als sie den schön geschwungenen Mund betrachtete und sich an sein sinnliches Spiel auf ihrer nackten Haut erinnerte. Seine Wimpern waren kurz und dicht wie der gemähte Rasen im Lustgarten der Burg, und wann immer er die Lider öffnete, gelang es seinem Blick, bis auf den Grund ihrer Seele zu schauen und ihr Innerstes aufzuwühlen.
Verstohlen griff sie nach den hohen Grashalmen und pflückte einen mithilfe ihrer scharfen Fingernägel. Sie unterdrückte ein Kichern, ließ die dicke Samenkapsel am Ende des Halms über Raouls Nase baumeln. Er zuckte zusammen, hob träge eine Hand, um zu verscheuchen, was er offensichtlich für eine Mücke hielt. Claire wartete eine Weile, dann kitzelte sie ihn wieder, und er versuchte, die Belästigung genauso abzuwehren wie zuvor.
Beinahe hätte sie laut aufgelacht, aber sie presste die Lippen fest zusammen. Trotzdem entschlüpfte ihr ein leiser, halb erstickter Laut. Ihr Mann schien nichts zu hören, und bald strich der Halm noch einmal über seine Nase. Da packte er blitzschnell ihren Arm, zog sie ins Gras hinab und warf sich auf sie. Grinsend hielt er ihre Handgelenke fest. »Und was willst du jetzt machen?«
Schamlos wand sie sich unter ihm, hob ein wenig den Kopf, um einen Kuss herauszufordern, und zog anmutig die Brauen hoch. »Soll ich um Gnade flehen?«
»Und wenn ich sie gewähre – was bekomme ich dafür?«
Sie küssten sich, und er ließ ihre Unterarme los, um sich auf einen Ellbogen zu stützen und sie zu liebkosen. Ihre Hände glitten unter seine Tunika, über seine erhitzte Brust. Warme Wellen durchfluteten ihren Körper, sammelten sich im Unterleib, wo sie den Druck seiner erregten Männlichkeit spürte. »Du forderst sehr viel, mein Gemahl«, flüsterte sie an seinen Lippen.
»Wirst du dich gegen meinen Hunger auf dich wehren?« Sein Mund wanderte über ihr Kinn, zum Hals hinab. Inmitten der leidenschaftlichen Umarmung trottete Aimerys neugieriger Pyrenäenhund heran, um zu erkunden, was da geschah, schnüffelte laut und ließ seine triefende rosa Zunge über dem Paar herabhängen. Raoul versuchte, ihn beiseite zu schieben, doch da wurde seine Hand begeistert abgeleckt, eine hundert Pfund schwere Masse aus Hundemuskeln und dichtem weißen Fell sank auf ihn herab. Entzückt wälzte sich das Tier auf ihm, vom spielerischen Wunsch getrieben, Aufmerksamkeit und Wohlgefallen zu erwecken.
Aimery stieß einen schrillen Pfiff aus, und der Hund sprang zu ihm. Doch der Schaden, den er angerichtet hatte, ließ sich nicht mehr beheben.
Erbost setzte sich Raoul auf und blinzelte Aimery durch das grelle Sonnenlicht an, während Claire, die Wangen hochrot, ihre zerknitterte Kleidung glatt strich.
»Hat euch der Bursche etwa gestört? Tut mir leid.« Aimerys Augen funkelten belustigt, und es fiel ihm sichtlich schwer, seinen Lachreiz zu bekämpfen, während er den Pelz seines Hundes zauste.
»Es tut dir überhaupt nicht leid, und es würde mich nicht wundern, wenn du ihn absichtlich hergeschickt hättest«, warf Raoul ihm vor, erkannte aber widerstrebend die Komik der Situation und grinste.
»Ich kann Blanc nicht daran hindern, im Gebüsch nach Wild zu schnüffeln. Das ist seine Aufgabe.« Aimery zog einen Falknerhandschuh aus seinem Gürtel und streifte ihn über seine Faust. »Verliebte Freuden kannst du die ganze Nacht genießen. Lass deine Frau ein Weilchen in Ruhe, komm mit und schau dir die Fortschritte meines neuen Falken an. Dein Vater wartet schon.«
Die Idylle war beendet. Raoul stand seufzend auf und zog seine Frau auf die Beine. Verlegen wich sie dem Blick des lächelnden Aimery aus, schüttelte ihren Rock und rückte ihr verrutschtes Brusttuch zurecht.
Geralda sah die Männer davonreiten, die Falken auf den Fäusten, und schnalzte mit der Zunge. Dann lachte sie. »Mein Bruder konnte es gar nicht erwarten, Berenger und Raoul seinen neuen Falken vorzuführen. Wenn man seinen Lobeshymnen glauben darf, hat es noch nie einen solchen Vogel gegeben. Er redet kaum noch von anderen Dingen und treibt mich fast zum Wahnsinn.«
»Dann wirst du ja bald endgültig verrückt sein«, meinte Beatrice boshaft. Als Claire diese Bemerkung hörte, starrte sie ihre Schwiegermutter erstaunt an.
Nun lachte Geralda noch lauter. »Beatrice de Montvallant, so war Gott mein Zeuge ist, du solltest dich schämen. Eine alte Frau so zu hänseln!«
»Ich dachte, die Katharer lügen nicht«, erwiderte Beatrice, und ihre Augen glitzerten mutwillig. »Du bist nur zehn Jahre älter als ich, und ich habe noch lange nicht die Absicht, wie eine Greisin zu leben.«
»Nun, du hast Berenger, der dich in Trab hält, und eine junge Schwiegertochter, die du in ihre Pflichten einweisen musst.« Geralda schenkte Claire ein freundliches Lächeln. »Während ich nur Aimery und seine Falken habe, die überall ihre Federn verlieren.«
»Du hast deinen Glauben.«
Das ließ Geralda gelten, ihr Lächeln erlosch nicht und vertiefte die Fältchen an ihren Augenwinkeln. Sie schaute sich nach der Dienerschaft um. Nur die Zofe Isabelle befand sich in Hörweite. »Jetzt, wo die Männer verschwunden sind, möchte ich euch was zeigen.« Sie holte ein kleines Buch hervor, in dessen Ledereinband goldene, ineinandergreifende Kreise gepunzt waren. »Nicht, dass ich etwas zu verbergen hätte! Aimery hörte mich schon mehrmals aus diesen Schriften vorlesen, aber sie interessieren ihn genauso brennend wie mich seine Falken ...« Vielsagend verdrehte sie die Augen.
»Und was für ein Buch ist das?«
»Es enthält uralte Weisheiten. Ein Mann, der in unserer Stadt wohnte, brachte von einer Pilgerfahrt ins Heilige Land ein paar Handschriften mit, die er mir kurz vor seinem Tod vermachte. Nach und nach ließ ich sie von einem karthagischen Schriftgelehrten, der bei uns lebt, in unsere Sprache übersetzen. Hört euch das an ...« Aufs Geratewohl öffnete Geralda das Buch und begann, mit klarer Stimme vorzulesen: »›Wer sich selbst bis ins Innerste erkennt, der erkennt auch Gott. Suche nach Ihm, indem du zum Anfang deines Weges zurückkehrst. Lerne, wer in dir ist, sich alles zu eigen macht und sagt: Mein Gott, mein Geist, meine Gedanken, meine Seele, mein Körper. Spüre die Quellen von Kummer und Freude, Liebe und Hass auf. Wenn du dies alles gründlich erforschst, wirst du Ihn in dir finden ...‹ Ist das nicht wundervoll? Aber die Kirche will es uns trotzdem verwehren.« Ihr Gesicht nahm einen verbitterten Ausdruck an. »Wenn die katholischen Geistlichen die Möglichkeit hätten, würden sie jedes Buch verbrennen, das nicht in Latein verfasst ist – jedes, das ihrer engstirnigen Vorstellungen von Gott widerspricht.« Verächtlich schnippte sie mit den Fingern. »Du brauchst deinen nichtsnutzigen Priester nicht, um den Allmächtigen zu erreichen, Beatrice. Tritt vor Ihn hin, so wie du bist, und Er wird dich erhören!«
»Nie habe ich versucht, Gott mit Vater Othos Hilfe zu finden.« Beatrice erschauerte. »Genauso gut könnte ich guten Wein aus einem schmutzigen Becher trinken ...«
»Genau!«, rief Geralda und schlug mit der flachen Hand ins Gras, um ihren Worten Nachdruck zu verleihen. Ihre Augen glühten wie im Fieber. »Die Priester dienen dem Gott ihrer eigenen weltlichen Wünsche – nicht dem Gott der Wahrheit. Sie lehren uns, an die Blutschuld zu glauben, die Hölle. Kann ein solcher Ort mit der Vorstellung vom Gott des Lichts übereinstimmen?« Heftig schüttelte sie den Kopf. »O, ich sage euch, sie herrschen, indem sie uns Angst einjagen und unterdrücken. ›Tut, was wir befehlen, sonst ...‹«
»Du hältst bereits Bekehrten eine Predigt.« Beruhigend legte Beatrice eine Hand auf den Arm ihrer Freundin. »Schon lange glaube ich an die Lehre der Katharer, obwohl ich noch kein endgültiges Bekenntnis abgelegt habe, und auch meine Schwiegertochter stammt aus einer Familie, die den neuen Glauben gutheißt.«
Claire stimmte schüchtern zu. Sie fand Geraldas starke Persönlichkeit fast überwältigend, spürte aber, wie die eindringlichen Worte der älteren Frau und deren gerechter Zorn in ihrer eigenen Seele auf fruchtbaren Boden fielen.
Der Weg zur Wahrheit, wie die Katharer ihn suchten, führte über ein reines, einfaches Leben – Gebete, Zölibate, schlichtes, fleischloses Essen. Nur die vollends Überzeugten leisteten die letzten strengen Gelübde, doch es gab andere Stufen für jene, die zwar an die Katharer-Religion glaubten, aber noch keine Bereitschaft zeigten, sich der geforderten rigorosen Disziplin zu unterwerfen.
Einige bekannten sich erst auf dem Totenbett dazu, und andere, nachdem sie Kinder großgezogen hatten und den Leidenschaften der Jugend entwachsen waren. Oft hatte Claire mit dem Gedanken gespielt, sich den Katharer-Perfecti anzuschließen, und diesen Traum auf ein Podest gestellt, so wie andere Mädchen das nebelhafte Bild eines Ritters in schimmernder Rüstung oder eines Troubadours, der eine erst noch unbestimmte Sehnsucht weckt.
Nur ein Traum – aber der Wirklichkeit so nahe, dass sie hier, an Geraldas und Beatrices Seite, seinen Atem spürte ... »Würdest du uns noch mehr vorlesen, ehe die Männer zurückkommen?«, bat sie leise.
Die Herrin von Lavaur musterte sie nachdenklich. »Nichts täte ich lieber, mein Kind.« Nun klang ihre Stimme sehr sanft, und ihr Blick verriet, dass sie eine verwandte Seele entdeckt hatte.
Vater Otho wartete vor der Schmiede im Schatten einer Platane, während sein Rotschimmel beschlagen wurde, und sah, wie die Montvallants mit ihren Freunden von der Mahlzeit am Fluss zum Schloss zurückkehrten. Obwohl er mit Berenger verwandt war, hatten sie es nicht für nötig befunden, ihn zu diesem Ausflug einzuladen. Lieber beschworen sie in Gesellschaft elender Gotteslästerer wie Aimery de Montréal und seiner scharfzüngigen Schwester Geralda die ewigen Höllenfeuer herauf. Ihren eigenen Priester beachteten sie gar nicht, während sie vorbeiritten.
Seine feuchten dunklen Augen wanderten zu Claires Zofe, die hinter einem Soldaten im Soziussattel saß. Wie eine Weintraube zur Lesezeit – reif und saftig ... Beinahe glaubte er, die süßen Reize zu schmecken, und stellte sich vor, seine Zähne würden hineinbeißen.
Heiße Gelüste prickelten auf seiner Haut wie die Schweißtropfen unter der Kutte. Er hakte die Daumen in seinen vergoldeten Gürtel, fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und beobachtete jede einzelne Bewegung des Mädchens. Ihn traf keine Schuld, wenn solche Gefühle in ihm aufstiegen. Diese Isabelle war ein Werkzeug des Teufels, so wie alle Frauen, mehr oder weniger. Eines stand jedenfalls fest – die Dame Geralda zählte zu den Hexen.
»Ketzer«, murmelte er voller Abscheu in seinen Bart und hasste das Gelächter der fröhlichen Reitergruppe, das Klirren der Falkenharnische, die Vergoldung des Zaumzeugs, den Sonnenschein, der sich in Juwelen spiegelte und von dem er ausgeschlossen war.
Neben ihm hämmerte der Schmied den letzten Nagel in einen der Hufe, wischte sich den Schweiß von der Stirn und trat zurück. Nach einem raschen Blick auf Othos cholerische Miene machte er sich geflissentlich an seinen Werkzeugen zu schaffen. Der Priester band den Rotschimmel vom Mauerring los und schob einen Fuß in den Steigbügel.
»Vater – die Bezahlung.«
»Die erledigen wir, wenn ich Euch das nächste Mal beim Gottesdienst sehe.« Hart drückte Otho seinem Pferd die Fersen in die Flanken, und es schnellte vorwärts. Schaum sprühte von der Gebissstange, die neu beschlagenen Hufe klapperten laut auf dem festgestampften Erdreich der Straße. Der Schmied sprang zurück, um sein Leben zu retten, landete im Staub und starrte dem Geistlichen nach, der davongaloppierte und Hühner, Gänse und Menschen unterschiedslos auseinanderscheuchte. Hinter ihm wehte sein Umhang wie ein dämonisches schwarzes Flügelpaar.
Als der Priester in seinem Haus neben der verschlossenen Kirche eintraf, sah er zwei Mönche am Tisch sitzen. Sie tranken seinen Wein und verzehrten das kalte Geflügel, das für sein eigenes Nachtmahl bestimmt gewesen war. Sein Diener Baudri, der die Besucher bediente, hielt inne, wischte sich nervös die Hände an seiner Tunika ab und eilte hinaus, um den Rotschimmel zu versorgen. Bis zu diesem Augenblick hatte Otho nicht geglaubt, seine Laune könnte sich noch verschlechtern. Aber nun erfasste ihn übermächtige Wut. Das fehlte ihm gerade noch – den Gastgeber zweier Wanderbrüder spielen zu müssen, die zweifellos seine Speisekammer leer essen, dann bis zum Morgengrauen dasitzen und über Theologie reden würden. »Ich nehme an, Ihr kommt wegen der Ketzer?«, fragte er unhöflich. Er fand es überflüssig, sich vorzustellen, und hoffte inständig, die beiden bald loszuwerden.
Eine lange Pause entstand, während die Mönche einen misstrauischen Blick wechselten. Der jüngere öffnete den Mund, um zu antworten, doch der ältere hob warnend eine Hand und heftete seine tief liegenden Augen auf Otho. »Welche Ketzer meint Ihr?« Er sprach mit spanischem Akzent und sonorer, gebieterischer Stimme.
»Die Gäste in der Burg, Geralda de Lavaur und ihren Bruder.« Ohne sich zu entschuldigen, griff Otho über den Tisch hinweg nach dem Weinkrug, trank daraus und stellte ihn mit lautem Knall wieder hin. Seine verächtliche Miene forderte die Brüder heraus, sein rüpelhaftes Benehmen zu kritisieren, aber sie schwiegen. Wären sie nicht da gewesen, hätte er den Krug an die Wand geschleudert, um seinem Zorn Luft zu machen. »Mehr als die Hälfte der Stadtbevölkerung wurde von den Katharern und ihrer verwerflichen Lehre vergiftet, und im Schluss ermutigt man sie auch noch! Diese Dame Geralda, eine berüchtigte Ketzerin, ist dort ein willkommener Gast.«
»Es wäre angebracht, wenn die katholische Kirche mit gutem Beispiel voranginge«, bemerkte der jüngere Mönch sittsam. Er besaß ein schmales, asketisches Gesicht. Straff spannte sich die elfenbeinweiße Haut über hohe Backenknochen und eine glänzende hohe Stirn. Die schwarzen Augen funkelten so kalt wie Obsidiansplitter.
Otho schluckte, rang nach Atem und erstickte beinahe an seiner Wut. »Bis jetzt konnte ich nicht feststellen, dass Ihr Brüder viel Gutes bewirkt hättet.«
Wieder hob der ältere Mann eine warnende Hand. An seinem Mittelfinger steckte ein Siegelring, mit dem päpstlichen Symbol graviert, und glitzerte im Licht, das durch die offene Tür hereinfiel. »Wir sind nicht hier, um zu streiten, und Ihr müsst Euer Verhalten mit Eurem eigenen Gewissen vereinbaren«, erwiderte er kühl. Was er vom Benehmen des Priesters hielt, drückte sein Tonfall deutlich aus. »Vielmehr sind wir in diese Stadt gekommen, um nach drei reisenden Ketzern zu suchen, zwei Männern und einer Frau.«
Otho musterte das grobschlächtige Gesicht des älteren Mönchs mit der ausgeprägten Knollennase, und seine Gedanken überschlugen sich. Sicher, die beiden Besucher trugen staubige Kutten, und Bartstoppeln bedeckten ihre Wangen, aber der Siegelring repräsentierte römische Autorität. Das waren keine einfachen Wanderbrüder. Seine feindseligen Gefühle wurden durch diese Erkenntnis keineswegs gemildert, sondern sogar noch verstärkt, von wachsender Angst genährt. Er leckte sich über die Lippen. »Zwei Männer und eine Frau ...«
»Einer ist als hoher Katharer-Perfectus bekannt, ein gewisser Chretien de Béziers, der andere heißt Matthias, ein Manichäer aus Marseille. An seiner rechten Hand fehlen zwei Finger. Die Frau ist noch jung, manche Leute würden sie schön nennen.« Bei diesen letzten Worten kräuselten sich die Lippen des Mönchs.
Sein jüngerer Begleiter beugte sich ernsthaft zu Otho vor. »Sie tragen ketzerische Dokumente bei sich, und angeblich halten sie blasphemische Predigten, die alles übertreffen, was gewöhnliche Katharer sagen.«
Plötzlich wurde seine Elfenbeinhaut von Zorn gerötet, so als wäre dunkler Wein in ein wächsernes Gefäß geflossen.
Eine Fliege summte um die Platte mit dem kalten Geflügel, ließ sich darauf nieder und begann, ihren Hunger zu stillen. Otho beobachtete sie mit einer Faszination, die seine Hand lähmte. »Ich sah zwei Männer und eine Frau, die durch diese Stadt zogen. Ob es die Leute sind, die Ihr sucht, weiß ich nicht, aber die Frau war tatsächlich sehr schön, und die Männer trugen Katharer-Kleidung.«
»Wann war das?« Der ältere Mönch neigte sich vor.
»Letzten Monat, oben in der Burg, beim Hochzeitsfest des jungen Montvallant.« Otho verzog die Lippen, von bösen Erinnerungen geplagt. »Sie übernachteten in einem Zelt, das sie im Hof aufgestellt hatten, in der Nähe des Tors.«
»Und?«
Otho schüttelte den Kopf. Vor päpstlichen Gesandten wollte er nicht zugeben, dass er die ganze Nacht betrunken neben dem Misthaufen gelegen und die Reisenden nur zur Kenntnis genommen hatte, weil er am nächsten Morgen von ihrem wiehernden Packesel aus seinem Elend geweckt worden war. »Sie blieben unter sich. Einer könnte den Wald von Buzet erwähnt haben, aber da bin ich mir nicht ganz sicher.«
Der ältere Mann räusperte sich, warf seinem Gefährten einen kurzen Blick zu und stand auf. »Dann ist unsere Spur noch nicht völlig erkaltet«, meinte er und befingerte den Rosenkranz, der seine Taille umgürtete. Klickend schlugen die Perlen aufeinander. »Sollte Euch noch etwas zu Ohren kommen, bringt sofort eine Nachricht nach Fanjeaux. Jeder kann Euch den Weg zu meinem Haus weisen. Fragt einfach nach Bruder Guzman.«
Otho riss die Augen auf und wollte niederknien.
»Dafür ist es jetzt zu spät, nicht wahr?«, bemerkte einer der mächtigsten Evangelisten, die jemals im Dienst der katholischen Kirche gestanden hatten. »Wir werden Euch im Auge behalten.« Kalte Verachtung schwang in der tiefen Stimme mit. »Komm, Bruder Bernard.«
Der Magen des Priesters drehte sich um, und sein Herz klopfte unregelmäßig, während die beiden an ihm vorbeigingen. Er hörte, wie ihre Sandalen leise über den Boden glitten, wie die Tür geschlossen wurde. Erst als völlige Stille herrschte, wagte er, sich zu bewegen. Mit zitternden Fingern packte er den Weinkrug, schmetterte ihn an die Wand und sah ihn zerbrechen. Wie Blut rann der Wein am rauen Mörtel herab, und die Fleischfliege surrte zur Mauer, um ihren Durst zu löschen.
4
September 1207
Der Höhepunkt des Sommers brachte reiche Ernte. Unter einem klaren Himmel – so strahlend blau, dass sein Anblick in den Augen schmerzte – wurden reife dunkle Trauben und saftige Oliven zertreten und ausgepresst. Schwitzende, halb nackte Bauern mühten sich vom Morgengrauen bis zur Abenddämmerung, mähten auf glühenden Feldern das Getreide, pflückten Früchte und Nüsse, trieben ihr Vieh auf üppige Weiden, um es ein letztes Mal zu mästen, und sammelten Reisigbündel für den Winter.
Die Geschwister Montréal kehrten nach Lavaur zurück. Zahlreiche reisende Katharer kamen nach Montvallant, und viele wurden von Geralda geschickt, weil sie wusste, dass man sie freundlich begrüßen würde. Zur Erntezeit brauchte man zusätzliche Hände, die mit anpackten, und die Besucher arbeiteten fleißig als Gegenleistung für Verpflegung, Unterkunft und ein Publikum, das ihnen bereitwillig zuhörte. Die Perfecti verbrachten mehrere Nächte in der Burg und hielten im Hof Gebetsstunden ab. Manchmal gingen Claire und Beatrice mit ihren Zofen zu Versammlungen in der Stadt und in der näheren Umgebung. Die Männer weigerten sich, sie zu begleiten. Wenn sie den neuen Glauben auch duldeten, so konnten sie sich doch nicht so dafür begeistern wie die Frauen.
Raoul beschwerte sich sogar halb scherzhaft bei Claire und behauptete, sie vernachlässigte ihn zugunsten der neuesten Katharer-Gäste, zweier verhutzelter Greise, die nach Ziegen stanken. Zerknirscht verwarf sie ihren Plan, an der nächsten Versammlung teilzunehmen, und begleitete ihn, um die Ernte zu beaufsichtigen. Doch sie gab Isabelle frei und erlaubte ihr, die Predigt zu hören.
»Du wolltest doch mit ihr gehen, nicht wahr?«, fragte Raoul, als sie Rast machten und die Pferde an einem Bach trinken ließen, der sich durch die Obstgärten in der Ebene unterhalb der Burg wand.
Durch gesenkte Wimpern schaute sie ihn an. Obwohl seine Miene belustigt wirkte, sah sie schon jetzt die schwachen Linien, die sich eines Tages für immer zwischen Nasenflügel und Lippen eingraben würden. »Viel lieber bin ich mit meinem Mann zusammen«, erwiderte sie diplomatisch.
»Das bezweifle ich manchmal.« Sein Hengst hob das triefnasse Maul und warf den Kopf zurück.
Angst erfasste sie, als sie plötzlich eine Saat in ihrem Inneren spürte, die zu bedingungsloser Hingabe heranreifen konnte, wenn sie ihr erlaubte, über das erste, langsame Aufkeimen hinauszuwachsen. »So etwas darfst du nicht denken!«, rief sie, beugte sich aus ihrem Sattel herüber und griff seine Hand.
Er betrachtete ihre Finger, und die feinen Linien um seinen Mund vertieften sich, aber nicht, um ein Lächeln anzukündigen. »Vielleicht möchte ich dich nicht mit den Katharern teilen. Wenn du eine der ihren wirst, kann ich dich nicht mehr anrühren.«