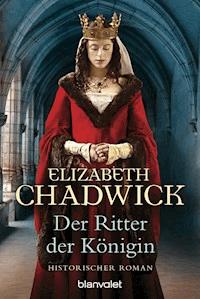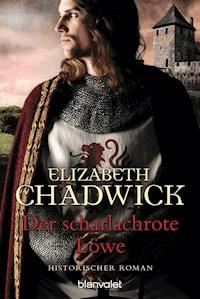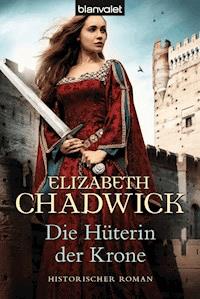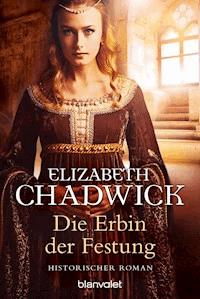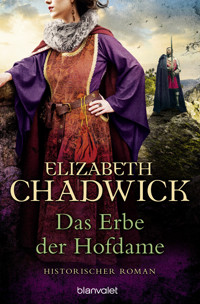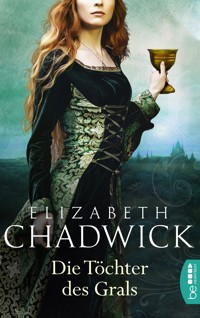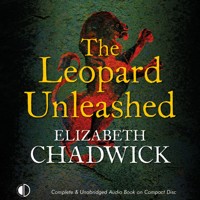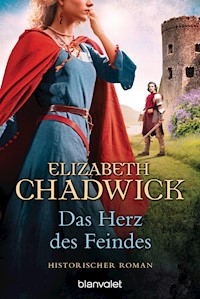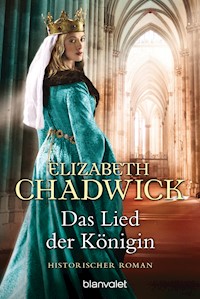
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Alienor-Trilogie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Der Auftakt einer farbenprächtigen historischen Trilogie der Bestseller-Autorin Elizabeth Chadwick. Lassen Sie sich in das Europa des 12. Jahrhunderts entführen.
Zerrissen zwischen Pflicht und Liebe nimmt Alienor von Aquitanien ihr Leben selbst in die Hand und erlangt Ruhm und Macht.
Frankreich um 1100: Alienor ist jung, wunderschön, und sie ist die Erbin des reichen Herzogtums Aquitanien. Als ihr geliebter Vater stirbt, ist ihre Kindheit plötzlich vorbei. Sie wird mit Louis verheiratet, dem noch sehr jungen Prinzen von Frankreich. Doch dann verändert ein weiterer Tod ihrer beider Leben für immer. Sie werden zu König und Königin gekrönt, viel früher, als sie jemals damit gerechnet hätten. Alienor muss sich daran gewöhnen, nun die Herrscherin des großen, lebhaften französischen Hofes zu sein, dabei ist sie erst 13 Jahre alt …
Alle Bände der Alienor-Trilogie
Band 1 - Das Lied der Königin
Band 2 - Das Herz der Königin
Band 3 - Das Vermächtnis der Königin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 752
Ähnliche
Buch
Frankreich im 12. Jahrhundert. Alienor ist jung, wunderschön, und sie ist die Erbin des reichen Herzogtums Aquitanien, denn sie ist die älteste Tochter des Herzogs. Von den Eltern, Aenor und Guillaume, und ihrem Onkel, Raymond, wird sie geliebt und unterstützt, doch wird dem jungen Wildfang auch viel durchgelassen. So verlebt sie die ersten Jahre ihrer Kindheit in Frieden, Glück und Freiheit. Doch als ihr geliebter Vater unerwartet stirbt und ihre Mutter sich immer mehr zurückzieht, ist ihre Kindheit vorbei. Sie wird mit Louis, dem noch sehr jungen Prinzen von Frankreich, verheiratet. Louis musste nach dem Tod seines älteren Bruders den sicheren Hort seines Klosters, wo er bis dahin erzogen wurde, verlassen, und ist von seiner neuen Rolle als Kronprinz und Thronfolger mehr als überfordert. Der jungen Schönheit, mit der er so plötzlich verheiratet wurde, begegnet er mit Achtung und Verehrung und verliebt sich Hals über Kopf. Doch dann verändert ein weiterer Tod ihrer beider Leben für immer. Sie werden zu König und Königin gekrönt, viel früher, als sie jemals damit gerechnet hatten. Alienor muss sich daran gewöhnen, nun die Herrscherin des großen, lebhaften französischen Hofes zu sein – doch sie ist erst 13 Jahre alt …
Autorin
Elizabeth Chadwick lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in Nottingham. Sie hat zahlreiche historische Romane geschrieben, die allesamt im Mittelalter spielen. Vieles von ihrem Wissen über diese Epoche resultiert aus ihren Recherchen als Mitglied von Regia Anglorum, einem Verein, der das Leben und Wirken der Menschen im frühen Mittelalter nachspielt und so Geschichte lebendig werden lässt.
Von Elizabeth Chadwick bei Blanvalet lieferbar:
Die normannische Braut· Der Ritter der Königin · Der scharlachrote Löwe · Der Falke von Montabard · Das Banner der Königin · Die englische Rebellin · Die Hüterin der Krone
ELIZABETH CHADWICK
Das Lied der Königin
Roman
Aus dem Englischen von Nina Bader
Die Originalausgabe erschien 2013unter dem Titel »The Summer Queen« bei Sphere, an imprint of Little, Brown Book Group, an Hachette UK Company, London
1. AuflageDeutsche Erstausgabe September 2014 bei Blanvalet Verlag,einem Unternehmen derVerlagsgruppe Random House GmbH, MünchenCopyright © 2013 by Elizabeth ChadwickCopyright © 2014 für die deutsche Ausgabeby Blanvalet Verlag, in der Verlagsgruppe Random House, MünchenUmschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com und Richard Jenkins PhotographyRedaktion: Friederike ArnoldLH ∙ Herstellung: samSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN: 978-3-641-13245-3www.blanvalet.de
1
Palast von Poitiers, Januar 1137
Alienor erwachte bei Tagesanbruch. Von der langen Kerze, die die ganze Nacht gebrannt hatte, war nur noch ein Stummel übrig, und selbst durch die geschlossenen Fensterläden hörte sie die krähenden Hähne auf den Hühnerstangen, Mauern und Misthaufen, die die Stadt Poitiers weckten. Petronilla schlief noch, tief unter der Bettdecke vergraben, ihr dunkles Haar lag ausgebreitet auf dem Kissen. Alienor kroch aus dem Bett, wobei sie darauf achtete, ihre kleine Schwester nicht zu wecken, die immer mürrisch reagierte, wenn sie zu früh gestört wurde. Außerdem wollte sie diese Minuten für sich allein haben, bevor das Haus zum Leben erwachte. Denn heute war kein gewöhnlicher Tag.
Sie streifte das Gewand über, das zusammengefaltet auf ihrer Truhe gelegen hatte, schob die Füße in weiche Ziegenlederschuhe und öffnete ein Türchen in den Läden, um sich hinauszulehnen und den Duft des neuen Morgens einzuatmen. Eine milde, feuchte Brise trug die vertrauten Gerüche nach Rauch, modrigem Gemäuer und frisch gebackenem Brot zu ihr herauf. Geschickt flocht sie ihr Haar, während sie die ruß-, austernfarbenen und goldenen Streifen am Horizont im Osten bewunderte. Dann seufzte sie nachdenklich und zog den Kopf zurück.
Vorsichtig nahm sie ihren Umhang vom Haken und schlich auf Zehenspitzen aus der Kammer. Im Nebenraum rieben sich die Dienstmägde die vom Schlaf verquollenen Augen und schickten sich an aufzustehen. Alienor huschte wie eine schlanke junge Füchsin an ihnen vorbei und lief leichtfüßig und geräuschlos die Stufen des mächtigen Maubergeonne-Turms hinunter, der die Wohngemächer des Herzogspalasts beherbergte.
Ein verschlafener junger Bursche verteilte Körbe mit Brot und Weinkrüge auf einem Tisch in der großen Halle. Alienor stibitzte einen noch ofenwarmen kleinen Laib und ging nach draußen. In einigen Hütten und Nebengebäuden brannten immer noch Laternen. Sie hörte, wie in den Küchen Töpfe klirrten, und ein Koch schalt einen Untergebenen aus, weil er die Milch verschüttet hatte. Vertraute Geräusche, die besagten, dass die Welt in Ordnung war, auch wenn Veränderungen anstanden.
Die Stallburschen machten die Pferde für die Reise fertig. Ginnet, ihre gescheckte Stute, und Morello, das schwarz schimmernde Pony ihrer Schwester, waren noch in ihren Boxen, aber die Packpferde hatten sie bereits aufgezäumt, und die Karren standen im Hof bereit, um das Gepäck hundertfünfzig Meilen Richtung Süden nach Bordeaux zu schaffen. Sie und Petronilla würden den Frühling und Sommer im Palast von Ombrière mit Blick auf die Garonne verbringen.
Alienor hielt Ginnet ein Stück frisches Brot hin und strich ihr über den warmen grauen Hals.
»Papa muss sich doch gar nicht auf den langen Weg nach Compostela machen«, sagte sie zu dem Pferd. »Warum kann er nicht zu Hause bei uns bleiben und hier beten? Ich hasse es, wenn er fortgeht.«
»Alienor.«
Sie zuckte zusammen und drehte sich mit schamrotem Gesicht zu ihrem Vater um. Sein Gesichtsausdruck verriet ihr, dass er ihre Worte gehört hatte.
Er war groß und schlank und hatte braunes Haar, das an den Ohren und Schläfen bereits ergraute. Tiefe Falten zogen sich um seine Augenwinkel, und seine ausgeprägten Wangenknochen unterstrichen seine hohlen Wangen. »Eine Pilgerfahrt ist eine ernste Verpflichtung gegenüber Gott«, sagte er. »Und keine Vergnügungsreise, die man aus einer Laune heraus unternimmt.«
»Ja, Papa.« Obwohl sie wusste, wie unentbehrlich für ihn, ja, für sein Seelenheil diese Pilgerreise war, wollte sie nicht, dass er ging. Er hatte sich in der letzten Zeit verändert, war so reserviert geworden. Offensichtlich plagten ihn Sorgen, und sie verstand nicht, warum.
Er hob ihr Kinn an. »Du bist meine Erbin, Alienor, und musst dich so betragen, wie es sich für die Tochter des Herzogs von Aquitanien schickt, und nicht wie ein schmollendes Kind.«
Entrüstet wich sie einen Schritt zurück. Sie war dreizehn, seit einem Jahr ehemündig, und betrachtete sich als erwachsen, auch wenn sie sich nach wie vor nach der Liebe und der Gegenwart ihres Vaters sehnte, die ihr Geborgenheit gab.
»Ich sehe, du verstehst mich.« Er runzelte die Stirn. »Während meiner Abwesenheit bist du die Herrscherin über Aquitanien. Unsere Vasallen haben geschworen, dich als meine Nachfolgerin anzuerkennen, und du darfst ihr Vertrauen nicht enttäuschen.«
Alienor biss sich auf die Lippe. »Ich habe Angst, dass du nicht zurückkommst …« Ihre Stimme zitterte. »Dass ich dich nicht wiedersehe.«
»Aber Kind! Natürlich komme ich zurück, wenn es Gottes Wille ist.« Liebevoll küsste er sie auf die Stirn. »Aber ich bin ja noch eine Weile hier. Wo ist Petronilla?«
»Noch im Bett, Papa. Ich habe sie schlafen lassen.«
Ein Stallbursche erschien, um sich um Ginnet und Morello zu kümmern. Alienors Vater ging mit ihr in den Hof, wo das fahle graue Morgenlicht wärmeren Farben wich. Er zupfte sacht an ihrem dicken honigblonden Schopf. »Dann geh jetzt und weck sie. Ihr würdet doch bestimmt gerne erzählen, dass ihr den Pilgerweg des heiligen Jakob ein Stück mitgelaufen seid.«
»Ja, Papa.« Sie sah ihm fest in die Augen, bevor sie mit hoch erhobenem Kopf und gemessenen Schritten davonging.
William seufzte. Seine älteste Tochter reifte rasch zu einer Frau heran. Sie war letztes Jahr gewachsen, und ihre Brüste und die Taille hatten erste weibliche Formen entwickelt. Sie war bezaubernd, und ihr bloßer Anblick verstärkte seinen Schmerz noch. Und sie war zu jung für das, was auf sie zukam. Möge Gott ihnen allen beistehen.
Petronilla war wach, als Alienor in die Kammer zurückkam, und packte eifrig ihre Lieblingsschmuckstücke in einen Stoffbeutel. Floreta, ihre Kinderfrau und Anstandsdame, hatte Petronillas glänzendes braunes Haar mit blauen Bändern durchflochten und es ihr aus dem Gesicht zurückgestrichen, sodass man von der Seite die feinen Härchen auf ihrer Wange erkennen konnte.
»Wo warst du?«, wollte Petronilla wissen.
»Nirgends, nur spazieren. Du hast noch geschlafen.«
Petronilla zog die Schnüre des Beutels zu und wedelte mit den Quasten. »Papa sagt, er bringt uns ein gesegnetes Kreuz vom Schrein des heiligen Jakob mit.«
Wie sollte ein gesegnetes Kreuz sie dafür entschädigen, dass ihr Vater fortging, dachte Alienor, sagte es jedoch nicht laut. Petronilla war elf, aber immer noch sehr kindlich. Obwohl sie sich nahestanden, bildeten die zwei Jahre, die sie trennten, oft eine Kluft zwischen ihnen. Alienor übernahm Petronilla gegenüber ebenso oft die Rolle ihrer verstorbenen Mutter wie die der Schwester.
»Und wenn er Ostern zurückkommt, feiern wir ein großes Fest, nicht wahr?« Flehend sah Petronilla sie mit ihren großen braunen Augen an. »Nicht wahr?«
»Natürlich«, versprach Alienor und schloss Petronilla trostsuchend in die Arme.
Der Morgen war schon halb verstrichen, als die herzogliche Reisegesellschaft nach einer Messe in der Pilgerkirche Saint-Hilaire, deren Wände mit dem Adlerwappen der Herren von Aquitanien geschmückt waren, nach Bordeaux aufbrach.
Zwischen den Wolken schimmerte immer wieder der blassblaue Himmel hervor, und ab und an verfing sich ein Sonnenstrahl in den Geschirren der Pferde und den Gürtelbeschlägen. Die Truppe zog sich die Straße entlang wie ein schillerndes Band, durchwoben mit dem Silber der Rüstungen und den satten Farben kostbarer karminroter, violetter und goldener Gewänder, zu denen das schlichte Gelbbraun und Grau der Kleidung der Diener und Fuhrmänner in starkem Kontrast stand. Nicht nur Herzog William, sondern alle legten am ersten Tag die zwanzig Meilen bis Saint-Sauvant, wo sie übernachten würden, zu Fuß zurück.
Alienor hielt Petronilla an der Hand, während sie mit der anderen ihr Gewand raffte, damit es nicht über den Boden schleifte. Hin und wieder hüpfte Petronilla fröhlich auf und ab. Als ein Jongleur begann, zur Begleitung einer kleinen Harfe zu singen, erkannte Alienor die Worte ihres Großvaters William, des neunten Herzogs von Aquitanien, der sich eines zweifelhaften Rufes erfreut hatte. Viele seiner Lieder strotzten vor sexuellen Anzüglichkeiten und waren wegen ihrer Derbheit nicht für die Frauengemächer geeignet, aber dieses klang getragen und schwermütig, sodass Alienor ein Schauer über den Rücken lief.
Ich weiß nicht, wann ich schlafe oder wach bin,
wenn es mir nicht jemand sagt.
Mein Herz birst fast vor tiefem Kummer.
Aber ich gebe nichts darum,
beim heiligen Martial!
Ihr Vater leistete ihr und Petronilla eine Zeit lang Gesellschaft, aber weil er weiter ausschritt als sie, ließ er sie allmählich zusammen mit den Frauen des Haushalts hinter sich. Alienor sah ihm nach und heftete den Blick auf seine Hand, die den Pilgerstab umschloss. Der Saphirring, das Symbol seiner Herzogswürde, schien ihr zuzuzwinkern wie ein dunkelblaues Auge. Sie versuchte ihn durch bloße Willenskraft dazu zu bringen, sich noch einmal nach ihr umzudrehen, aber er konzentrierte sich auf die vor ihm liegende Straße. Es kam ihr so vor, als entferne er sich absichtlich von ihr. Bald schon würde er aus ihrem Blickfeld verschwunden sein und nur staubige Fußabdrücke hinterlassen, in die sie ihre eigenen Füße setzte.
Ihre Stimmung hellte sich nicht einmal auf, als der Seneschall ihres Vaters, Gottfried von Rancon, Lord von Gençay und Taillebourg, sich zu ihr und Petronilla gesellte. Er war Ende zwanzig, hatte dichtes braunes Haar, tief in den Höhlen liegende dunkelbraune Augen und ein gewinnendes Lächeln, das in ihrem Inneren immer eine wohlige Wärme auslöste. Sie kannte ihn seit ihrer Geburt, denn er war einer der obersten Vasallen und Militärkommandanten ihres Vaters. Seine Frau war vor zwei Jahren gestorben, doch bislang hatte er nicht wieder geheiratet. Da aus dieser Ehe zwei Töchter und ein Sohn hervorgegangen waren, musste er nicht zwingend für weitere Erben sorgen.
»Warum schaut Ihr so verdrossen drein?« Er blickte sie durchdringend an. »Bei dieser finsteren Miene werden sich noch die Wolken verdunkeln.«
Petronilla kicherte, und Gottfried zwinkerte ihr zu.
»Redet keinen Unsinn.« Alienor hob das Kinn und ging schneller.
Gottfried hielt mit ihr Schritt. »Sagt mir doch, was los ist.«
»Nichts«, gab sie zurück. »Alles in Ordnung. Was soll denn sein?«
Er betrachtete sie nachdenklich. »Schließlich geht Euer Vater nach Compostela und lässt Euch in Bordeaux zurück.«
Alienors Kehle schnürte sich zu. »Na und!?«, entgegnete sie.
Er schüttelte den Kopf. »Ihr hattet recht, ich rede Unsinn, aber werdet Ihr mir verzeihen und mir gestatten, Euch ein Stück zu begleiten?«
Alienor zuckte die Achseln, nickte dann aber widerstrebend. Gottfried ergriff ihre und Petronillas Hand.
Alienor bemerkte kaum, dass sich nach einer Weile ihre Stirn wieder glättete. Gottfried war kein Ersatz für ihren Vater, aber in seiner Gegenwart hob sich ihre Stimmung, und sie vermochte ihren Weg mit neu erwachtem Lebensmut fortzusetzen.
2
Bordeaux, Februar 1137
William, der zehnte Herzog von Aquitanien, saß in seiner Kammer hoch oben im Palast von Ombrière vor dem Feuer, betrachtete die zu siegelnden Dokumente und rieb sich die Seite.
»Sire, seid Ihr immer noch zu dieser Reise entschlossen?«
Er blickte zu dem Erzbischof von Bordeaux hinüber, der sich vor dem Feuer aufwärmte. Seine große, korpulente Gestalt wirkte durch die pelzgefütterten Gewänder noch ausladender. Obwohl ihre Meinungen oft auseinandergingen, waren er und Geoffroi du Louroux langjährige Freunde, und William hatte ihn zum Lehrer seiner beiden Töchter ernannt.
»Ja«, erwiderte er. »Ich möchte meinen Frieden mit Gott machen, solange ich noch die Zeit dazu habe, und Compostela liegt nicht zu weit entfernt.«
Geoffroi maß ihn mit einem besorgten Blick. »Es wird schlimmer, nicht wahr?«
William stieß einen erschöpften Seufzer aus. »Ich rede mir ein, dass am Schrein des heiligen Jakob viele Wunder geschehen und ich um eines beten werde, aber in Wahrheit mache ich diese Pilgerreise um meines Seelenheils willen, und nicht weil ich auf Heilung hoffe.« Er fuhr sich über die Augen. »Alienor ist böse auf mich, weil sie meint, ich könnte meine Seele genauso gut in Bordeaux retten, aber sie begreift nicht, dass ich dann nicht von meinen Sünden reingewaschen werde. Hier würde ich mit Nachsicht behandelt werden, weil ich der Herrscher bin. Auf der Straße, zu Fuß, mit Ranzen und Stab, bin ich nichts weiter als ein Pilger. Wenn wir vor Gottes Angesicht treten, sind wir alle nackt, unabhängig von dem Rang, den wir in dieser Welt bekleiden, und deswegen ist das der richtige Weg.«
»Aber was geschieht während Eurer Abwesenheit mit Euren Ländereien, Sire?«, fragte Geoffroi beunruhigt. »Wer wird an Eurer Stelle herrschen? Alienor ist nun im heiratsfähigen Alter, und obwohl Ihr die Männer zu dem Schwur verpflichtet habt, sie als Herrscherin zu unterstützen, wird jeder Baron im Land alles daransetzen, sie entweder selbst zur Frau zu nehmen oder sie mit seinem Sohn zu vermählen. Wie Ihr sicher bemerkt habt, umschwärmen sie sie bereits. Zum Beispiel von Rancon. Er hat seine Frau aufrichtig betrauert, wie ich zugeben muss, aber ich vermute, ihn haben politische Interessen bislang davon abgehalten, sich erneut zu verheiraten.«
»Ich bin nicht blind.« William zuckte zusammen, als ihn ein stechender Schmerz durchfuhr. Aus einem Krug goss er sich einen Becher Quellwasser ein. Er wagte in der letzten Zeit nicht mehr, Wein zu trinken. Obgleich ein starker Esser, konnte er nur noch trockenes Brot und leichte Kost zu sich nehmen. »Dies ist mein Letzter Wille.« Er schob du Louroux die Pergamentbögen hin. »Mir ist durchaus klar, welche Gefahr den Mädchen droht, wie leicht die Situation eskalieren und es zu einem Krieg kommen kann, und ich habe mein Bestes getan, dem entgegenzuwirken.«
Du Louroux überflog das Geschriebene und hob wie erwartet die Brauen.
»Ihr überantwortet Eure Töchter den Franzosen. Ist das nicht genauso gefährlich? Statt die wilden Hunde den Schafspferch umkreisen zu lassen, gewährt Ihr den Löwen Zutritt.«
»Alienor ist gleichfalls eine Löwin«, erwiderte William. »Es liegt ihr im Blut, sich Herausforderungen zu stellen. Dazu ist sie erzogen worden, und sie verfügt über die notwendigen Fähigkeiten, wie Ihr wisst.« Er winkte ab. »Der Plan hat seine Mängel, aber er ist sicherer als andere, die auf den ersten Blick vielversprechend erscheinen. Ihr habt durch die Kirche Kontakt mit den Franzosen – und Ihr seid ein weiser, redegewandter Mann. Ihr habt meine Töchter gut unterrichtet; sie vertrauen und mögen Euch. Falls ich sterbe, lege ich die Verantwortung für ihre Sicherheit und ihr Wohlergehen in Eure Hände. Ich bin sicher, Ihr werdet das tun, was das Beste für sie ist.«
William wartete, während Geoffroi das Testament ein zweites Mal stirnrunzelnd las. »Es gibt keine bessere Lösung. Ich habe mir den Kopf zermartert, bis er fast geplatzt ist. Ich vertraue meine Töchter und somit Aquitanien Louis von Frankreich an, weil mir nichts anderes übrigbleibt. Wenn ich Alienor mit von Rancon vermählen würde, was zweifellos eine ehrenhafte Verbindung wäre, würde ich einen blutigen Bürgerkrieg riskieren. Dass die Männer meinem Seneschall gehorchen, der auf meinen Befehl hin handelt, ist eine Sache, ihm als herzoglichem Gemahl absolute Macht über sie zu verleihen, aber eine ganz andere.«
»In der Tat, Sire«, räumte Geoffroi ein.
William verzog den Mund. »Geoffrey von Anjou muss ebenfalls in Betracht gezogen werden. Er würde liebend gerne sein Haus mit dem meinen vereinen und seinen kleinen Sohn mit Alienor verloben. Als er letztes Jahr, auf dem Feldzug in der Normandie, mit mir darüber gesprochen hat, habe ich ihn vertröstet und ihm gesagt, ich würde darüber nachdenken, wenn der Junge älter sei. Sollte ich sterben, könnte er die Gunst der Stunde nutzen, und das wäre gleichfalls eine Katastrophe. Wir müssen in diesem Leben um des Gemeinwohls willen Opfer bringen, Alienor versteht das.« Er versuchte es mit einem Scherz: »Manchmal müssen Trauben zertreten werden, und wir in Bordeaux haben schon immer guten Wein gemacht.« Aber keiner der beiden Männer lächelte. Die Schmerzen verursachten William Übelkeit. Der lange Marsch von Poitiers hatte an seinen Kräften gezehrt. Bei Gott, er war zutiefst erschöpft, und es gab noch so viel zu tun.
Geoffroi blickte William immer noch sorgenvoll an. »Es mag Eure Untertanen davon abhalten, sich gegenseitig zu bekriegen, aber ich fürchte, sie werden sich stattdessen gegen die Franzosen wenden.«
»Nicht wenn ihre Herzogin zugleich Königin ist. In bestimmten Gebieten wird es wie üblich Unruhen geben, es kommt immer zu kleineren Auseinandersetzungen, aber ich glaube nicht, dass wir eine offene Rebellion zu erwarten haben. Ich vertraue auf Euer diplomatisches Geschick, das Schiff auf Kurs zu halten.«
Geoffroi zupfte an seinem Bart. »Soll noch jemand dieses Dokument zu Gesicht bekommen?«
»Nein. Ich werde einen vertrauenswürdigen Boten mit einer Kopie zu König Louis schicken, aber vorerst braucht niemand etwas davon zu wissen. Wenn es zum Äußersten kommt, müsst Ihr die Franzosen unverzüglich informieren und die Mädchen beschützen. Von jetzt an vertraue ich darauf, dass Ihr diese Papiere sicher aufbewahrt.«
»Wie Ihr wünscht, Sire.« Er warf William einen beunruhigten Blick zu. »Soll ich Eurem Arzt Bescheid sagen, dass er Euch einen Schlaftrunk bringt?«
»Nein.« Williams Miene versteinerte sich. »Ich werde nur allzu bald genug Zeit zum Schlafen haben.«
Schweren Herzens verließ Geoffroi die Kammer. William war dem Tode nah, viel Zeit blieb ihm womöglich nicht mehr. Er mochte die Wahrheit erfolgreich vor anderen verbergen, aber Geoffroi kannte ihn zu gut, um sich täuschen zu lassen. Es gab noch so viel zu erledigen, und es bekümmerte ihn, dass diese Angelegenheiten nun einer halbfertigen Stickerei gleichen würden. Das, was neu eingearbeitet werden würde, passte nicht zum Rest und führte vielleicht sogar dazu, dass die erste Hälfte wieder aufgetrennt werden musste.
Geoffrois Gedanken wandten sich voller Mitgefühl Alienor und Petronilla zu. Vor sieben Jahren waren ihre Mutter und ihr kleiner Bruder an einem Sumpffieber gestorben. Jetzt würden sie auch noch ihren geliebten Vater verlieren. Sie waren so verletzlich. William hatte in seinem Letzten Willen für ihre – vielleicht sogar glorreiche – Zukunft gesorgt, aber Geoffroi wünschte, die Mädchen wären älter und verfügten über mehr Lebenserfahrung. Er wollte nicht, dass ihr lebhaftes, heiteres Wesen verdorben und vom Schmutz dieser Welt besudelt wurde, wusste aber, dass er dies nicht verhindern konnte.
Alienor streifte ihren Umhang ab und legte ihn über den Stuhl ihres Vaters. Sein Geruch hing immer noch in der Kammer. Er hatte alle seine Besitztümer zurückgelassen und war in einem Büßergewand und in Sandalen von der Kathedrale aufgebrochen. In seinem Ranzen hatte er ein Stück Schwarzbrot. Nachdem Alienor und Petronilla ihn und seine Prozession ein paar Meilen begleitet hatten, kehrten sie mit dem Erzbischof nach Bordeaux zurück. Petronilla hatte unaufhörlich geschwatzt und die Leere mit ihrer munteren Stimme und ihren eifrigen Gesten ausgefüllt, Alienor jedoch hatte sich in Schweigen gehüllt und sich zurückgezogen, sowie sie zu Hause angelangt waren.
Sie ging in der Kammer auf und ab, berührte dieses und jenes. Das in die Rückenlehne seines Stuhls geschnitzte Adlermotiv, das Elfenbeinkästchen mit den Pergamentstreifen, das kleine Gefäß aus Horn und Silber, in dem er seine Federkiele und Schreibgeräte aufbewahrte. Neben seinem weichen blauen Umhang mit dem Futter aus Eichhörnchenfell blieb sie stehen. Sie entdeckte ein Haar auf der Schulter, presste das Kleidungsstück an ihr Gesicht und kostete das Gefühl aus. Beim Abschied, als sie seine kratzige Wange gespürt hatte, war sie zu wütend gewesen, um seine Umarmung genießen zu können. Sie war auf Ginnet davongeritten, ohne sich noch einmal umzublicken. Petronilla dagegen hatte ihn fest umarmt und sich unter lebhaften Abschiedsbezeugungen von ihm getrennt.
Alienors Augen begannen zu brennen, und ihre Tränen tropften auf den Umhang. Schon zu Ostern würde er ja wieder zu Hause sein. Er war schon oft fort gewesen – erst letztes Jahr auf einem Feldzug in der Normandie mit Geoffrey, Graf von Anjou, und dort hatte er in viel größerer Gefahr geschwebt, als wenn er sich auf eine Pilgerreise begab.
Sie setzte sich auf den Stuhl und nahm die Position der Herrin von Aquitanien ein, die Recht spricht und weise Urteile verkündet. Von frühester Kindheit an war sie dazu erzogen worden zu denken und zu herrschen. Der Spinn- und Webunterricht, die Aneignung der weiblichen Betätigungen, hatten nur als Hintergrund für das Erlernen der ernsten Dinge und der Entwicklung eigener Ideen gedient. Auch wenn ihr Vater es liebte, sie in schönen Kleidern und mit Juwelen geschmückt zu sehen, hatte er sie immer wie einen Ersatzsohn behandelt. Sie war mit ihm durch das weitläufige Gebiet von Aquitanien gereist, von den Ausläufern der Pyrenäen bis zu den flachen Küstenlandschaften im Westen mit den gewinnbringenden Salzpfannen zwischen Bordeaux und dem geschäftigen Hafen von Niort; von den Weinbergen von Cognac und den Wäldern von Poitou bis zu den Hügeln, den üppigen Flusstälern Limousins, wo man ausgedehnte Ausritte unternehmen konnte. Sie war an seiner Seite gewesen, als er die Lehnseide seiner Vasallen entgegengenommen hatte, unter ihnen viele streitsüchtige, nur auf ihren Vorteil bedachte Männer, die aber die Oberherrschaft ihres Vaters anerkannten. Sie hatte ihre Lektionen gelernt und sich eingeprägt, wie er mit ihnen umging. Die Sprache der Macht drückte sich nicht nur in Worten aus. Es ging um Präsenz und sorgfältiges Abwägen, um wohlbedachte Gesten und die Wahl des richtigen Zeitpunkts. Er hatte ihr ihren Weg gewiesen und sie gelehrt, sich ihrer eigenen Stärke bewusst zu sein, aber heute kam sie sich so vor, als hätte sie ein Schattenreich betreten.
Die Tür ging auf, und der Erzbischof trat ein. Er hatte seine kostbare Mitra mit einer schlichten Filzkappe und sein prächtiges Gewand mit einer braunen Kutte vertauscht. Er hatte einen Kasten aus Elfenbein bei sich.
»Ich dachte mir schon, dass ich dich hier finde, Tochter«, sagte er.
Alienor war verstimmt, ließ sich aber nichts anmerken. Sie konnte den Erzbischof von Bordeaux schwerlich bitten, wieder zu gehen. Außerdem fühlte sie sich verloren und wollte sich an ihn klammern, wie sie es so gerne bei ihrem Vater getan hätte.
Er stellte den Kasten auf einen Tisch neben ihrem Stuhl und hob den Deckel. »Dein Vater hat mich gebeten, dir das zu geben. Vielleicht erinnerst du dich daran.« Er wickelte eine birnenförmige Vase aus Bergkristall mit einem kunstvollen Wabenmuster aus einem weißen Tuch. »Er sagte, sie sei wie du – kostbar und einzigartig. Wenn Licht hineinfällt, erstrahlt alles ringsum.«
Alienor schluckte. »Ich erinnere mich daran. Aber ich habe sie nicht mehr gesehen, seit ich ein kleines Kind war.«
Beide erwähnten nicht, dass ihr Vater diese wunderschöne Vase ihrer Mutter zur Hochzeit geschenkt hatte und dass sie nach ihrem Tod in die Schatzkammer der Kathedrale von Bordeaux gebracht und selten wieder herausgeholt worden war.
Sie umschloss die Vase mit beiden Händen und stellte sie behutsam auf den Tisch. Das Licht vom Fenster fiel durch das Kristall und warf regenbogenfarbene Rauten auf das weiße Tuch. Angesichts des unerwarteten Anblicks rang Alienor nach Luft. Tränen stiegen ihr in die Augen, und sie unterdrückte ein Schluchzen.
»Schtt, Tochter, beruhige dich.« Geoffroi kam um den Tisch herum und umarmte sie. »Alles wird sich finden, das verspreche ich dir. Ich bin hier, ich werde mich um dich kümmern.«
Es waren dieselben Worte, mit denen sie immer Petronilla tröstete. Sie glichen einem Verband: Er mochte die Verletzung nicht heilen, machte sie aber erträglicher. Sie legte den Kopf an seine Brust und gestattete sich, ihren Tränen freien Lauf zu lassen. Dann löste sie sich von ihm. Die Sonnenstrahlen fielen noch immer auf die Vase, und sie hielt ihre Hand in das Licht und sah, wie die Farben auf ihrem Handgelenk tanzten: zinnoberrot, tiefblau und dunkelviolett.
»Ohne das Licht bleibt die Schönheit im Verborgenen«, sagte Geoffroi. »Dennoch ist sie immer da. Wie Gottes Liebe oder die Liebe deiner Eltern. Vergiss das nicht, Alienor. Du wirst geliebt.«
In der dritten Woche nach Ostersonntag herrschte warmes Wetter, und als die Sonne an jenem schönen Frühlingsmorgen am Himmel höher stieg, gingen Alienor und Petronilla in Begleitung der Kammerfrauen mit ihren Näharbeiten in die Palastgärten. Im Hintergrund spielten Musikanten leise auf Harfen und Lautengitarren und sangen vom Frühjahr, von Erneuerung und unerwiderter Sehnsucht. Das Wasser in den marmornen Springbrunnen plätscherte träge; ein einschläferndes Geräusch erfüllte die goldene Wärme.
Die Frauen, ermutigt, weil Floreta anderweitig beschäftigt war, schwatzten mit den Spatzen in den Maulbeerbäumen um die Wette. Ihr törichtes Geplapper ärgerte Alienor. Sie wollte nicht darüber klatschen, wer wem schöne Augen machte, und ob das Kind, das die Frau des Unterhaushofmeisters erwartete, von ihrem Mann oder einem jungen Ritter des Palasts stammte. Als Alienor ein Kind gewesen war, hatte im Haushalt ihrer Großmutter mütterlicherseits in Poitiers die Gerüchteküche gebrodelt, und sie hasste es, mit anhören zu müssen, wie diese trivialen, vernichtenden Gerüchte wie Falschgeld weitergegeben wurden. Wenn der Klatsch erst einmal die Runde machte, ließ er sich nicht mehr eindämmen, und ein guter Ruf konnte innerhalb weniger Momente ruiniert werden.
Ihr Großvater hingegen hatte sich über die Meinungen anderer hinweggesetzt und ganz offen mit seiner Mätresse, Dangereuse de Châtellerault, zusammengelebt. Oft war er moralischer Verwerflichkeit beschuldigt worden.
»Genug jetzt«, fauchte sie, ihre Autorität geltend machend. »Ich würde gerne in Ruhe der Musik zuhören.«
Die Frauen wechselten Blicke, verstummten aber. Alienor nahm sich ein Stück kandierte Birne von einer Platte und biss in das gezuckerte Fruchtfleisch. Diese Süßigkeit aß sie am liebsten, und sie verschlang sie heißhungrig. Ihre intensive Süße spendete ihr Trost, und zu wissen, dass sie sie sich jederzeit servieren lassen konnte, verlieh ihr das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Aber in dieses Gefühl mischte sich Unzufriedenheit, denn was brachte es schon, den Frauen das Schwatzen zu verbieten und sich Süßigkeiten zu bestellen? In einer solch hohlen Macht lag wenig Befriedigung.
Während eine Frau Petronilla zeigte, wie sie zarte Gänseblümchen stickte, legte Alienor ihre Näherei beiseite und schlenderte durch den Garten. Ein dumpfer Schmerz pochte hinter ihren Schläfen, der durch den Stirnreif noch verstärkt wurde. Ihre monatliche Blutung stand bevor, und ihr Magen schmerzte. Sie hatte nicht gut geschlafen, war von Albträumen gequält worden, an die sie sich nicht erinnern konnte. Aber sie hatte die ganze Zeit das Gefühl gehabt, eingeschlossen zu sein.
Neben einem jungen Kirschbaum blieb sie stehen und strich leicht über die noch grünen Früchte. Wenn ihr Vater zurückkam, würden sie dunkelrot, fast schwarz sein. Prall und süß und reif.
»Tochter.«
Nur zwei Menschen nannten sie so. Sie drehte sich zu Erzbischof Geoffroi um und wusste schon, bevor er das Wort ergriff, was er sagen würde. Er machte ein betrübtes Gesicht.
»Ich habe schlechte Neuigkeiten«, begann er.
»Es geht um meinen Vater, nicht wahr?«
»Kind, du solltest dich setzen.«
Sie sah ihm fest in die Augen. »Er kommt nicht zurück, oder?«
Er wirkte verblüfft, fasste sich aber schnell. »Es tut mir leid, dir sagen zu müssen, dass er Karfreitag ganz in der Nähe von Compostela gestorben ist und dort zu den Füßen des heiligen Jakob begraben wurde.« Seine Stimme klang rau. »Er ist jetzt bei Gott und von seinen Schmerzen erlöst. Ihm ging es seit einiger Zeit nicht gut.«
Die Trauer schlug wie eine mächtige Welle über ihr zusammen. Sie hatte von Anfang an gewusst, dass etwas nicht stimmte, aber niemand hatte es für nötig befunden, ihr etwas zu sagen, am wenigsten ihr Vater.
Geoffroi gab ihr den Saphirring, den er in der Hand hielt. »Er hat dir dies geschickt, damit du Bescheid weißt, und er möchte, dass du dir alle Mühe gibst, so wie du es immer getan hast, und auf den Rat deiner Beschützer hörst.«
Sie betrachtete den Ring und erinnerte sich daran, wie er am Tag der Abreise am Finger ihres Vaters gefunkelt hatte. Ihr war, als würde man ihr den Boden unter den Füßen wegziehen. Sie blickte zu ihrer Schwester hinüber, die über irgendetwas lachte. In wenigen Momenten würde das Lachen verstummen und Kummer und Tränen weichen, wenn Petronillas Welt ebenfalls aus den Fugen geriet, und das war noch schwerer zu ertragen als ihr eigener Schmerz.
»Was wird jetzt aus uns?« Sie versuchte, sachlich und erwachsen zu klingen, obwohl sie das Zittern in ihrer Stimme nicht unterdrücken konnte.
Geoffroi schloss ihre Hand um den Ring. »Keine Angst, für dich ist gesorgt. Dein Vater hat in seinem Testament dementsprechende Vorkehrungen getroffen.« Er machte Anstalten, sie zu umarmen, doch sie wich zurück und hob das Kinn.
»Ich bin kein Kind mehr.«
Geoffroi ließ die Hände sinken. »Aber du bist noch sehr jung«, gab er zurück. »Deine Schwester …« Er schaute zu den Frauen hinüber.
»Ich werde es Petronilla sagen«, verkündete sie. »Und sonst niemand.«
Er machte eine zustimmende Geste, obwohl noch immer ein besorgter Ausdruck auf seinem Gesicht lag. »Wie du willst, Tochter.«
Alienor ging mit Geoffroi zu den Frauen zurück. Nachdem diese vor dem Erzbischof geknickst hatten, entließ Alienor sie und setzte sich neben ihre Schwester.
»Schau, was ich gestickt habe!« Petronilla hielt das Taschentuch in die Höhe, an dem sie gearbeitet hatte. Eine Ecke war mit weißen Gänseblümchen mit goldenen Fäden in der Mitte verziert. Petronillas braune Augen leuchteten vor Freude. »Das schenke ich Papa, wenn er nach Hause kommt!«
Alienor biss sich auf die Lippe. »Petra.« Sie legte einen Arm um ihre Schwester. »Hör zu. Ich muss dir etwas sagen.«
3
Burg Béthizy, Frankreich, Mai 1137
Louis, den man aus der Kirche fortgeholt hatte, betrat das Krankenzimmer seines Vaters in der obersten Kammer der Burg. Die weit geöffneten Fensterläden ließen eine leichte Brise herein und gaben den Blick auf einen blauen Frühlingshimmel frei. Auf mehreren Tischen standen Schalen mit Weihrauch, was allerdings kaum dazu beitrug, den Gestank abzumildern, der Louis’ verrottendem, aufgeblähtem Körper entströmte. Louis unterdrückte einen Würgereiz, als er neben dem Bett niederkniete und sich verneigte. Er erschauerte, als sein Vater ihn segnete und dabei seinen Scheitel berührte.
»Steh auf.« Die Stimme von Louis dem Älteren klang belegt. »Lass dich anschauen.«
Louis hatte Mühe, sich seine Furcht nicht anmerken zu lassen. Der Körper seines Vaters mochte aufgedunsen und dem Verfall anheimgegeben sein, aber die eisblauen Augen zeugten immer noch von dem Geist und der Willenskraft des erfahrenen Jägers, Soldaten und Königs, die in der sterbenden Hülle gefangen waren. In Gegenwart seines Vaters fühlte sich Louis stets in die Defensive gedrängt. Als zweiter Sohn sollte er eine Kirchenlaufbahn einschlagen, aber als sein älterer Bruder bei einem Reitunfall umgekommen war, hatte Louis sein Studium in Saint-Denis aufgeben müssen und war zum Erben des Königreichs ernannt worden. Es war Gottes Entscheidung, und Louis wusste, dass er sich Gottes Willen fügen musste, aber es war nicht seine Wahl gewesen – und ganz sicher nicht die seiner Eltern.
Seine Mutter stand mit gefalteten Händen auf der rechten Seite des Betts und schürzte wie so oft die Lippen, was besagte, dass sie alles und er nichts wusste. Zu ihrer Linken standen einige der engsten Vertrauten und Berater seines Vaters, darunter die Brüder seiner Mutter, William und Amadée. Und Theobald, der Graf von Blois. Louis’ Unbehagen wuchs.
Sein Vater schnaubte wie ein Pferdehändler, der mit dem ihm angebotenen Tier nicht zufrieden war, aber wusste, dass er damit vorliebnehmen musste.
»Ich habe eine Aufgabe für dich, die einen Mann aus dir machen wird«, sagte er.
»Sire?« Louis’ Kehle war wie zugeschnürt, und seine Stimme klang ein wenig schrill, was seine innere Anspannung verriet.
»Es geht um ein Ehegelöbnis. Suger wird dir alles erklären; er hat genug Luft in den Lungen und hört sich überdies gerne reden.« Sein Vater winkte, woraufhin der kleine scharfäugige Abt von Saint-Denis vortrat. Er hielt eine Schriftrolle in den Händen und trug ob der höhnischen Bemerkung eine tadelnde Miene zur Schau.
Louis zwinkerte. Ehegelöbnis?
»Sire, wir haben wichtige Neuigkeiten für Euch.« Sugers Stimme klang einschmeichelnd, und er sah Louis freimütig an. Er war nicht nur einer der engsten Vertrauten seines Vaters, sondern auch Louis’ Lehrer und Mentor. Louis liebte ihn, wie er seinen Vater nicht zu lieben vermochte, weil Suger ihm half, die Welt zu begreifen, und Verständnis für seine Bedürfnisse hatte. »William von Aquitanien ist während einer Pilgerreise nach Compostela gestorben, möge Gott seiner Seele gnädig sein.« Suger bekreuzigte sich. »Bevor er aufbrach, schickte er sein Testament nach Frankreich. Darin bittet er Euren Vater, sich im Falle seines Todes um seine Töchter zu kümmern. Die ältere ist dreizehn und heiratsfähig, die jüngere elf.«
Louis’ Vater stemmte sich mühevoll hoch und versuchte, an die Kissen und Polster gelehnt, eine sitzende Position einzunehmen. »Wir müssen die Gelegenheit nutzen«, knurrte er. »Aquitanien und Poitou werden unser Land und unser Ansehen um ein Hundertfaches vergrößern. Wir können nicht zulassen, dass beides in fremde Hände fällt. Geoffrey von Anjou zum Beispiel wird mit Freuden versuchen, sich das Herzogtum durch eine Heirat seines Sohnes mit dem ältesten Mädchen an sich zu reißen, und das müssen wir verhindern.« Das Sprechen strengte ihn so an, dass er violett anlief, nach Atem rang und Suger bedeutete fortzufahren.
Suger räusperte sich. »Euer Vater wünscht, dass Ihr eine Armee nach Bordeaux führt, um das Gebiet zu sichern, und das älteste Mädchen heiratet. Sie hält sich im Moment unter strengem Schutz im Palast von Ombrière auf, und der Erzbischof wartet auf Eure Ankunft.«
Louis schwankte, als hätte er einen Schlag in die Magengrube erhalten. Natürlich wusste er, dass er eines Tages heiraten und Kinder zeugen musste, hatte dies aber immer als unliebsame Pflicht in einer fernen Zukunft betrachtet. Nun teilte man ihm mit, dass er ein Mädchen ehelichen musste, das er noch nie zuvor gesehen hatte und das aus einem Land kam, dessen Bewohner als vergnügungssüchtig galten und eine lockere Moral hatten.
»Ich werde dafür sorgen, dass das Mädchen unseren Sitten und Gebräuchen gemäß erzogen wird«, warf seine Mutter ein, die sich in dieser Angelegenheit ihre eigene Machtstellung sichern wollte. »Sie sind viele Jahre lang ohne Mutter aufgewachsen und werden davon profitieren.«
Raoul von Vermandois, der Burgvogt seines Vaters, trat vor. »Sire, ich werde unverzüglich Vorkehrungen zur Abreise treffen.« Er fungierte auch als Berater und war zudem Louis’ Vetter ersten Grades. Eine Lederklappe verdeckte seine leere Augenhöhle – er hatte vor achtzehn Jahren bei einer Belagerung ein Auge verloren. Auf dem Schlachtfeld war er ein zuverlässiger Kämpfer und zudem ein eleganter und charismatischer Höfling, der von den Damen sehr geschätzt wurde. Die Augenklappe erhöhte den Reiz noch für sie.
»Beeilt Euch, Raoul«, sagte der König. »Zeit ist von entscheidender Bedeutung.« Er hob warnend den Zeigefinger. »Die Eskorte muss groß und prunkvoll ausgestattet sein; die Poiteviner legen Wert auf solche Dinge, und wir müssen sie um jeden Preis bei Laune halten. Befestigt Banner an Euren Speeren und bindet Bänder um Eure Helme. Seht zu, dass Ihr mit Geschenken auftrumpft, nicht mit Schwerterklingen.«
»Überlasst alles mir, Sire.« Von Vermandois verneigte sich und verließ die Kammer. Sein prachtvoller Umhang blähte sich wie ein Segel.
Louis kniete nieder, um erneut den Segen seines Vaters zu empfangen, und irgendwie gelang es ihm gerade noch, die faulig stinkende Kammer zu verlassen, bevor er sich krümmte und sich heftig übergab. Er wollte nicht heiraten. Er wusste nichts von Mädchen, außer dass ihre weiche Figur, ihr Gekicher und ihre zwitschernden Stimmen ihn abstießen. Seine Mutter war anders, sie war hart wie Eisen, aber sie hatte ihm nie gezeigt, dass sie ihn liebte. Die einzige Zuneigung, die er in dieser Welt kannte, hatte ihm Gott geschenkt, doch Gott schien jetzt zu wünschen, dass er sich vermählte. Vielleicht war dies eine Strafe für seine Sünden, und deshalb sollte er sie frohen Herzens annehmen und den Herrn preisen.
Als Diener herbeieilten, um die Bescherung zu beseitigen, kam Suger aus der Kammer.
»Ach, Louis, Louis.« Der Abt legte dem jungen Mann tröstend einen Arm um die Schulter. »Ich weiß, dass das ein Schock für dich ist, aber es ist Gottes Wille, und du musst dich ihm fügen. Er bietet dir wundervolle Möglichkeiten und ein Mädchen, das fast in deinem Alter ist und deine Frau und Gefährtin sein wird. Das ist wirklich ein Grund zur Freude.«
Sugers beruhigende Worte bewirkten, dass Louis die Fassung zurückgewann. Wenn dies wirklich Gottes Wille war, musste er gehorchen und sich mit seinem Los abfinden. »Ich kenne noch nicht einmal ihren Namen«, sagte er.
»Ich glaube, er lautet Alienor, Sire.«
Louis formte die Silben stumm mit den Lippen. Ihr Name glich einer exotischen Frucht, die er nie zuvor gekostet hatte. Sein Magen rebellierte immer noch.
4
Bordeaux, Juni 1137
Alienor spürte, wie Ginnet am Zügel zerrte, während sie neben Erzbischof Geoffroi herritt. Genau wie ihre Stute brannte auch sie darauf, mit dem Wind um die Wette zu jagen. Schon seit einigen Tagen war sie nicht mehr im Freien gewesen, und dann auch nur unter strenger Bewachung, weil sie auf dem Heiratsmarkt einen so hohen Preis erzielte. An diesem Morgen hatte der Erzbischof die Verantwortung für ihre Sicherheit übernommen. Seine Ritter blieben wachsam, hielten aber Abstand, sodass sie sich ungestört unterhalten konnten.
In den zwei Monaten seit dem Tod ihres Vaters war der warme Frühling in einen heißen Sommer übergegangen, und die Kirschen an den Bäumen in den Palastgärten schimmerten dunkel. Ihr Vater ruhte in seinem Grab in Compostela, und sie selbst befand sich in einer Art Schwebezustand: eine Erbin, die zwar dank ihres Ranges über die Macht verfügte, über das Schicksal anderer zu bestimmen, aber außerhalb der Frauengemächer keinerlei Autorität ausübte. Welchen Einfluss hatte denn schon ein dreizehnjähriges Mädchen auf die Männer, die ihr Schicksal in den Händen hielten?
Sie erreichten offenes Gelände, und Alienor stieß Ginnet die Fersen in die Flanken und ließ die Zügel locker. Geoffroi tat es ihr nach. Staub wirbelte unter den auf die ausgedörrte Erde trommelnden Hufen auf. Alienor spürte den warmen Wind im Gesicht und sog den durchdringenden Duft des wilden Thymians ein. Grelles Sonnenlicht blendete sie. Mit Begeisterung gab sie sich dem Rennen hin, und dieses eine Mal verflogen ihre Sorgen und Ängste. Sie fühlte sich frei und lebendig, das Blut rauschte durch ihre Adern. Alle Anspannung, alles, was sie beengt hatte, fiel von ihr ab, und es überwältigten sie Gefühle, die so heiß und kraftvoll waren wie die Sonne.
Als sie bei einer verwitterten römischen Statue zum Stehen kamen, beugte Alienor sich vor und tätschelte Ginnets verschwitzten Hals. Ihr Vater hatte ihr von den Römern erzählt. Vor tausend Jahren hatten sie Aquitanien erobert und sich dort angesiedelt. Sie hatten Latein gesprochen, die Sprache, derer sich jetzt die Gelehrten bedienten. Auch sie hatte sie zusammen mit dem Französisch gelernt, das in Poitou und dem Norden gesprochen wurde und sich von der lenga romana von Bordeaux unterschied.
Die Statue hatte den rechten Arm erhoben, als wolle sie eine Rede halten, ihr leerer Blick war auf den Horizont gerichtet. Goldene Flechten schmückten ihren Brustpanzer und die Fransen ihres Gürtels.
»Niemand weiß, wer er ist«, sagte Geoffroi. »Es gibt keine Inschrift. Viele, die in diesem Land Spuren hinterlassen haben, wurden wieder ausgelöscht. Die Menschen hier mögen es nicht, unterjocht zu werden.«
Alienor straffte sich im Sattel. Die Erkenntnis, dass sie die Herzogin von Aquitanien war, regte sich in ihr wie ein erwachender Drache, der sich streckte. »Ich habe keine Angst vor ihnen«, gab sie zurück.
Das gleißende Sonnenlicht ließ die Furche zwischen den Brauen des Erzbischofs noch tiefer erscheinen. »Du solltest trotzdem vorsichtig sein. Das ist besser, als überrumpelt zu werden.« Er zögerte, dann fuhr er fort: »Tochter, ich habe Neuigkeiten für dich, und ich möchte, dass du mir gut zuhörst.«
Alienor war plötzlich auf der Hut. Sie hätte wissen müssen, dass hinter diesem Ausritt mehr steckte als nur die Freude an der frischen Luft und Bewegung. »Was für Neuigkeiten?«
»Weil er dich liebte und sich Sorgen um dich und sein Land machte, hat dein Vater testamentarisch deine Zukunft festgelegt.«
»Was meint Ihr mit ›meiner Zukunft‹? Warum habt Ihr bislang nichts davon gesagt?« Furcht und Zorn stiegen in ihr auf. »Warum hat mein Vater nicht mit mir gesprochen?«
»Weil alles erst wachsen muss, bevor es Früchte trägt«, erwiderte Geoffroi ernst. »Wäre dein Vater aus Compostela zurückgekehrt, hätte er es dir selbst gesagt. Es wäre unklug gewesen, es zu erwähnen, bevor alles geklärt ist, aber nun ist der richtige Zeitpunkt gekommen.« Er beugte sich zu ihr und legte seine Hand auf ihre. »Dein Vater wollte eine Heirat für dich arrangieren, die dir und Aquitanien zur Ehre gereicht und dir zu einer bedeutungsvollen Stellung verhilft. Er wollte dich in Sicherheit wissen und den Frieden im Land bewahren. Bevor er aufbrach, bat er den König von Frankreich, für dein Wohlergehen zu sorgen und dich mit seinem ältesten Sohn Louis zu verheiraten. Eines Tages wirst du Königin von Frankreich und, wenn Gott sich gnädig zeigt, Mutter von Königen sein, deren Reich sich von Paris bis zu den Pyrenäen erstreckt.«
Die Worte trafen Alienor wie Hiebe einer Streitaxt. Entsetzt starrte sie ihren Lehrer an.
»Das ist eine große Chance für dich.« Geoffroi musterte sie. »Du wirst dem Potenzial gerecht werden, das dein Vater in dir gesehen hat, und dafür mit einer Krone belohnt. Durch ein Bündnis zwischen Frankreich und Aquitanien verstärken beide Länder ihre Macht.«
»Mein Vater hätte so etwas nie in die Wege geleitet, ohne mit mir zu sprechen.« In Alienors Benommenheit mischte sich das furchtbare Gefühl, verraten worden zu sein.
»Er wusste, dass er sterben würde, Kind«, entgegnete Geoffroi bekümmert. »Er musste für dich die bestmögliche Vorsorge treffen, und seine Verfügung musste so lange geheim gehalten werden, bis die Zeit reif war.«
Sie blickte ihn an. »Ich will nicht mit einem französischen Prinzen verheiratet werden. Ich will einen Mann aus Aquitanien heiraten.«
Als er ihre Hand drückte, spürte sie seinen Bischofsring. »Du musst mir und deinem Vater vertrauen. Wir haben das getan, was für alle am besten ist. Wenn du einen Mann aus deinem Land heiratest, würde das zu Rivalitäten und einem Krieg führen und Aquitanien spalten. Louis wird innerhalb der nächsten Wochen hier eintreffen, und du wirst in der Kathedrale mit ihm getraut. In einer würdevollen Zeremonie, wie dein Vater es gewünscht hat. Und die Vasallen werden dir den Treueid leisten. Du kannst nicht nach Paris reisen, weil du ein zu wertvolles Heiratsgut bist und viele Männer versuchen würden, dich gewaltsam in ihren Besitz zu bringen, um dich für ihre eigenen Zwecke zu benutzen, solange du nicht vermählt bist.«
Alienor erschauerte. Seine Worte stießen sie in ein tiefes dunkles Loch. Ihre Lippen formten eine Weigerung, aber sie brachte keinen Ton heraus.
»Tochter, hast du mir zugehört? Du wirst eine große Königin sein.«
»Aber niemand hat mich gefragt. Alles wurde hinter meinem Rücken beschlossen.« Ein Kloß bildete sich in ihrer Kehle. »Was, wenn ich nicht bereit bin, Louis von Frankreich zu heiraten? Was, wenn ich … wenn meine Wahl auf einen anderen Mann fällt?«
In seinem Blick lag Mitgefühl, aber auch Strenge. »Das ist unmöglich. Schlag es dir aus dem Kopf. Es ist üblich und schicklich, dass ein Vater bestimmt, wen seine Tochter heiratet. Vertraust du seinem Urteil nicht? Es ist die richtige Entscheidung, für dich und für Aquitanien und Poitou. Louis ist jung, gut aussehend und gebildet. Es ist eine in jeder Hinsicht passende Verbindung – und deine Pflicht.«
Alienor kam sich vor, als würde sie in eine Kiste gezwängt, der Deckel zugenagelt und Licht und Leben ausgesperrt. Niemand hatte sich die Mühe gemacht, ihr etwas zu sagen, als wäre sie nicht mehr als ein wertvolles Päckchen, das von einer Hand zur nächsten gereicht wurde. Was nutzte es ihr, Herrin ihres Landes zu sein, wenn dieses Land den Franzosen auf einer Silberplatte überreicht wurde? Sie fühlte sich gekränkt und verraten, weil ihr Lehrer sie nicht eingeweiht und ihr Vater dieses Geheimnis sogar mit ins Grab genommen hatte. Genauso gut konnte sie ihr Leben damit verbringen, gezuckerte Früchte zu essen und dummem Klatsch zu lauschen.
Sie wendete Ginnet, stieß ihr erneut die Fersen in die Flanken und verlor sich einen Moment lang in dem rasenden Galopp. Doch als das Pferd zu ermatten begann, zügelte sie es, wohl wissend, dass sie ihrem Schicksal, das ihr aufgrund der Täuschung derer beschieden war, denen sie am meisten vertraut hatte, nicht entrinnen konnte, und wenn sie noch so schnell dahinjagte.
Geoffroi war ihr nicht gefolgt, und sie blieb allein auf der staubigen Straße stehen und starrte in die Ferne wie der unbekannte Römer auf seinem von Flechten überwucherten Sockel. Der Erzbischof hatte so geklungen, als wäre diese Ehe der Gipfel glücklicher Fügung, aber sie konnte das nicht nachvollziehen. Sie hatte nie vorgehabt, Königin von Frankreich zu werden. Ihre heilige Pflicht bestand darin, Herzogin von Aquitanien zu sein, und das war das Einzige, was zählte. Wenn sie insgeheim von einer Hochzeit geträumt hatte, dann mit Gottfried von Rancon, Lord von Taillebourg und Gençay, an ihrer Seite. Vielleicht hegte Gottfried ähnliche Gedanken, auch wenn er nie darüber gesprochen hatte.
Schweren Herzens wendete sie ihr Pferd und kehrte zu ihrem Lehrer zurück. Während des kurzen Ritts schien es ihr, als fielen die letzten Splitter ihrer Kindheit hinter ihr in den Staub und funkelten noch einmal auf, bevor sie endgültig verschwanden.
Zurück im Palast, ging Alienor zu der Kammer, die sie sich mit Petronilla teilte, um sich umzukleiden und für die Hauptmahlzeit des Tages herzurichten, obwohl sie keinen Hunger hatte und ihr Magen sich zusammenkrampfte. Sie beugte sich über die Waschschüssel aus Messing, wusch ihr Gesicht mit kühlem, duftendem Wasser und spürte, wie es ihre von der Sonne gereizte Haut beruhigte.
Petronilla saß auf dem Bett, zupfte die Blütenblätter von einem Gänseblümchen und summte leise und unmelodisch vor sich hin. Der Tod ihres Vaters hatte sie schwer getroffen. Zuerst hatte sie sich geweigert zu akzeptieren, dass er nicht wiederkommen würde, und Alienor bekam ihren Zorn und ihren Schmerz in vollem Ausmaß zu spüren, weil Petronilla sonst niemand hatte, an dem sie ihren Kummer auslassen konnte. Inzwischen ging es ihr ein wenig besser, aber sie neigte immer noch zu Tränenausbrüchen und hatte oft schlechte Laune und war gereizt.
Alienor wollte Petronilla unter vier Augen sprechen und zog die Vorhänge des Betts zu, damit die Kammerfrauen nichts mitbekamen. Sie würden alles noch früh genug erfahren – wenn der Hofklatsch nicht schon längst zu ihnen durchgedrungen war. Sie setzte sich neben sie und fegte die verstreuten Blütenblätter beiseite.
»Ich habe Neuigkeiten für dich«, begann sie.
Petronilla erstarrte. Letztes Mal war die Nachricht, die ihr Alienor überbracht hatte, verheerend gewesen.
Mit gedämpfter Stimme fuhr Alienor fort: »Der Erzbischof sagt, ich muss Louis heiraten, den Erben Frankreichs. Er sagt, Papa hätte das arrangiert, bevor er … fortgegangen ist.«
Petronilla sah sie ausdruckslos an und schmiss den Gänseblümchenstrauß aufs Bett. »Wann?«, fragte sie eisig.
»Bald.« Alienor verzog den Mund. »Er ist schon auf dem Weg hierher.«
Petronilla erwiderte nichts, sondern drehte sich zur Seite und nestelte an den verknoteten Schnüren ihres Gewandes.
»Komm, lass mich das …« Alienor streckte die Hand aus, aber Petronilla schlug sie weg.
»Ich kann das allein!«, schnaubte sie. »Ich brauche dich nicht!«
»Petra …«
»Du gehst weg und lässt mich zurück, wie alle anderen auch. Dir liegt nichts an mir. Niemandem liegt etwas an mir!«
Alienor kam sich vor, als hätte Petronilla ihr ein Messer in den Leib gestoßen. »Das stimmt nicht! Ich liebe dich sehr. Glaubst du, ich hätte diese Wahl aus freien Stücken getroffen?« Sie erwiderte den wutentbrannten, verängstigten Blick ihrer Schwester. »Glaubst du, ich wäre nicht verzweifelt oder hätte keine Angst? Wir haben doch nur noch uns. Ich werde immer für dich da sein.«
Petronilla zögerte, dann warf sie sich in Alienors Arme und drückte sie weinend an sich. »Ich will nicht, dass du weggehst.«
»Das tue ich auch nicht.« Alienor streichelte Petronillas Haar, während ihr die Tränen über die Wangen liefen.
»Schwöre es.«
Alienor bekreuzigte sich. »Ich schwöre es bei meiner Seele. Ich werde nicht zulassen, dass uns etwas trennt. Komm jetzt.« Schniefend und mit tränennassem Gesicht half sie Petronilla, den Knoten zu lösen.
»Wie … wie sieht Louis von Frankreich denn aus?«
Alienor zuckte die Achseln und wischte sich über die Augen. »Ich weiß es nicht. Bevor sein älterer Bruder starb, sollte er eigentlich eine Kirchenlaufbahn einschlagen, also verfügt er wenigstens über eine gewisse Bildung.« Sie wusste auch, dass sein Vater Louis der Dicke genannt wurde, und sah einen ekelerregenden übergewichtigen, jungen Mann mit einem teigigen Gesicht vor sich. Sie seufzte nachdenklich. »Es war Papas Wunsch, und er muss seine Gründe gehabt haben. Wir müssen unsere Pflicht tun und uns seinem Willen fügen. Uns bleibt keine andere Wahl.«
5
Bordeaux, Juli 1137
In der drückenden Hitze Anfang Juli wurden die Vorbereitungen für die Ankunft des französischen Bräutigams und seiner Armee getroffen. Bordeaux erhielt die Nachricht, dass Louis Limoges rechtzeitig erreicht hatte, um das Fest des heiligen Martial am dreißigsten Juni feiern zu können. Er hatte die Lehnseide des Grafen von Toulouse und jener Barone des Limousin entgegengenommen, die gekommen waren, um ihm die Treue zu schwören, sowie sich die Kunde von der bevorstehenden Heirat in Alienors Herrschaftsgebieten verbreitet hatte. Jetzt war die französische Kavalkade in Begleitung von Alienors Vasallen zu der letzten Etappe der Reise aufgebrochen.
Bordeaux bereitete sich gründlich auf Louis’ Eintreffen vor. Gasthäuser wurden ausgefegt und mit Bannern und Girlanden geschmückt. Vorräte von den umliegenden Ländereien und Unmengen von Fleisch und Geflügel wurden herbeigeschafft. Näherinnen schneiderten aus Bahnen von goldenem Stoff ein Hochzeitskleid, das ihrer neuen Herzogin und einer zukünftigen Königin Frankreichs würdig war. Die Schleppe war mit Hunderten von Perlen bestickt, die von den Handgelenken bis zu den Knöcheln fallenden Ärmel mit dekorativen goldenen Häkchen besetzt, damit man sie zurückschlagen konnte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!