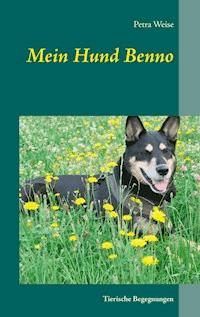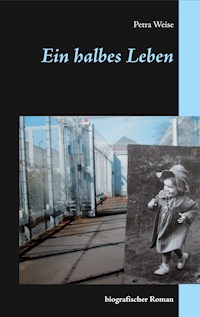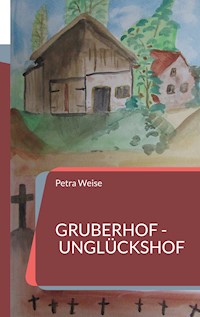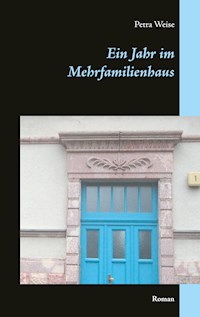Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Warum ich weine? Weil mein Vater gestorben ist!" "Er ist gar nicht dein Vater!" Marion ist erst zwölf Jahre alt, als man ihr diese harten Worte an den Kopf wirft. Sie verliert mit ihrem Vater, der gar nicht ihr Vater ist, den einzigen Menschen, der sich bisher liebevoll um sie gekümmert hat. Erst zwanzig Jahre später hält sie einen Zettel mit wichtigen Daten aus ihrer Vergangenheit in der Hand. Sie macht sich sofort auf den Weg in das tausend Kilometer entfernte Heimatdorf ihres "anderen" Vaters, obwohl sie weiß, dass sie ihn dort nicht finden wird. Doch sie findet etwas, was ihr bisher immer gefehlt hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muss man es aber vorwärts.
Sören Kierkegaard
Inhaltsverzeichnis
1997 - Marion
2017 - Zwanzig Jahre später
Pflegeheim
Wer ist Mario?
2002 - Lorenzo
Felix
2003 - Die Entscheidung
2007
Rückkehr
Im Pflegeheim
Heike
In der Anwaltskanzlei
Das Hotel
Basti
Urlaub
2017
Die Schachtel
Heike
Unterwegs
Sonja
Rast in Kufstein
Florian
Weiterfahrt
Im Krankenhaus
André
Rapallo
André
Pläne
Unterwegs
Vater
Nachsatz
1997 - Marion
„Warum weinst du?“, fragte mich Tante Amelie streng.
Fassungslos schaute ich meine Tante an. Wie sollte ich nicht weinen? Mein Vater war gestorben, ausgerechnet an meinem zwölften Geburtstag. Ich wartete am Fenster auf ihn, weil er mir eine Überraschung versprochen hatte. Es wurde Zeit, die Torte anzuschneiden. Doch statt Vater kamen zwei Polizisten und kurz darauf Tante Amelie. Sie sagte, dass Vater tot sei, es habe einen Unfall gegeben.
Und heute wurde er beerdigt. Ich durfte nicht mit zum Friedhof, das sei nichts für Kinder.
„Nimm dir ein Beispiel an Heike, die macht nicht solch ein Theater wie du, obwohl es ihr Vater ist.“
Heike war meine kleine Schwester. Sie war vier Jahre jünger als ich und ein sehr stilles Kind, das kaum redete. Alle in der Verwandtschaft verhätschelten sie, weil sie so niedlich aussah mit ihren blonden Locken und ihren blauen Kulleraugen. Meine Augen waren braun. Locken hatte ich ebenfalls, doch die waren schwarz. Ich liebte sie, denn keiner in meiner Familie hatte schwarze Haare. Alle waren blond und blauäugig. Auch unser Vater.
Was hatte die Tante gesagt? Obwohl es ihr Vater ist?
Ich schrie meine Tante an: „Mein Vater ist er auch.“
„Eben nicht“, brummte die Tante.
„Was? Was hast du gesagt?“
„Nichts habe ich gesagt. Halt deinen Mund, du freches Kind! Putz dir die Nase und geh mir aus den Augen!“
Sie packte mich derb an den Schultern und schob mich zur Tür hinaus. Was sollte ich hier draußen? Ich hatte strenge Order, das Haus der Tante nicht zu verlassen. Doch ich hatte es nicht verlassen, ich wurde hinaus geschoben. Also konnte ich meiner Wege gehen. Die Erwachsenen würden es sowieso nicht merken, denn nach der Beerdigung folgte die Trauerfeier. Die Mutter wollte mich nicht sehen, das war mir klar. Ob ich zu Oma laufe?
Die Oma wohnte im Nachbardorf, sicher eine Stunde Fußmarsch von hier. Ein Fahrrad besaß ich nicht und das der Tante wagte ich nicht zu benutzen. Nun, ich hatte ohnehin Zeit und machte mich auf den Weg. Ich lief gleich quer übers Feld und kürzte dadurch ab. Allerdings ließ es sich auf dem Acker nicht gut laufen. Immer wieder knickte mein Fuß um. Verlaufen konnte ich mich nicht, denn die hohe Esse wies mir den Weg.
In der Schule hatte man uns erzählt, dass es der höchste Ziegelschornstein der ganzen Welt sei. Mir war das gleichgültig.
Endlich erreichte ich das Dorf und kam nun auf der glatten Straße besser voran. Ich betrat Omas Wohnung, doch ihre Tür war verschlossen. Ich rüttelte an der Klinke, doch es half nichts, die Tür war versperrt. Wütend pochte ich mit der Faust gegen das Holz und trat schließlich mit dem Fuß dagegen.
„Was ist hier los?“, wollte die Nachbarin wissen, die sich mit Oma die kleine Wohnung teilte.
„Ach, du bist es, Marion.“ Sie streichelte meine Wange und schob mir eine Locke hinters Ohr.
„Meine arme Kleine, deine Oma ist doch auf der Beerdigung. Weißt du das nicht?“
Daran hatte ich gar nicht gedacht und musste plötzlich weinen.
Die Nachbarin streichelte mich wieder. „Willst du einen Keks?“
Ich schüttelte den Kopf und lief hinaus.
Neben Omas Haus befand sich der Bahndamm. Er hieß Bahndamm, obwohl er eigentlich kein Damm, sondern eine tiefe Schlucht war, in der ganz unten die Schienen entlang liefen. Dort verunglückte vor vielen Jahren eine von Omas Töchtern tödlich. Sie fuhr mit ihrem Fahrrad über die Brücke, die über die Schlucht führte, wich einem LKW aus und rutschte die Felsen hinunter. Man konnte ihr nicht mehr helfen. Oma hatte das damals vom Fenster aus beobachtet. Sie sah es gar nicht gern, wenn ich den schmalen steilen Pfad nutzte, um oben an der Schlucht entlang zu klettern. Von dort gelangte ich auf einen Hang, der am Bach endete und den ich leicht überspringen konnte. Dann war es nicht mehr weit bis zu meinem geheimen Platz zwischen dichten Sträuchern. Hier fand mich keiner, denn die Sträucher hatten Dornen und hielten Mensch und Tier fern. Ich hatte mir ein Brett besorgt, auf dem ich bequem sitzen und die Straße unten im Tal beobachten konnte.
In meine Gedanken versunken hockte ich auf dem Brett und zog vorsichtig ein paar Dornen aus meinem linken Unterarm. Ich musste nachdenken - und zwar über die Worte der Tante. Sie hatte zu mir „eben nicht“ gesagt, und zwar genau in dem Moment, in dem ich über den verstorbenen Vater sprach. Hieß das, dass mein Vater gar nicht mein Vater ist? Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich liebte meinen Vater sehr. Aber liebte er mich ebenfalls? Väter lieben immer ihre Töchter. Doch wenn ich nun gar nicht seine Tochter bin? Der Vater war ein sehr ernster Mann, der nicht viele Worte machte. Wenn er am Nachmittag von der Arbeit kam, las er die Zeitung und durfte dabei nicht gestört werden. Danach lief er zum Stadtrand, wo er einen kleinen Garten hatte und es immer etwas zu tun gab. Manchmal half ich ihm. Ich lernte schnell, Unkraut von Nutzpflanzen zu unterscheiden. Am liebsten half ich bei der Ernte der Stachelbeeren. Mir machten die Dornen nichts aus. Jedenfalls nicht die an einem Strauch.
Im Moment fühlte ich nicht die Dornen, die meinen Arm zerkratzt hatten, sondern die, die tief in mein Herz stachen. Mein ganzer Körper tat mir weh und ich drückte mit beiden Armen gegen meinen Bauch und gleichzeitig meine rechte Hand auf die Brust.
Ich dachte an meine Schwester, die so ganz anders aussah als ich. Sie war kräftig und blond wie unsere Mutter, der Vater und die Oma. Alle waren sie groß und stämmig, ich dagegen eher klein und zierlich.
Es störte niemanden, dass Heike nicht sprach, ständig ihre Hände versteckte und immerzu in ein Buch schaute.
Ich dagegen wurde für alles gerügt, getadelt und zurechtgewiesen. Nichts machte ich richtig, alles machte ich falsch. Heike machte nichts falsch. Sie zog es vor, gar nichts zu tun.
Als es dunkel wurde, kroch ich aus meinem Versteck und schlich zu Oma. Sie schlug die Hände über dem Kopf zusammen.
„Mädchen! Wo kommst du denn her? Wie siehst du überhaupt aus?“
„Oma, ich bin so traurig“, schluchzte ich.
„Ich weiß, mein Kind. Jetzt geh dich waschen!“ Sie drückte mir ein frisches Handtuch in die Hand und schob mich aus der Tür.
Als ich zurück kam, stand eine Tasse Kakao auf dem Tisch und daneben ein Kräbbelchen, das ich so gern aß. Oma buk jede Woche Kräbbelchen und ich war überzeugt davon, dass sie es nur mir zuliebe tat.
„Tante Amelie sagt, Vater wäre gar nicht mein Vater und ich hätte keinen Grund zu weinen.“
„Was redest du da, du dummes Ding?“
„Aber ...“
„Nichts aber! Du isst jetzt und kaust ordentlich! Beim Essen spricht man nicht, weißt du das nicht?“
Ich nickte. Erst, als ich aufgegessen und meinen Kakao ausgetrunken hatte, wagte ich eine weitere Frage.
„Warum bin ich die Einzige in der ganzen Familie, die schwarze Haare hat?“
„Du fragst seltsame Dinge, Mädchen.“
„Nein, es ist seltsam, dass ihr alle blond und groß seid und ich dunkel und klein.“
„Genug von den Albernheiten!“ Omas Stimme klang streng.
„Ich weiß aber, dass die Eltern erst lange nach meiner Geburt heirateten.“
„Deine Mutter wollte schlank sein.“
Darauf wusste ich nichts zu sagen.
„Ich rufe jetzt Amelie an und sage ihr, wo du steckst. Sicher ist sie schon krank vor Sorge.“
Das glaubte ich allerdings nicht und verdrehte die Augen.
„Du schläfst heute Nacht bei mir“, bestimmte die Oma.
Sofort hatte ich gute Laune, denn eigentlich sollte ich zwei volle Tage und Nächte bei der Tante bleiben.
„Darf ich mit zu dir ins Bett? Bitte, Oma!“
„Nein, du redest nur dummes Zeug. Du schläfst auf der Couch!“
Ich nickte, obwohl mir das gar nicht gefiel. Doch alles war besser als zurück zu Tante Amelie zu müssen.
Ich hatte schon oft bei Oma geschlafen und mir früher mit ihrem jüngsten Sohn Martin das Zimmer geteilt, in dem jetzt die Nachbarin wohnte. Bis zu meinem Schulanfang lebte ich bei ihr, obwohl Mutter nach Heikes Geburt nicht mehr arbeiten ging. Das kam mir jetzt seltsam vor. Früher hatte ich nie darüber nachgedacht. Das lag wohl daran, dass ich mich bei meiner Oma so wunderbar wohl fühlte. Zwar war sie streng und hatte eine lockere Hand, die schnell und unvermittelt in mein Gesicht oder in das von Martin klatschte. Doch sie hatte viel Zeit für mich, hörte mir zu. Sie saß den lieben langen Tag und oft bis in die Nacht und strickte für die Leute Pullover, Kleider und Decken. Bei komplizierten Mustern durfte ich sie nicht stören, dann saß ich still neben ihr und sah ihr zu. Am liebsten strickte sie Babykleidung, sogar kleine Schuhe fertigte sie geschickt. Bereits mit drei oder vier Jahren verstand ich ebenfalls, mit den Stricknadeln umzugehen und fummelte für meine Puppe ganz viele bunte Kleider zusammen.
Kurz vor dem Schulanfang holte mich Mutter zu sich in die Stadt. Sie lebte in einer schönen Wohnung in einem Altbau. Das Treppenhaus war zwar sehr finster, doch die Zimmer wunderbar groß und hell. Im kleinsten Zimmer mit Blick zur Straße stand mein Bett. Doch ich war glücklich, hatte sogar einen eigenen Schreibtisch, wo ich malen und meine Hausaufgaben machen konnte.
Und ich hatte plötzlich eine Schwester. Heike war bereits zwei Jahre alt und sah aus wie ein kleiner Engel mit blonden Locken und blauen Kulleraugen. Doch am Allerschönsten fand ich, dass ich nun auch einen Vater hatte wie alle anderen Kinder auch. Ich weiß nicht mehr, ob mir jemand sagte, dass er mein Vater sei oder ob ich ihn einfach Papa nannte, weil es Heike tat. Für mich gehörte er ganz selbstverständlich dazu, denn jede Familie bestand aus Vater, Mutter und Kind. Jede.
Und nun stimmte das alles nicht mehr. Vater war gestorben und ich wusste nicht, wie es ohne ihn weitergehen sollte. Ich weinte viel.
Heike weinte nicht. Vermisste sie ihren Vater nicht? Oder fühlte sie nichts? Sie saß meist in irgend einer Ecke und las in einem Buch. Selten schaute sie auf, noch seltener sprach sie mit mir und am allerwenigsten ging sie mit mir hinaus auf die Straße oder in den nahen Park. So war sie schon immer, auch vor Vaters Tod. Alle Leute liebten und trösteten sie, obwohl sie gar nicht weinte.
Mich tröstete keiner. Durch mich sahen sie hindurch, als wäre ich überhaupt nicht vorhanden. Dabei war ich ein sehr lautes Kind, das schnell wütend wurde, wild um sich trat und hemmungslos schrie. Dann wurde ich ausgeschimpft und zurechtgewiesen. Meist lief ich ohnehin hinaus auf die Straße und spielte dort mit den Nachbarskindern.
Nach Vaters Tod kümmerte sich Mutter kaum noch um uns. Sie schloss sich in ihrem Zimmer ein, sobald sie die Wohnung betrat. Manchmal hörte ich sie weinen. Ich musste für mich selbst und auch für Heike sorgen, machte ihr am Abend eine Schnitte und schickte sie ins Bett.
Wenn wir morgens aufstanden, war Mutter schon zur Arbeit gegangen. Auf dem Tisch stand unser Frühstück: kalter Kakao, Cornflakes und unsere Schulbrote.
Die Hausarbeit blieb allein an mir hängen. Schon früher hatte sich Mutter nicht um den Haushalt gekümmert. Sie konnte weder putzen noch waschen und schon gar nicht kochen. Das erledigte alles der Vater.
Vater. Ich musste herausfinden, ob er mein Vater war oder nicht. Also nahm ich all meinen Mut zusammen und stellte mich eines Tages der Mutter in den Weg, bevor sie in ihrem Zimmer verschwinden konnte.
„Wer war mein Vater?“, schrie ich sie an.
Zuerst schaute sie wie üblich durch mich hindurch. Dann veränderte sich ihr Blick und ich erkannte kalten Zorn in ihrem Gesicht. Noch ehe ich zurückweichen konnte, schlug sie auf mich ein. Sie zielte nicht, sondern drosch mit den Fäusten auf meinen Kopf, in mein Gesicht, auf meine Arme und den Rücken. Ich war so überrascht, dass ich nicht auf die Idee kam, mich zu wehren oder wenigstens zu schützen.
Niemals wieder wagte ich, die Mutter nach meinem Vater zu fragen.
2017 - Zwanzig Jahre später
Ich stehe an Vaters Grab und betrachte das Durcheinander von Unkraut und vertrockneten Blumen. Am Rand hängen welke Köpfe von Stiefmütterchen über den Stein. Wer war nur auf die Idee gekommen, hier Stiefmütterchen zu pflanzen? Meine Mutter bestimmt nicht, die kümmerte sich nie um das Grab. Ob Heike hierher kommt? Sie weiß sicher nicht, dass Vater keine Stiefmütterchen mochte. Mich wundert, dass sie überhaupt noch blühen. Bisher glaubte ich immer, es wären Pflanzen für das Frühjahr. Jetzt im November hätte ich Erika gesetzt oder noch besser, das Grab gleich abgedeckt.
Ich verstehe nicht, warum Mutter das Grab behalten will. Will sie etwa, dass ihre Urne mit hier hinein kommt? Wir haben nie darüber gesprochen. Wozu auch?
Vater wäre verärgert über das viele Unkraut auf seinem Grab. Es überwuchert schon die Randsteine. Ich kauere mich an die Seite und zupfe an einem Halm, doch er bricht und lässt seine Wurzeln in der Erde.
Ich habe Chrysanthemen mitgebracht, finde aber keine Vase, um sie hineinzustellen.
Ob ich zur Friedhofsverwaltung gehe und das Grab pflegen lasse? So kann es jedenfalls nicht bleiben, doch säubern will ich es nicht. Was wird wohl aus Vaters Garten geworden sein? Ich war nach seinem Tod nie wieder dort und habe auch sonst nie mehr in einem Garten gearbeitet. Außerdem ist es gar nicht meine Aufgabe, mich um das Grab zu kümmern.
Am Ende ist es nicht einmal mein richtiger Vater. Sechs Jahre lang hat er sich um mich gesorgt, doch das ist inzwischen zwanzig Jahre her.
Heike sollte sich kümmern. Sie ist eindeutig seine Tochter, so groß und blond und still - wie Vater. Nun ist er tot. Manchmal glaube ich, Heike mag die Toten lieber als die Lebenden. Sie unterhält sich nicht gern mit den Menschen, die Toten sind ruhig und stören niemanden.
Ich mag die Ruhe nicht. Ich brauche Leben um mich, je lauter desto besser. Trotzdem schlendere ich langsam und ziellos über den Friedhof und ärgere mich, dass mir niemand begegnet. Ich hätte Zeit und Lust, mich mit jemandem zu unterhalten.
Pflegeheim
„Mutter, ich war auf dem Friedhof und habe bei Vater frische Blumen hingelegt.“
Sie sitzt in ihrem Sessel am Fenster und dreht sich nicht zu mir um. Das bin ich gewöhnt.
Dennoch gehe ich zu ihr und umarme sie. Wie immer zuckt sie zurück. Sie will diese Nähe nicht. Will sie gar keine Nähe oder liegt es an mir?
Sie seufzt. „Mario.“
„Ja, Mutter?“
Wieder seufzt sie und schaut wie entrückt hinaus in den Park.
„Friedhof. Nein, das glaube ich Ihnen nicht“, sagt sie mit fester Stimme und schaut mich endlich an. Es ist ein strafender Blick.
„Was glaubst du nicht, Mutter?“
„Ich glaube nicht, dass Mario auf dem Friedhof liegt. Dazu ist er viel zu jung. Das ist kein Alter zum Sterben.“
Jetzt bringt sie alles durcheinander. Meinen Namen und Vaters Tod. „Du hast Recht, Mutter“, bestätige ich schnell.
Vater ist nur 47 Jahre alt geworden, das ist wirklich kein Alter zum Sterben. Doch was faselt sie von einem Mario? Ich habe zwei Mal deutlich Mario verstanden, nicht Marion.
Sie schreit: „Sie lügen! Gehen Sie mir aus den Augen!“
Wütend schaut sie mir ins Gesicht und zeigt mit der Hand auf die Tür. „Gehen Sie! Sofort!“
Dann sinkt sie in sich zusammen und weint. Ich kauere mich zu ihren Füßen und lege meine Hände auf ihre Knie. Sie wischt sie sofort weg.
„Ich weiß, dass du Marion bist. Mir fehlt mein geliebter Mario. Er war mein Leben. Nach all den Jahren ...“
Unvermittelt bricht sie ab.
„Mutter, wer ist Mario?“
Sie antwortet nicht, hat wieder ihren glasigen Blick und schaut wie abwesend aus dem Fenster.
Wer ist Mario?
Ich muss das wissen und fahre zu Oma. Sie sitzt in ihrem Sessel und strickt. Das alte gewohnte Bild, das sich seit meiner frühesten Kindheit in mir festgebrannt hat. Ich fühle mich sofort ruhig und wohl. Mürrisch schaut sie kurz auf, um sich gleich wieder auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Wie immer wirkt sie unfreundlicher als sie ist.
„Oma, wie geht es dir?“
„Die Finger wollen nicht mehr so recht, die Augen auch nicht.“
Oma ist 75 Jahre alt. In diesem Alter ist es wohl normal, dass die Sehkraft nachlässt.
„Warum trägst du keine Brille?“, will ich wissen. Sie winkt ab, blickt aber nicht auf von ihrer Arbeit.
„Setz dich zu mir, Mädchen, und erzähle mir ein wenig!“
Ich rücke mir den Stuhl näher, damit ich ihr fast gegenüber sitzen kann.
„Vorhin habe ich Mama besucht.“
Oma bewegt ihre Lippen. Ich weiß nicht, ob sie Maschen für ein Muster zählt oder nur in sich hinein grummelt. Sie sagt nichts.
„Ihr geht es soweit gut“, berichte ich weiter.
„Hat sie dich erkannt?“
„Nein, sie siezt mich.“
„Du lieber Himmel! Das ist ja furchtbar, wenn eine Mutter ihr eigenes Kind nicht mehr erkennt.“
„Ach, ich sehe das nicht so schlimm.“
Oma schaut erschrocken auf.
„Schlimmer finde ich, wenn sie bei Verstand wäre, sich aber nicht mehr bewegen könnte. Ich glaube, das wäre nicht auszuhalten. Doch so weiß sie nicht, dass sie nichts weiß und kennt keinen Kummer.“
Oder doch? Immerhin wirkte sie traurig, als sie von diesem Mario sprach.
„Oma, weißt du, wer Mario ist?“
Sie antwortet nicht. Wenn sie etwas nicht hören will, überhört sie es einfach. Ich glaube nicht, dass sie meine Frage nicht gehört hat.
Trotzdem wiederhole ich sie.
„Oma, ich habe dich gefragt, wer Mario ist.“
„Nein, ich kenne keinen Mario. Nein! Und nochmals nein!“
„Also kennst du ihn“, stelle ich ungerührt fest. Denn eine derart heftige Reaktion kann nur bedeuten, dass Oma sehr wohl weiß, wer Mario ist.
„Ist er mein Vater?“
„Wie kommst du darauf?“
„Nun, ich weiß, dass Vater nicht mein Vater ist und Mutter heute von Mario gesprochen hat.“
„Du weißt gar nichts.“
„Deshalb frage ich dich.“
„Du wirst mit deinen Fragen aufhören. Ein für alle Mal! Das ist ungehörig. Merk´ dir das!“ Sie schaut mich streng an.
„Ich habe ein Recht darauf“, beharre ich.
„Was faselst du von Rechten? Das fehlte noch!“
„Ich muss es wissen!“, schreie ich.
„Du musst gehen! Und zwar sofort.“
Oma wendet sich demonstrativ ihrem Strickzeug zu. Sie schaut nicht auf, winkt nur mit der Hand ab, als ich sie umarmen will.
Heiße ich Marion, weil Mario mein Erzeuger ist? Ich mochte meinen Namen nie, er wirkt so altmodisch. Mario klingt moderner, fast ein wenig italienisch. Ist mein Vater Italiener? Das wäre direkt fatal, nicht auszudenken, wenn meiner Mutter die gleiche dumme und furchtbare Geschichte passierte wie mir.
Ich muss plötzlich lachen. Mich schüttelt es regelrecht und ich kreische hysterisch auf.
„Ist Ihnen nicht gut?“, fragt ein älterer Herr, der mir entgegen kommt.
Ich kann nicht antworten, winke nur ab und kichere weiter, bis mir die Tränen kommen. Als ich mich umschaue, finde ich mich im Park wieder. Hier habe ich als Kind oft gespielt und später mit Lorenzo auf einer Bank gesessen. Ich finde die Bank, setze mich und gebe mich meinen Erinnerungen hin.
2002 - Lorenzo
Mit gerade siebzehn Jahren jobbte ich während der Sommerferien in einer italienischen Eisbar. Ich war die einzige Deutsche bis auf Karla, die regelmäßig in der „toten“ Stunde kam und mit Stefano im Lager verschwand. Das konnte ich nie verstehen. Wie kann man sich zu Sex zwischen Regalen voller Vorratsdosen und Hygieneartikeln herablassen? Außerdem war Stefano verheiratet. Es käme für mich niemals in Frage, mich mit einem Mann einzulassen, der bereits vergeben ist und obendrein Kinder hat.
Anfangs gingen mir die aufdringlichen Sprüche der italienischen Kellner furchtbar auf die Nerven.
„Seniorita, isch mache disch glügglisch.“
„Komm, Bella, isch zeige Liebe.“
Wahrscheinlich sollten das Komplimente sein, doch ich war empört über solch eine Unverfrorenheit. Der Erste, der mich derart beleidigte, bekam sofort eine Ohrfeige.
Erst hinterher wurde mir klar, dass mich der Chef hätte feuern können, bevor mein erster Tag richtig begonnen hatte. Doch alle lachten nur, hörten aber nicht mit ihren primitiven Sprüchen auf. Vor der Kundschaft riefen sie mir Bemerkungen auf italienisch zu, vielleicht, weil ich dann ihre Anzüglichkeiten nicht verstand oder die Leute mich für eine Italienerin halten sollten. Ich sah wegen meiner schwarzen Locken ohnehin nicht wie eine Deutsche aus.
Später versuchte ich, die primitiven Sprüche zu überhören, daran gewöhnen konnte ich mich nie.
Nur Lorenzo beteiligte sich nicht an den seltsamen Späßen seiner Kollegen. Er war nicht viel größer als ich und recht stämmig. Mir gefiel, dass er im Gegensatz zu den anderen Kellnern nie fehlte. Und ich genoss es, wenn er mich beschützen wollte.
„Das ist meine Freundin!“, verkündete er.
Es dauerte nicht lange und alle glaubten, ich sei tatsächlich Lorenzos Freundin. Irgendwann glaubte ich es selbst.
Lorenzo brachte mich jeden Abend nach Hause und verabschiedete sich höflich an der Haustür.
Eines Nachts zog er mich an meinem Haus vorbei und führte mich zum Park. Dort saßen wir lange schweigend auf einer Bank, während Lorenzo meine Hand fest umklammerte.
„Ich laufe nicht weg“, sagte ich und lächelte ihn an.
Er lächelte zurück. Dann wurde sein Gesicht ganz ernst und ich fragte mich schon, ob ich etwas falsch gemacht hatte. Da nahm er seine Hand von meiner und streichelte langsam über mein Haar. Er fasste in meine Locken, zog mich näher, drückte mich gegen seine Brust, schob mich plötzlich zurück und küsste mich heftig auf den Mund. Im ersten Moment wollte ich ihn zurück schieben, doch mir war auf einmal schwach und taumelig zumute. Ich musste mich an ihm festhalten. Meine Beine zitterten, obwohl mir gar nicht kalt war, eher viel zu heiß.
„Marion, ich habe mich in dich verliebt und möchte immer bei dir sein.“
Ich konnte nur leicht mit dem Kopf nicken. Millionen bunte Sterne kreisten in meinem Hirn, mein Herz schlug, als wollte es aus der Brust springen. Durch meinen Körper kribbelte es in Wellen. So etwas hatte ich noch nie vorher gefühlt und ich klammerte mich völlig irritiert an Lorenzo fest.
Von diesem Abend an waren wir ein Paar. Ich liebte ihn von ganzem Herzen, seine fürsorgliche Art, seine Zärtlichkeiten und seinen Sanftmut. Er schien mir der treueste und zuverlässigste Mann überhaupt.
Bis zu dem Tag, an dem er nach Italien reiste, nach Hause zu seiner Familie. Er küsste mich zärtlich auf den Mund zum Abschied, ganz sacht. Ich winkte ihm noch nach, als er längst nicht mehr zu sehen war.