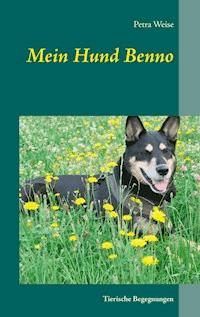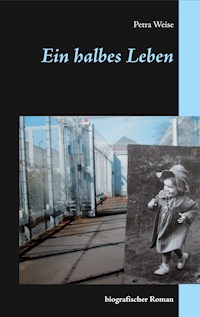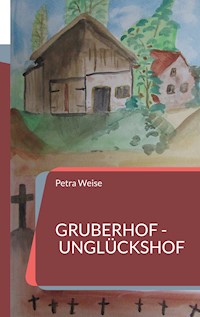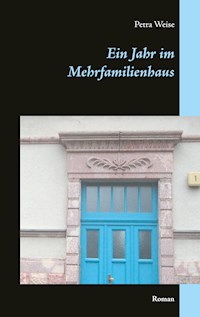Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Anja hat das Leben in Leipzig satt, auch ihren Mann, der Events organisiert und nie Zeit für sie hat. Sie sucht Ruhe im Erzgebirge. Aber sie versteht die Menschen nicht, weder ihren seltsamen Dialekt noch deren Heimatliebe und Einstellung zum Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Menschen zu finden, die mit uns fühlen und empfinden, sind wohl das schönste Glück auf Erden.
Carl Spitteler
Inhalt
Umzug
Katrin
Garten
Grillfest
Flüchtlinge
Holger
Mutter
Tagebücher
Auftritt
Holger
Gerdi
Holger
Mandy
Leipzig
Schluss
Umzug
„Du wirst dich zu Tode langweilen“, prophezeit mir mein Mann. „Du wirst unglücklich werden in diesem Kaff! Aber du hast es so gewollt.“
Ja, ich habe es so gewollt! Ich will nicht mehr in Leipzig leben, sondern in einem winzigen Dorf im Erzgebirge. Dort erhoffe ich mir Ruhe und Abstand vom Großstadtlärm und dem Stress in der Schule. Ein ganzes Jahr lang habe ich nach einem kleinen Häuschen auf dem Land gesucht und fand es in der Nähe von Schneeberg. Sein Grundriss hat nur vierzig Quadratmeter, im Erdgeschoss einen Vorraum für Schuhe und die Garderobe, ein Klo und die Stube mit einer Küchenzeile. Ich habe Platz für einen Esstisch mit vier Stühlen, einen Schrank, ein kleines Sofa, einen Sessel und den Fernseher. Das einzige, was mir nicht gefällt, ist die steile Holztreppe mitten im Wohnzimmer, die hinauf in die Schlafstube und ins Bad führt. Ich werde ein Paravent in den Raum stellen, damit ich die Treppe nicht ständig sehen muss.
Das Haus liegt direkt am Waldrand, etwas erhöht, so dass ich das gesamte Dorf überblicken kann. Es ist ein sehr kleines Dorf mit nur 217 Einwohnern. Das gefällt mir. So habe ich mit Sicherheit meine Ruhe, die ich mir schon so lange wünsche. Ich will Zeit für mich, ganz für mich. Keine Kulturveranstaltungen mehr.
Im Gebirge werde ich genau das finden. Niemand wird mich nerven. Ich wohne abseits vom Ort und habe nur ein einziges Haus in der Nachbarschaft.
Dass es im Dorf keinen einzigen Laden gibt, stört mich nicht, denn mit meinem Auto fahre ich keine zehn Minuten hinunter nach Schneeberg, wo ich einkaufen und als Lehrerin arbeiten werde.
Schneeberg – schon der Name klingt wie Musik in meinen Ohren. Ich habe gehört, dass es hier im Winter tatsächlich Schnee gibt, was ich aus Leipzig nicht kenne. Wenn es in Leipzig schneit, hat man nassgrauen Matsch auf den Fußwegen und Straßen. Richtig weißer Schnee deckt das Unschöne zu und lässt alles wunderbar leuchten, besonders, wenn die Sonne scheint. Erlebt habe ich solch eine bezaubernde Situation noch nicht, weil ich den Winter mit seiner Kälte und den kurzen dunklen Tagen überhaupt nicht mag. Trotzdem beschloss ich vor zwei Jahren, mir ein Haus und eine Arbeit im Erzgebirge zu suchen, um Ruhe und Zeit für mich zu finden.
Ich bin in Leipzig geboren und im Plattenbau in Grünau aufgewachsen. Wir hatten ein Bad, einen Balkon und sogar Fernheizung. Das beste für mich war ein eigenes Zimmer. Mir gefiel es dort. Es gab viel Grün in unserem Viertel und die Schule war nicht weit. Leider fiel mein Schulabschluss genau in die Wendezeit, in der es ein furchtbares Durcheinander gab, weil umfassende Veränderungen im Bildungssystem nötig waren. Trotzdem fand ich an der Pädagogischen Hochschule in Halle einen Studienplatz und war vier Jahre später Diplomlehrerin für Mathematik und Physik. Ständig gab es Reformen, Wechsel der Dozenten und oft kein Lehrmaterial. Es war eine spannende Zeit.
Heute benötigt man ein Abitur für das Lehrerstudium und nennt sich Bachelor bzw. Master of Education. Das klingt natürlich besser als nur Diplom, ist aber im Grunde nur ein anderes Wort für die gleiche Sache.
Eigentlich fand ich unser Schulsystem in der DDR ganz in Ordnung. Andererseits ist es wichtig, dass sich unser Bildungssystem international anpasst.
Ich mag Leipzig, Leibzsch auf Sächsisch. Die Stadt ist schöner als Paris. Man kann hier wunderbar leben, einkaufen, essen gehen. Aber ich habe genug von all den Festivals und Events. Ich will nur noch meine Ruhe. Auch vor meinem Mann, diesem Hektiker. Bertram entwickelt und organisiert Kulturveranstaltungen, plant den Ablauf, verhandelt mit Künstlern und Sponsoren und holt Angebote ein. Er ist ständig mit irgendwelchen Leuten unterwegs. Wenn er daheim ist, hängt er am Telefon. Mit mir spricht er ausschließlich über seine Veranstaltungen und Probleme, die Künstler standesgemäß in Hotels unterzubringen und ihnen das Essen zu besorgen, worauf sie Appetit haben. Austern zum Beispiel. Wie kann man in Leipzig auf die Idee kommen, Austern essen zu wollen? Jemand, der lebende Austern schlürft, ekelt sich wahrscheinlich vor gar nichts.
„Du machst dich lächerlich, wenn du jedem Dahergelaufenen seine Wünsche erfüllst“, schimpfe ich.
Das sieht Bertram natürlich anders. Er will, dass sich die Künstler wohl fühlen. Ich will, dass er will, dass ich mich wohl fühle.
„Worüber regst du dich auf? Dir geht es doch gut.“
Natürlich geht es mir gut. Ich habe satt zu essen, eine gute Arbeit und den Schrank voller Kleider. Doch ich habe keinen Mann, der Zeit für mich hat.
Bertram hasst es, wenn ich ihn etwas frage und ich hasse es, wenn er nicht antwortet. Ich weiß nie, ob er meine Frage überhaupt verstanden hat und nun über eine Antwort nachdenkt. Oder denkt er an Austern, eine Sängerin oder an seine Füße? Oder denkt er an gar nichts? Wohnt er nur? Es heißt ja, dass Männer auf dem Sofa sitzen und dabei an gar nichts denken. Für mich ist das nicht vorstellbar. Ich denke immer und man sieht mir an, ob ich mich freue oder ärgere oder einfach nur zufrieden bin. Bertrams Miene dagegen ist immer gleich, kein Stirnrunzeln, kein Aufblitzen der Augen, kein Zucken der Mundwinkel. Nichts. Hört er mir zu? Nimmt er mich überhaupt wahr? Ich weiß es nicht, weil er es nicht sagt. So will ich nicht mehr leben. Ich brauche diesen Ortswechsel, sonst werde ich verrückt.
Ich mag Bertram, aber ich sehe ihn kaum und weiß gar nicht mehr, ob er noch der ist, den ich zu kennen glaube. Daheim ist er mürrisch und verschlossen, doch am Telefon säuselt und wispert er mit verstellter Stimme und schmeichelt derart übertrieben, dass mir schon vom Zuhören übel wird. Merken die Leute nicht, wie falsch er klingt?
Unsere Liebe ist zur Gewohnheit geworden, was nicht der schlechteste Grund für eine Beziehung ist. Wir leben zusammen oder nebeneinander her wie langjährige Freunde, die zufällig unter demselben Dach wohnen.
Anfangs begleitete ich ihn auf seinen Events. Doch er hatte keine Zeit für mich, sondern eilte zwischen den Künstlern und Besuchern umher. Mir schien, es waren immer die gleichen Veranstaltungen mit immer den gleichen Leuten. Das stimmt natürlich nicht. Aber ich erkannte ihre Interessen schon an der Kleidung. Zu Vernissagen erschienen sie in langen Mänteln und Schals, zu Vorträgen über das Klima in Schlabberlock, mit Schmuck behangen und tiefen Dekolletés zu Modeschauen, ganz in Schwarz bei Punkrock und zu Indie-Events Kleidung vom Flohmarkt. Im Anzug und Kostüm zu Klassik, bunt und fein zu Schlager, Wallekleider zur Buchmesse und vieles mehr. Mich haben die immer gleichen Gespräche schnell gelangweilt. Man gibt sich freundlich und spottet hinter dem Rücken.
Bertram muss immer ein Jackett tragen, um würdevoll auszusehen und eine gute Figur zu machen.
In Pulli und Jeans wirkt er nie lässig, sondern gewöhnlich. Bei mir ist es umgekehrt: Ich kann feine Kleider ebenso tragen wie Jeans und flache Schuhe und wirke dabei immer sportlich elegant. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil ich so schlank und groß bin.
*****
„Was willst du in der Einöde machen?“, fragt Bertram und schaut in ein Buch, als rede er gar nicht mit mir.
Man sieht seinem Gesprächspartner in die Augen.
Immer. Deshalb antworte ich nicht. Außerdem weiß er, dass ich in Schneeberg als Lehrerin arbeite wie in Leipzig auch.
„Kein Mensch geht freiwillig aufs Land, die Leute dort sind einfältig“, bemerkt er wie nebenbei und stellt das Buch zurück ins Regal.
Es mag sein, dass die Leute arglos sind, doch sicher nicht dümmer als anderswo.
„Du wirst das Theater vermissen, die Vernissagen, die Konzerte.“
Endlich schaut er mich an. Hundert Male habe ich ihm gesagt, dass mir genau diese Veranstaltungen auf die Nerven gehen.
„Ganz sicher nicht“, gebe ich patzig zurück. Ich spüre, wie meine Wangen heiß werden. „Sollte ich doch einmal Lust auf Kultur verspüren, gibt es in Schneeberg die Goldene Sonne.“
Im gleichen Moment ist mir klar, dass ich etwas Dummes gesagt habe, doch im Zorn kann ich nicht klar denken. Bertram muss nicht viel sagen, um mich wütend zu machen, manchmal reicht schon sein Blick.
„Goldene Sonne?“ Bertram lacht gehässig. „Das passt!“ „So heißt das Schneeberger Kulturzentrum.“
Bertram lacht lauter.
„Kultur?“ Er verzieht spöttisch seinen Mund. „Engel und Nussknacker schnitzen, klöppeln, Zither spielen und Volkslieder singen. Das nennen die Kultur.
Ich nenne es altbacken, zurückgeblieben.“
Damit trifft Bertram meinen wunden Punkt. Ich mag keine Heimatlieder, nicht einmal zu Weihnachten.
Im Erzgebirge hält man an längst überholten Traditionen fest, im Kulturzentrum werden sogar Klöppelkurse angeboten. Die Leute sind stolz auf ihre Wurzeln und ihre Kultur und sehr heimatverbunden. Heimat. Das ist auch so ein Wort. Kein gutes jedenfalls. Ich weiß nicht, ob ich mich an die alten Bräuche im Gebirge gewöhnen kann. Aber vielleicht muss ich das auch gar nicht.
Ich erhoffe mir in Schneeberg ernsthafte Gespräche über das wirkliche Leben, nicht dieses freundliche Getue wie in Leipzig. Mich interessiert nicht der Klatsch über Künstler, die ich gar nicht kenne.
Mich interessiert der Mensch, der mir gegenüber steht.
Erzgebirger sind laut Google sehr direkt und sagen, was sie denken, ohne um den heißen Brei herumzureden. Ihnen ist die Familie wichtig, auch über die Zeit hinaus, in der die Kinder längst ihr Nest verlassen haben.
In meiner Familie geht jeder seinen eigenen Weg.
Bertram hat seine Arbeit, die Kinder ihr Studium.
Mathias studiert Ökologie und Umweltplanung in Berlin und Vanessa Sozialwissenschaften in Jena.
„Sozialwissenschaften kannst du auch hier in Leipzig studieren“, habe ich zu Vanessa gesagt.
Da zog sie ihre Brauen zusammen und fauchte: „Was soll ich hier? Du bist doch froh, wenn du mich los bist.“
„Wie kommst du darauf?“
„Du hast mich nie geliebt, jedenfalls nicht so wie Mathias.“
„Du wolltest immer deine Ruhe, hast dich verkrochen.“
„Warum wohl?“
„Ich verstehe dich“, versuchte ich, ihren Zorn zu mildern. „Ich war wie du.“
„Du? Du kannst gar nicht so wie ich gewesen sein, weil du du warst und nicht ich. Du verstehst mich nicht, weil du mich nicht verstehen willst.“
„Vanessa!“, mahnte ich streng.
Aber sie war schon aus dem Raum gegangen und hatte die Tür heftig hinter sich zugeschlagen. Wieder hatte ich alles falsch gemacht. Alle Mütter machen alles falsch.
Beide Kinder wollten so schnell und so weit wie möglich weg von den Eltern und endlich frei leben.
Unter einem freien Leben verstehen sie, dass sie machen können, wozu sie Lust haben. Feiern zum Beispiel. Sie leben in den Tag hinein und verschwenden keinen Gedanken an morgen. Doch unabhängig sind sie nicht, denn wir überweisen ihnen monatlich einen Beitrag zu ihrem Leben und zahlen die Miete. Immerhin habe ich jetzt weniger Verantwortung, seit sie aus dem Haus sind. Die Kinder sind keine Kinder mehr, natürlich meine Kinder, aber eben erwachsen. Sie sind für sich und ihr Tun verantwortlich, erwarten aber ganz selbstverständlich die finanzielle Unterstützung ihrer Eltern. Das Studium nehmen sie locker, wichtiger ist ihnen Geld für ihre Freizeit, dafür gehen sie sogar kellnern.
So ist das heute. Heiraten wollen sie nicht. Vermutlich halten sie die Ehe für eine Art Gefängnis, eine Strafe mit Androhung auf lebenslänglich.
„Die Ehe ist wie unsere Gesellschaft: ausbeuterisch und heuchlerisch“, behauptet Vanessa.
„Wer beutet hier wen aus?“, habe ich gefragt, aber statt eine Antwort nur ein spöttisches Schulterzucken erhalten.
Beide wollen sich nach dem Studium die Welt ansehen. Mathias will in die USA und Vanessa nach Australien. Was wollen sie dort machen? Ich weiß es nicht und sie werden es auch nicht wissen.
Doch im Grunde müssen sie es selbst entscheiden, denn ändern kann ich nun nichts mehr.
Seit die Kinder nicht mehr im Haus sind, ist es ruhiger und angenehmer daheim. Ich liebe sie beide, aber sie sind oft schwer auszuhalten. Mathias mit seinem überlauten Gelächter in den unpassendsten Momenten und Vanessa mit ihrer stets vorwurfsvollen Miene, weil ich ihrer Meinung nach altmodisch und damit schrecklich peinlich bin. Beide sind empfindlich und nahezu dauernd gekränkt. Ich lasse sie weitestgehend in Ruhe, weil jede kleine Diskussion in Beleidigungen ausartet. Ich bin froh, dass sie nun ihre eigenen Wege gehen.
Ich wollte immer eine gute Lehrerin sein und machte alles genau so, wie ich es im Studium lernte. Doch im Laufe der Jahre merkte ich, dass sich die natürliche Veranlagung der Kinder auch nicht mit studierter Pädagogik verändern lässt. Deshalb beschränke ich mich auf das Vermitteln von Wissen. Wer nicht aufpasst, ist selbst schuld, wenn er etwas nicht begreift. Das ist nicht mein Problem.
Daheim erwartete ich immer Gehorsam und Einsicht in die Notwendigkeit. Die Freizeit durften die Kinder nach Gutdünken gestalten. Mathias spielte lieber Fußball als Klavier und Vanessa wollte Hiphop statt Ballett tanzen. Sie nervte mich den lieben langen Tag mit ihrem Warum. Als sie eines Tages damit aufhörte, wusste ich, dass sie nun erwachsen ist und endlich ihren Weg gehen würde.
*****
Im Moment sind Schulferien. Ich habe also volle sechs Wochen Zeit, meinen Umzug vorzubereiten, mich im neuen Haus einzurichten und die Nachbarn kennenzulernen. Das wird nicht einfach sein, denn ich verstehe den erzgebirgischen Dialekt nicht. Ich hatte deshalb meine liebe Not mit den Handwerkern.
„Dor Glemndnor muss de Gschärrschbilor richdn.“
„Wie bitte?“
Der Klempner muss den Geschirrspüler anschließen.
„Brauchst a neis Kallrfanstr.“
Ehe mir klar wurde, dass ich ein neues Kellerfenster brauche, hatte es der Handwerker bereits eingesetzt. Ich habe keinen richtigen Keller, nur einen Raum, den man von außen begeht und in dem die Heizungsanlage steht. Früher stand dort ein Regal, in dem Kartoffeln, Obst, Gemüse, Einweckgläser und selbstgemachte Liköre gelagert wurden. Das brauche ich nicht.
Ich brauche auch keinen Kamin, den mir der Handwerker bauen wollte, weil ich diese Dinger scheußlich, schmutzig und unpraktisch finde. Ich bin froh, dass ich keinen Ofen wie anno dazumal anfeuern muss, sondern eine neue und saubere Heizung habe.
Ich werde in Schneeberg verkürzt arbeiten, was mir in Leipzig nicht gestattet war. Bertram spottet, dass Lehrer ohnehin nur wenige Stunden am Tag arbeiten. Dabei habe ich an vier Tagen jeweils fünf Schulstunden pro Woche. Das weiß er. Außerdem ist viel Arbeit rund um den direkten Unterricht nötig wie das Vorbereiten und Bewerten der Kontrollarbeiten.
„Alles gut?“, fragt er manchmal und erwartet nichts weiter als ein zustimmendes Nicken von mir.
Mein Schulalltag langweilt ihn, während mich die Berichte über seine Veranstaltungen immer interessierten, zumindest am Anfang. Doch weil er ohne Pause erzählt und ich keine Zwischenfragen stellen kann, höre ich nur noch halb hin.
„Vielleicht besuche ich dich mal. Wer weiß?“ Bertram lächelt mich mit zusammengekniffenen Augen an. „Aber eher wirst du deine Wochenenden hier in Leipzig verbringen, wo sich das Leben abspielt.
Drei Monate gebe ich dir, dann bist du wieder hier.“
Kennt er mich so schlecht? Außerdem habe ich einen Vertrag über zehn Monate und kann nicht mitten im Schuljahr weglaufen.
Bertram interessiert sich im Gegensatz zu mir nicht für Politik. Er wäre in jedem Land der Welt glücklich, wo er Veranstaltungen organisieren könnte.
Am liebsten wäre er nach Amerika gegangen und hatte bereits entsprechende Kontakte geknüpft.
Doch was sollte ich in den USA arbeiten? Zwar ist das Schulsystem mit dem in der DDR vergleichbar, weil die Kinder nicht wie hierzulande in Haupt-, Realschule und Gymnasium getrennt werden, sondern bis zum Abschluss der Highschool zusammen bleiben. Aber ich will nicht weg aus Deutschland.
Leipzig ist meine Heimat und hoffentlich bald auch Schneeberg.
Warum ich Bertram heiratete, weiß ich noch ganz genau. Er hat mich beeindruckt und nicht nur mich, sondern alle meine Freundinnen. Er sah blendend aus und kannte unglaublich viele interessante Leute, sogar Rockstars, schenkte mir Freikarten für Konzerte und Kinofilme. Der Neid meiner Freundinnen und das Entzücken meiner Mutter trieben mich in diese Ehe. Ich war stolz darauf, von einem Mann, der alle begeisterte, begehrt zu werden. Ich bewunderte ihn und seine Kontakte, aber heute weiß ich, dass ich ihn nie wirklich liebte. Heute ist mir peinlich, dass ich damals nur auf Äußerlichkeiten achtete. Seit die Kinder aus dem Haus sind, habe ich keinen praktischen Grund mehr, an dieser Ehe festzuhalten. Ich habe auch keinen Grund, sie zu beenden. Deshalb ist es gut, dass ich ins Erzgebirge gehe und Bertram in Leipzig bleibt. Für ein Schuljahr bin ich fest eingestellt. Danach sehen wir weiter.
„Am Dienstag kommt der Möbelwagen.“
„Dienstag habe ich keine Zeit.“
Entsetzt sehe ich Bertram an.
„Du hast versprochen, mir zu helfen.“
„Nichts anderes habe ich wochenlang getan. Ich habe Kisten für deine Bücher besorgt und was weiß ich nicht alles. Ich schicke dir meine zwei Praktikanten, die Hauptarbeit machen sowieso die Möbelpacker.“
Bertram will nicht dabei sein, wenn ich ausziehe, weil er Wichtigeres zu tun hat. Enttäuscht wende ich mich ab.
„Du hast Recht, die Arbeit übernehmen die Möbelpacker, dafür sind sie schließlich da. Deine Praktikanten brauche ich nicht“, gebe ich zurück und hoffe, nicht beleidigt zu klingen.
Viel nehme ich nicht mit, nur das Bett aus dem Gästezimmer, meinen Schreibtisch und die Kisten mit Geschirr, Büchern und Kleidern. Tisch, Stühle, Schränke und den Sessel liefert das Möbelhaus vor Ort. Die Küchenzeile ist bereits im Haus.
„Vielleicht schenke ich dir zum Geburtstag ein Ehebett und mich dazu für eine ganze Nacht.“
Ich lächle, obwohl das Ehebett immer ein Streitgespräch zwischen uns war. Bertram glaubt, ich will ihn in meinem Häuschen nicht sehen. Doch das stimmt nicht. Ich will nur allein dort leben. In der Schlafstube wäre zwar Platz für ein Ehebett, aber es würde den kleinen Raum zu stark dominieren. Neben dem schmalen Gästebett wirkt der Schreibtisch unter dem Dachfenster großzügiger, nicht so gequetscht.
Heute Abend feiern wir meinen Abschied mit drei befreundeten Paaren. Keiner meiner Freunde hat mich und meine Pläne ernst genommen.
Ich habe nur einen kleinen Imbiss vorbereitet, eine scharfe Gulaschsuppe, überbackene Brötchen mit einer Masse aus Schinkenwürfeln, geriebenem Käse und Sauerrahm. Geschmeckt hat es, aber es war eine schreckliche Kleckerei, weil die fettigen Würfel auf die Kleider und den Boden rutschten.
Dazu Rotwein.
„Hier habe ich eine besondere Überraschung!“, ruft Bertram aus und hält eine große eckige Flasche in die Luft. „Das ist ukrainischer Wodka.“
„Wodka? Aber der ist braun wie Weinbrand.“
„Probieren! Anja, hole die Gläser!“ Feierlich füllt Bertram acht Schnapsgläser.
„Das Zeug war teuer. Es wird mit echtem ukrainischem Waldhonig und Pfefferschoten aromatisiert“, erklärt Bertram.
„Ah! Daher die bräunliche Farbe.“
„Ich möchte mit diesem besonderen Wodka auf Anja und ihren neuen Lebensabschnitt im Gebirge anstoßen.“
Andächtig heben wir die Gläser und alle prosten mir zu. Ich mag Wodka wie überhaupt alles Klare, aber diesen Wodka kann man nicht trinken. Er schmeckt wie modrige Kekse. Auch meine Freunde leeren ihr Glas nicht.
„Grässlich!“, schimpft Bertram, nimmt die Flasche und schüttet den Inhalt in die Gosse.
„Bist du verrückt?“, schreit meine Freundin auf.
„Man kann ihn mit Beeren ansetzen, das wird ein Superlikör.“
„Kann man, muss man aber nicht“, brummt Bertram, geht zum Kühlschrank und holt eine neue Flasche Wodka heraus, dieses Mal einen klaren.
„Auf deine Zeit im Gebirge, die hoffentlich nicht allzu lange dauert!“, prostet mir jemand zu.
„Dort gibt es nur zwei Jahreszeiten: Winter und strenger Winter!“ „Du wirst dich zu Tode langweilen!“ Wir werden sehen. Ich bin zwar kein Naturmensch und sehe keinen Sinn darin, durch den Wald zu spazieren, wo man nur Bäume und wieder Bäume sieht, doch ich werde zur Ruhe kommen. Davon bin ich überzeugt. Wenn ich es nicht versuche, werde ich es nie herausfinden. Ich lächle. Der gutmütige Spott von Bertram und unseren Freunden berührt mich nicht, weil er nichts ändern wird. Mein Entschluss steht fest, das Haus ist eingerichtet und ab morgen lebe ich im Erzgebirge.
*****
Einige unserer Freunde meinen, Bertram und ich passen überhaupt nicht zusammen, andere meinen, wir sind uns direkt ähnlich. Ich sehe keinerlei Ähnlichkeit zwischen mir und Bertram. Er ist groß, kräftig, hat dunkle Haut und Haare, starke Brauen und einen schmalen Mund. Und er ist sehr laut. Ich bin genau das Gegenteil: klein und zierlich, blasse Haut, hellbraune Haare und wasserblaue Augen.
Laut werde ich nie, nicht im Zorn und auch nicht in der Schule. Wenn Bertram einen Raum betritt, drehen sich alle nach ihm um. Ich bin eher unauffällig.
Ich hatte schon früher nie geglänzt oder hervorgestochen, war nie besonders beliebt und daher auch nie tief in Ungnade gefallen. Ich war so unauffällig wie möglich und bin damit immer gut gefahren. Im Gegensatz zu Bertram bin ich kein genial guter Redner, aber ein guter Zuhörer.
Katrin
Mir gefällt mein kleines Häuschen. Zwar sind die Fenster recht klein, aber ich habe alle Wände gelb streichen lassen und mir damit die Sonne in alle Räume geholt. Nur die Wand hinter meinem Bett ist Grün. Grün beruhigt und steht für Hoffnung.
Außerdem ist Grün meine Lieblingsfarbe. Endlich stehen alle Möbel an ihrem Platz. Ich bin zufrieden.
Nun fehlen nur noch einige Bilder an den Wänden und Blumen.
Für Pflanzen ist auf den schmalen Fensterbrettern kein Platz, was mich nicht stört, denn ich habe keinen grünen Daumen. Beim Gedanken an Blumen gehe ich auf meine kleine Terrasse, betrachte die Wiese mit den zwei Bäumchen und den Sträuchern am Rand und überlege, ob ich einen Garten anlegen soll. Von Pflanzen verstehe ich nichts, aber schwer kann es nicht sein, ein paar Blumen anzupflanzen. Schließlich gibt es für alle Fragen das Internet.
Gestern bummelte ich durch das kleine Dorf und die Stadt Schneeberg. Dort blieb ich in einer Straße stehen, die von riesigen Bäumen gesäumt ist, die einen mir völlig unbekannten Duft verströmten, der mich fast betäubte. Ich fotografierte den Baum mit meinem Handy und erfuhr über die App, dass es sich um Linden handelt. Ich weiß nicht, ob es in den Leipziger Parks Linden gibt, jedenfalls hat mich dieser betörende Duft direkt berauscht.
Erfreut über diese wunderbare Gegend in völliger Abgeschiedenheit breite ich meine Arme aus. Hier kann ich endlich meine Ruhe genießen.
„Is wer drhamm?“
Der Ruf kommt aus dem Haus! Jemand Fremdes ist in mein Haus eingedrungen! Eilig laufe ich zurück und stehe vor einer jungen schönen Frau mit hüftlangen schwarzen Haaren. Sie hält in der einen Hand eine Flasche Sekt und in der anderen eine Schale voller Kekse.
„Was machen Sie in meinem Haus?“, fauche ich.
Sie zuckt mit der Schulter, lächelt und hält mir die Keksschale entgegen.
„Neibackn.“ (frisch gebacken) „Nahmd!“ „Guten Abend.“
„Bin de Gaddrien. Do wuhn i.“
Sie nickt mit dem Kopf Richtung Nachbarhaus und ist also meine Nachbarin. Gaddrien. Ich brauche einen Moment, um zu verstehen, dass damit Katrin gemeint ist, obwohl in Leipzig auch sächsisch gesprochen wird. Sächsisch stört mich gar nicht, es ist meine Muttersprache. Aber der erzgebirgische Dialekt unterscheidet sich gravierend vom Sächsischen. Gleich am ersten Tag erklärte man mir sehr deutlich: „Arzgebargsch is ka Sächssch.“ (Erzgebirgisch ist kein Sächsisch). Erzgebirgisch sei auch kein Dialekt, sondern eine ganz eigene Sprache.
„Wie kommen Sie in meine Wohnung?“, frage ich empört.
„De Diere wor uff, musst besser zusperrn, itze labt Gesocksch do.“
„Wie bitte?“
Katrin lacht. Ich lache nicht, weil ich nicht mag, wenn mich wildfremde Leute duzen. Außerdem verstehe ich ihren Dialekt nicht.
Sie reißt ihren Mund weit auf und wiederholt ihren Satz auf Hochdeutsch, wobei sie jede Silbe überdeutlich betont: „Die Tür war offen, du musst immer abschließen, weil sich in der Gegend üble Leute herumtreiben.“
„Verstehe. Und was wollen Sie hier?“
„De Leit? San Fremde, Geflichdede. Un no emol deitsch fier feine Leit: Flüchtlinge.“
Hier gibt es also Flüchtlinge, vor denen ich mich in Acht nehmen soll. Diese Warnung halte ich für unverschämt. Es sind Menschen wie ich, die unsere Hilfe brauchen, weil ihre Lebenssituation in ihrer Heimat ausweglos ist.
„Ich meinte nicht die Flüchtlinge“, gebe ich kühl zurück. „Ich meinte Sie!“ Dabei zeige ich auf ihre Brust. „Was wollen Sie hier?“
Verdutzt schaut sie mich an.
„Ahsu! Auf gute Nachbarschaft anstoßen will ich.
Host en Glos?“
Katrin wedelt mit der Sektflasche. Das finde ich jetzt ziemlich frech. Am liebsten würde ich sagen, dass ich selbstverständlich Gläser habe, aber keine Lust auf ihre Gesellschaft. Aber ich kann mich beherrschen und rolle nicht einmal genervt mit den Augen. Etwas unwillig hole ich zwei Sektgläser, stelle sie neben die Keksschale auf den Tisch und zeige mit der Hand auf den Stuhl. Katrin setzt sich sofort und gießt beide Gläser voll.
„Mein Name ist Fritzsche.“
„Fritsche. Un weidor? Dodofur?“ Plötzlich lacht sie und fragt ganz deutlich: „Wie ist dein Vorname?“
Ich glaube, diese Frau versteht nicht, dass ich es nicht mag, wenn man mich duzt. Aber ich weiß nicht, wie ich sie loswerde, jetzt, da sie bequem auf meinem Stuhl sitzt, mir zuprostet und sich ungeniert umschaut.
„Hübsch hast es hier. Und?“
Ich weiß nicht, worauf sie wartet.
Ich erhebe mein Glas und sage: „Auf gute Nachbarschaft.“
Wirklich daran glauben kann ich nicht. Die junge Frau mag keine Flüchtlinge und kennt keine privaten Grenzen. Damit ist sie bei mir an der falschen Adresse. Es mag sein, dass das so ist hier oben im Gebirge, aber ich bin nicht gewillt, mich daran zu gewöhnen.
„Und?“,wiederholt Katrin. „Wie heesde, wu kummsde her, was machsde so?“
Diese Fragen verstehe ich, schließlich bin ich Sachse. Katrin will wissen, wie ich heiße, wo ich herkomme und was ich hier mache. Neugier in Butter gebraten, würde meine Mutter jetzt sagen.
Mir behagt das nicht, aber ich bin selbst schuld, weil ich meine Tür nicht abgeschlossen habe.
Darauf werde ich künftig besser achten. Aber nicht wegen der Flüchtlinge, sondern wegen dieser zudringlichen Nachbarin. Doch irgendwann hätte ich die Nachbarn sowieso kennenlernen müssen, also warum nicht gleich heute. Dann habe ich es hinter mir.
„Anja.“ Ich räuspere mich. Jetzt oder nie ist die Gelegenheit, meinen Namen aufzubessern. „Mein Vorname lautet Anna. Anna“, wiederhole ich. „Ich wohnte bisher in Leipzig und arbeite ab August als Lehrerin in einer Schule in Schneeberg.“
„Lehrer!“, ruft Katrin aus. „Jedes Jahr vier Monate
Urlaub! Irre!“
„Sie irren sich!“
„Du!“
„Nein, ich irre mich nicht.“
Katrin kichert.
„Du! Wir sind beim Du.“
Ich seufze, weil ich das nicht will, aber die Gepflogenheiten hier nicht kenne und nicht gleich am ersten Tag in sämtliche Fettnäpfchen treten mag.
„Lehrer und Lehrerinnen haben wie jeder andere Angestellte nur dreißig Tage Urlaub pro Jahr.“
„Dreißig Tage?“
Ich nicke.
„Weil ich inzwischen fünfzig bin und viele Dienstjahre habe, stehen mir vierunddreißig Tage zu.“
„Vierunddreißig?“
Wie ein Papagei wiederholt sie meine oder ihre eigenen Worte.
„Jesses! So viel habe ich nicht. Ich bin mit vierundzwanzig gut bedient, das sind vier mehr als der Mindesturlaub.“
Überrascht schaue ich sie an, weil ich nicht glaube, dass jemand nur zwanzig Urlaubstage im Jahr hat.
Gibt es im Gebirge weniger Urlaub als in Leipzig?
Am Ende auch weniger Lohn? Weniger Gehalt als in Leipzig habe ich hier auch, doch das liegt daran, dass ich verkürzt arbeite, die Anzahl der Urlaubstage bleibt gleich.
„Ich weiß, dass viele Leute glauben, Lehrer und Lehrerinnen hätten wie die Schüler und Schülerinnen dreizehn Wochen frei pro Jahr. Aber so ist das nicht. Während der Sommerferien nehmen wir den Großteil unseres Jahresurlaubs.“
Katrin schaut mich skeptisch an und fragt: „Und der Rest?“
„Das ist kein Urlaub. Das ist unterrichtsfreie Zeit.“
„Was wohl auf das Gleiche hinausläuft“, ergänzt sie schnippisch.
„Ganz und gar nicht. Wir müssen diese Zeit für Fortbildung und Unterrichtsvorbereitung nutzen.“
„Alles klar“, lacht Katrin und hebt erneut ihr Glas.
Mir fallen Bertrams Worte ein, der auch immer so herablassend tat, als wäre der Lehrberuf keine wirkliche Arbeit.
„Darauf trinken wir! Die Kekse hat Mutt gebacken.“
„Mut?“
„Mutt ist die Mutter, Vat der Vater, Leit oder Illorn die Eltern.“
In Leipzig sagt man Mutsch oder Muddi oder ganz modern Mom statt Mama, die Eltern sind die Alten.
Die Kekse schmecken hervorragend und ich greife noch einmal zu.
„Welchen Beruf hast du eigentlich?“, erkundige ich mich, obwohl es mich nicht wirklich interessiert.
Doch ich frage lieber, als dass ich mich von Katrin weiter löchern lasse.
„Ich arbeite seit kurzem als Sozialbetreuer.“
„Ah, du bist Krankenpflegerin?“
Katrin runzelt die Stirn.
„Hast du ein Problem mit dem -in?“
Ich zucke mit der Schulter, weil ich nicht weiß, was sie meint.
„Lehrerin, Pflegerin. Bin ich als Frau besser oder schlechter als ein Lehrer und Pfleger?“
„Da ich eine Frau bin, bin ich logischerweise kein Lehrer, sondern eine Lehrerin“, erkläre ich geduldig, obwohl sie das wissen sollte.
„So ein Quatsch!“, tut Katrin meine Erklärung ab.
„Ich bin Erzgebirger und du Leipziger. Das hat allein mit der Region zu tun und nicht mit dem Geschlecht.“
Achten die Leute hier oben im Gebirge nicht auf Gleichberechtigung? Sie leben weitab von modernen neuen Regeln, an die man sich zu halten hat.
Ich erwarte, dass die Kinder in meiner Klasse korrekt gendern, sonst werte ich es als Fehler – wie es sich gehört.
„Es ist wichtig, dass du Wert darauf legst, als Pflegerin oder Betreuerin angesprochen zu werden.“
Katrin verdreht die Augen.
„Warum sollte ich betonen, dass ich eine Frau bin?
Das sieht man doch.“ Sie steht auf, hebt ihre Arme hoch und dreht sich im Kreis. „Für meine Arbeit spielt es keine Rolle, ob ich männlich oder weiblich bin.“
Sie versteht es immer noch nicht.
„Es geht um das Gleichstellungsprinzip“, erkläre ich leicht gereizt.
„Gleichstellung? Ich sehe das genau anders herum, denn durch das -in wird das Geschlecht überbetont und lenkt vom eigentlichen Inhalt ab. Ich pflege und du lehrst, allein das ist wichtig.“
Ich habe keine Lust, ihr zu erklären, wie wichtig das korrekte Gendern ist. Sie versteht es ja doch nicht. In der Schule ist es Pflicht, ebenso in der Öffentlichkeit. Wenn sie sich nicht daran hält, ist es ihr privates Problem.