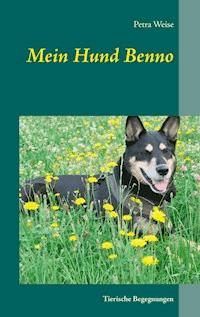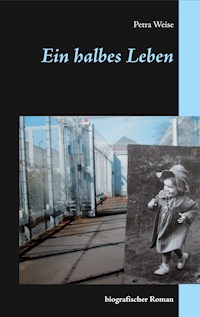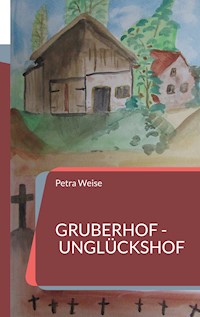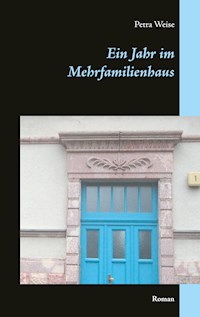4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Johanna lebt mit ihren Eltern und Geschwistern am Ortsrand in einem kleinen Dorf. Vom Vater wird sie übersehen, von der Mutter übermäßig streng erzogen. Trotzdem hält sie ihre Welt für in Ordnung. Erst, als ein Verwandter behauptet, der Vater sei ein Ehebrecher, gerät alles durcheinander: Eine Katastrophe folgt der nächsten und schließlich wird das streng gehütete Familiengeheimnis aufgedeckt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Der Mensch ist der Anfang der Religion, der Mensch ist der Mittelpunkt der Religion, der Mensch ist das Ende der Religion.
Ludwig Feuerbach
Inhalt
Du sollst nicht ...
andere Götter haben neben mir!
meinen Namen missbrauchen!
an Feiertagen arbeiten!
deine Eltern missachten!
töten!
ehebrechen!
stehlen!
lügen!
begehren deines Nächsten Frau!
begehren fremden Besitz!
1. Gebot:
Du sollst nicht andere Götter haben neben mir!
Seit vier Stunden gehen wir. Immer im gleichen Tempo und immer bergauf. Ich hasse dieses Gehen, meine beiden Schwestern auch, doch Mutter treibt uns mit ihrem Blick unerbittlich weiter. Sie schaut nur kurz auf, mahnend!, und gleich wieder weg. Wir wissen genau, was dieser Blick bedeutet und gehen weiter. Schweigend. Wie es sich gehört.
„Herrgott nochmal! Hebe gefälligst die Füße beim Laufen!“, ermahnt mich Mutter.
Doch meine Füße tun weh. Besonders mein linken kleiner Zeh schmerzt entsetzlich bei jedem Schritt. Zusätzlich reibt das harte Leder der „ordentlichen“ Schuhe, denn zur Wallfahrt darf ich meine weichen Sneaker nicht tragen.
„Ich habe ein großes Hühnerauge am Zeh“, jammere ich.
„Du hast kein Hühnerauge, das würdest du merken!“
Ich merke das sehr wohl, doch ich sage nichts mehr.
Trotzdem stößt mir Mutter ihre harten Fingerknöchel in den Rücken und faucht: „Stell dich nicht so an, Johanna!“
Ich mag meinen Namen. Ich mag nur nicht, wie Mutter ihn ausspricht, so hart, dass er wie ein Schimpfwort klingt. Ich mag auch nicht, dass mich alle Anderen Jo rufen. Sie nennen mich Jo, weil ich so dünn bin wie ein zwölfjähriger Junge, obwohl ich bereits sechzehn bin. Nur meine große Schwester Lilli nennt mich Hanni. Sie spricht es englisch aus wie honey.
*****
Lilli heißt eigentlich Elisabeth, doch Elisabeth wird sie nur von Mutter und Michael gerufen. Sie ist ein Jahr älter als ich und beendet in diesem Sommer die Schule. Ab nächsten Monat wohnt sie nicht mehr daheim, sondern in einem Internat weit von unserem Dorf entfernt. Sie will Polizist werden. Ich kann sie mir überhaupt nicht in einer dunklen, furchteinflößenden Uniform vorstellen, weil das ein krasser Unterschied zu ihrer fröhlichen Art ist. Wenn sie lacht, drehen sich sogar Fremde nach ihr um. Mit einem Tuch um Hals und Schulter wirkt sie verspielt elegant. Binde ich mir den gleichen Schal um, fragen die Leute, ob ich Halsweh habe. Lilli bewegt beim Reden den ganzen Körper, gestikuliert mit ihren Händen und zappelt mit den Füßen. Deshalb kann ich sie mir eher als Tanzlehrer oder Kabarettist in bunten Kostümen vorstellen und nicht als strenger, pflichtbewusster Polizist in dunkler Uniform.
Die Uniform stört sie nicht. Sie suchte vor allem nach einer Ausbildung, die so weit weg von daheim ist, dass sie nicht einmal am Wochenende nach Hause kommen kann. Sie ist nicht gern daheim.
Als zweiten Grund nannte sie das hohe Lehrgeld und als dritten die kurze Ausbildungszeit von nur zwei Jahren. Außerdem mag sie Sport sehr gern, worauf beim Eignungstest großen Wert gelegt wurde. Sie hat erfahren, dass in der Polizeischule viel Freizeitsport angeboten wird, was sie kostenlos nutzen kann.
Der letzte und nicht unbedeutende Grund ist, dass es bei der Polizei mehr Männer als Frauen gibt. Lilli mag sportliche Machos. Sie will einen richtigen Kerl, einen, der zupackt und nicht lange redet. Das Reden übernimmt sie lieber selbst.
Ohne Lilli wird mich keiner mehr zum Lachen bringen. Das stimmt mich sofort traurig.
*****
Das ganze Dorf ist unterwegs, nur Vater nicht und auch nicht Lukas, mein Bruder. Sie haben zu tun. Ich weiß, dass das nur eine Ausrede ist und dass weder Vater noch Lukas etwas tun, denn heute ist Sonntag und an Sonntagen arbeitet man nicht. Sie werden beide im Gasthof der Stadt sitzen, Schweinebraten essen und dazu Bier trinken. Vater mag keine religiösen Prozessionen, auch Lilli nicht. Doch sie muss ebenso den beschwerlichen Weg hinauf zur Kapelle gehen wie fast alle Leute aus unserem Ort, die Kinder und die ganz Alten.
Uns drei Schwestern zwingt nicht nur Mutter zu dieser Wallfahrt, sondern vor allem ihr Bruder. Er heißt Michael und ist der Bürgermeister unserer Gemeinde, die aus fünf kleinen Ortschaften besteht. Unsere ist mit weniger als dreihundert Einwohnern die kleinste und es werden immer weniger, weil mehr Leute sterben als geboren werden oder weggehen wollen wie Lilli.
In unserem kleinen Dorf gibt es keinen Laden, keinen Gasthof, keinen Arzt, keine Tankstelle und auch keine Schule. Nur eine Kindergruppe für die ganz Kleinen, die sich im Gemeindehaus befindet. Dort ist auch ein Ausschank, den Michael betreibt, wo sich abends die Männer des Dorfes treffen und Rat halten. Vater sitzt ebenfalls gern in dieser Männerrunde, meist nimmt er Lukas mit, obwohl der erst fünfzehn Jahre alt ist.
Früher war Michael Pfarrer und predigte jeden Sonntag in der Kirche der Stadt. Dort hatte er sein Pfarramtsbüro und seine kleine Wohnung. Die Wohnung und den Predigtstuhl musste er verlassen, als er Bürgermeister wurde.
Trotzdem predigt er jeden Freitag im Gemeinderaum. Er sagt, er sei von Gott zum Predigen bestimmt, weshalb ihm alle Einwohner, die jungen wie die alten, zuhören müssen.
Michael ist Mutters Zwillingsbruder und ebenso streng gläubig wie sie. Beiden sind die Gottesdienste und religiösen Traditionen wichtig, wozu die heutige Wanderung hinauf zur Kapelle gehört.
*****
Ein fremder Mann gesellt sich zu uns und lächelt mich an. Ich lächle nicht zurück, denn er sieht recht furchteinflößend aus mit seinen schwarzen Haaren, dem dichten, dunklen Bart und einer seltsamen Kappe auf dem Kopf, die weder den Käppis der Jungen noch den Hüten der Männer ähnelt.
„Verschwinde!“, zischt Mutter in seine Richtung und zu mir gewandt: „Geh weiter!“
Mit ihren harten Handknöcheln stößt sie mir grob in den Rücken, was mir die Tränen in die Augen treibt. Doch ich gebe keinen Laut von mir und gehe weiter, den Blick zum Boden gerichtet wie es sich gehört.
„Wer ist das, Mama?“, höre ich meine kleine Schwester Pia fragen.
Die Frau vor uns dreht sich um und antwortet: „Das ist Christian. Er ist wieder da.“
„Sei still!“, herrscht Mutter sie an. „Ein Ungläubiger ist er, einer, der in die ewige Verdammnis gehört.“
Pia ergreift erschrocken Mutters Hand. Ich sehe das. Sie darf Mutter nicht nur anfassen, sondern sich sogar auf dem Sofa an sie ankuscheln. Außerdem bekommt sie jeden Abend einen Gute-Nacht-Kuss. So etwas hat es für Lilli und mich nie gegeben, auch nicht für Lukas.
Bei Lilli wundert mich das nicht, denn sie gibt der Mutter Widerworte und weigert sich zu beten. Ich dagegen bete ebenso wie Pia bei Tisch und vor dem Einschlafen. Ich mache alles, was Mutter von mir verlangt. Trotzdem bekomme ich Schläge und werde beschimpft, weil ich so ungeschickt bin. So sehr ich mich auch bemühe, ich mache zu Mutters Ärger immer alles falsch.
Mutter sagt, meine größte Sünde sei, dass ich Pia nicht liebe. Ich liebe Pia sehr wohl und kann mir nicht erklären, weshalb sie meist recht garstig zu mir ist. Sobald sie in meiner Nähe ist, zwickt sie mich in die Arme und lacht dabei. Dann schreit sie, als hätte ich ihr etwas zuleide getan. Anfangs zeigte ich Mutter die blauen Flecke, die nach Pias Zwicken auf der Haut entstanden und mit der Zeit grün und gelb wurden. Doch Mutter glaubte immer nur Pia, niemals mir.
„Das kommt daher, weil es mit dir so gut geht“, erklärt mir Lilli.
Über diese Worte denke ich oft nach, trotzdem kann ich mir keinen Reim darauf machen. Fakt ist, dass Pia nur mich zwickt und nicht Lilli oder gar Lukas.
Auch über diesen Christian denke ich nach. Ich kenne ihn nicht, doch ich spüre, dass er in irgendeiner Weise zu unserem Dorf gehört und vielleicht sogar zu unserer Familie.
Heimlich beobachte ich ihn, wie er so langsam am Rande geht. Manchmal spricht er mit einem Mann aus dem Dorf. Doch manche Leute drehen sich zur Seite, wenn er näher kommt. Sie wollen nicht mit ihm reden. So wie Mutter, die „Verschwinde!“ zu ihm gesagt hat.
Er sei ein Ungläubiger, der in die ewige Verdammnis gehört. In die Hölle. Mich schaudert bei dieser gruseligen Vorstellung. Doch vielleicht kann Christian gerettet werden, da er mit uns zusammen hinauf zur Kapelle geht.
*****
Neben der Kapelle hängt unter einem Dach ein überlebensgroßer Jesus am Kreuz. Gemaltes Blut läuft ihm über Brust und Schulter, auch sein Gesicht ist blutverschmiert von den Verletzungen durch die Dornenkrone, die er auf dem Kopf trägt. Sein ausgemergelter Körper ist verkrampft, die Füße mit groben Nägeln an das Kreuz geschlagen. Doch sein Gesicht ist nicht schmerzverzerrt, sonder wirkt entspannt, weil er wohl längst tot war, als man ihn so bestialisch kreuzigte.
Michael sagt, das Kruzifix sei das Sinnbild der Anbetung. Doch ich kann den gemarterten Jesus nicht anbeten Ich mag ihn nicht einmal anschauen, denn ich ertrage seinen Schmerz nicht.
„Hebe den Kopf und schlage das Kreuz, du verdammtes, störrisches Balg!“, befiehlt Mutter.
Sofort gehorche ich.
Michael sagt, Kruzifixe sollen alle Menschen daran erinnern, dass Christus sich zur Erlösung der Menschheit geopfert hat. Ich weiß das alles, doch so richtig verstehe ich dieses Opfer nicht.
Ich will gern ein Christ sein, zu Christus gehören und ihm nachfolgen. Deshalb versuche ich, immer alles richtig zu machen.
Mutter stößt mich in die Kapelle. Erstaunt schaue ich sie an, denn normalerweise müssen wir Kinder draußen bleiben und die wenigen Plätze den Alten überlassen. Aus den Augenwinkeln sehe ich Lilli, die fröhlich auf der Wiese herumspringt.
Der Onkel stellt sich hinter den kleinen Altar und hebt beide Arme. Sofort stehen alle auf. Zufrieden schaut er über die Köpfe. Wenn Michael predigt, ist er nicht mein Onkel, sondern irgendwie überirdisch. Schon seine Stimme klingt anders, weich und kräftig zugleich.
„Liebe Gemeinde, diese Wallfahrt ist unserem Herrn gewidmet, den wir alle lieben, denn Gott ist die Liebe. Und weil Gott uns liebt, sollen wir unsere Mitmenschen ebenfalls lieben.“
Solche Worte höre ich gern. Doch meist sagt Mutter, ich muss Gott und seine Strafe fürchten. Ich bin mir sicher, dass Gottes Strafen um vieles härter sind als Mutters Schläge.
Auch Michaels Gesicht strahlt Liebe aus. Dann zieht er plötzlich die Stirn in Falten, hebt drohend die Hand und ruft laut und zornig: „Doch wir sollen nicht alle lieben, sondern nur die Gottesfürchtigen, nicht die Abtrünnigen!“
Beim letzten Wort zeigt Michael zur Tür. Dort stehen einige Leute, die erschrocken zurückweichen und sich ängstlich umsehen. Wen kann der Onkel wohl gemeint haben?
„Wer sich von seiner Gemeinde abwendet, darf in unserem Dorf nicht geduldet werden! Solche Menschen haben auf ewig ihr Recht verwirkt, an unseren Gottesdiensten und Traditionen wie diese Wallfahrt teilzunehmen.“
Meint der Onkel Lilli? Sie betet nicht so viel wie ich oder Pia oder gar Mutter. Eigentlich betet sie nur, wenn Mutter sie dazu zwingt. Sie sagt, sie will sich nicht Gott zuwenden, sondern dem Leben, was immer das heißen mag.
Am liebsten würde ich jetzt ihre Hand ergreifen und sie trösten. Doch sie sitzt nicht neben mir, sondern vergnügt sich draußen auf der Wiese mit ihren Freundinnen. Sie soll nicht verdammt sein und auf keinen Fall in die Hölle kommen. Sie ist ein guter Mensch. Das weiß ich genau.
Der Onkel macht eine Pause und schaut mahnend jedem Einzelnen in der Kapelle ins Gesicht. Sein Gesicht verfärbt sich dunkelrot, als er weiterspricht.
„Noch schlimmer als die, die aus der Kirche austreten und unserem Herrn den Gehorsam verweigern, sind die, die einen anderen Gott anbeten.“
Jeder weiß, dass es nur einen Gott gibt. Das hat Michael uns oft genug gepredigt und so steht es auch in der Bibel. Lilli weiß das auch. Also meint er nicht sie, sondern jemand anderen. Aber wen?
Mir fällt der Mann mit dem Bart ein, von dem Mutter sagte, er sei ein Abtrünniger. Zu ihm könnte die Mahnung passen. Außerdem wirkt er furchteinflößend mit seinem dichten schwarzen Bart. Die Nachbarin nannte ihn Christian und sagte, er sei wieder da. Also war dieser Christian schon einmal bei uns im Dorf, hat hier vielleicht sogar gelebt. Ich vermute, dass man diesen Abtrünnigen damals vertrieben hat.
Hoffentlich gelingt es dem Onkel, ihn noch einmal zum Fortgehen zu bewegen, damit er uns nicht in Gefahr bringt.
„Das erste Gebot lautet: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir!“, schreit Michael in den Raum. „Wer es dennoch tut, ist ein Ausbund des Teufels.“
Mutter nickt und schaut mich böse an. Ich erschrecke bis ins Mark, obwohl ich niemals einen anderen Gott angebetet habe und dies auch niemals tun werde. Ich mache mich so klein wie möglich und rutsche tiefer in die Bank. „Und am allerschlimmsten sind diejenigen, die solche Abtrünnigen in den christlichen Schoß ihrer Familien hineinlassen. Diese Leute sind selbst Abtrünnige und müssen ebenso aus unserer Gemeinde ausgeschlossen werden.“
Ich bin mir sicher, dass niemand diesen Christian in sein Haus einladen wird, obwohl einige Leute mit ihm gesprochen haben. Doch jetzt sind sie gewarnt, denn der Onkel hat sich klar und deutlich ausgedrückt.
*****
Als wir die Kapelle verlassen, entdecke ich Lilli mitten in einer Gruppe Menschen. Ich winke ihr zu und überlege, ob ich mich zu ihr geselle. Doch ich mag keine Menschengruppen und bin lieber allein. Außerdem packt mich Mutter am Arm und schiebt mich zur Seite.
Von dort beobachte ich, wie Lilli auf den Fremden zeigt, der sich mit einigen Männern unterhält. Hat sie nicht gehört, dass wir ihn meiden sollen? Sicher bekommt sie nun Ärger und die Männer, die sich mit diesem Abtrünnigen abgeben, ebenfalls.
Ich lasse Lilli nicht aus den Augen und sehe, dass sie nun zu mir schaut und ihren Kopf schüttelt. Sie sieht überrascht aus, als könne sie nicht glauben, was sie soeben erfahren hat. Wieso sprechen diese Leute mit Lilli über mich? Oder geht es um Mutter, die direkt neben mir steht?
Ganz offensichtlich hat sich Lilli nach dem Bärtigen erkundigt, obwohl uns der Onkel eindringlich vor diesem Mann gewarnt hat. Lilli probiert gern ausgerechnet das aus, was verboten ist. Sie ist neugierig und fragt einfach, wenn sie etwas wissen will. Ich bin lieber still, höre zu, denke mir meinen Teil und schweige. Deshalb glaubt Lilli, ich lasse Mutter für mich denken. Doch das stimmt nicht. Manchmal ist es sogar gut, überhaupt nicht zu denken. Das erspart viel Ärger.
Jetzt läuft Lilli auf mich zu und wedelt dabei mit beiden Armen. Als sie neben mir steht, stößt Mutter grob gegen ihre Schulter und zischt: „Benimm dich gefälligst!“
Doch Lilli hört nicht auf sie.
Sie zieht mich beiseite, beugt sich nahe an mein Ohr und flüstert: „Du glaubst es nicht, was ich gerade erfahren habe!“ Bedeutungsschwer schaut sie mich an. „Dieser Christian ist Mutters Bruder.“
Nein, das glaube ich wirklich nicht. Auf gar keinen Fall haben wir einen Abtrünnigen in der Familie. Das hätte sich längst im Dorf herumgesprochen, denn solch eine gewaltige Sünde wäre niemals geheim geblieben. Außerdem hätte Mutter oder Michael längst von ihrem Bruder erzählt, auf ihn geschimpft, ihn verflucht, uns vor ihm gewarnt. Doch keiner hat diesen Christian jemals erwähnt, auch die Nachbarn nicht. Er war nie im Dorf und schon gar nicht in unserem Haus. Gott bewahre!
„Wenn er nun heute oder morgen an unsere Tür klopft, stürzt er uns alle ins Unglück“, flüstere ich ängstlich.
„Papperlapapp!“, wischt sie munter meine Bedenken fort. „Außerdem wäre dann endlich mal was los.“
Völlig verwirrt laufe ich schweigend mit all den anderen Gläubigen nach Hause, während Lilli vergnügt mit ihren Freundinnen schwatzt.
Als am Abend alle am Tisch sitzen, fragt sie: „Warum hast du uns noch nie von deinem Bruder Christian erzählt?“
Im gleichen Moment schlägt ihr Mutter kräftig ins Gesicht. Und noch einmal.
„Raus!“, schreit sie aufgebracht. „Fort mit dir, du gottlose Person! Nie wieder will ich diesen Namen in meinem Haus hören! Nie wieder!“
Ich ducke mich ängstlich und spüre Vaters Blick auf mir. Doch ich wage nicht, ihn anzuschauen.
„Das gilt auch für dich!“, faucht Mutter.
Ich weiß, dass ich gemeint bin. Doch ich weiß nicht, was genau auch für mich gilt: dass ich den Namen Christian nicht erwähnen darf oder wie Lilli vom Tisch verschwinden soll und kein Abendessen bekomme.
*****
Die Grundschüler werden von einem Sammler, der unsere fünf Dörfer abfährt, zur Schule gebracht und anschließend wieder nach Hause. Die Großen wie ich benutzen den Linienbus.
Ich genieße diese Busfahrten sehr, weil ich so gern den Leuten zuhöre, ohne selbst etwas sagen zu müssen. Ich schaue zur Seite, damit mich niemand anspricht oder nach unten wie die vielen Leute, die ihr Handy nicht aus den Augen lassen und darauf herumwischen. Die meisten tragen sogar Kopfhörer, damit sie nicht hören müssen, was um sie herum gesprochen wird. Ich beobachte gern die Gesichter und stelle mir vor, ob die Leute an etwas Schönes denken oder traurig sind.
Leider fährt der Bus nur drei Mal am Tag: früh am Morgen, am Nachmittag und gegen Abend. Er hält oben an der Hauptstraße. Von dort habe ich noch gut drei Kilometer bis zu unserem Haus unten am Fluss.
Das Haus ist alt und klein. Unten im Erdgeschoss befinden sich die große Küche, die gute Stube und das Bad, oben drei Schlafkammern: eine für die Eltern und Pia, eine ganz allein für Lukas und eine für Lilli und mich.
Früher gab es neben unserem Haus eine kleine Brücke über den Fluss, doch die war alt und kaputt und wurde schließlich gesperrt. Der Onkel sagt, es wäre Verschwendung von Steuergeldern, eine neue Brücke zu bauen, weil auf der anderen Fluss-Seite niemand wohnt. Nun ist unser Dorf eine Sackgasse, weshalb sich keine Fremden zu uns verirren.
Wenn ich den Bus verpasse, muss ich die sieben Kilometer von der Stadt bis zum Dorf laufen und zwar immer auf der kurvigen Landstraße entlang. Es gibt auch kürzere Wege, gleich zwei davon. Der erste führt quer übers Feld, wurde aber vom Bauern überpflügt und ist nicht mehr zu erkennen. Auch den zweiten findet man schwer. Er durchquert auf gerader Linie das kleine Wäldchen, doch der Pfad ist von Gebüsch zugewuchert, weil sich keiner um ihn kümmert.
*****
Um den Bus zu erwischen, laufe ich schneller. Meine Englisch-Lehrerin winkt mir zu, ich winke zurück und laufe eilig weiter.
Doch sie ruft: „Johanna, warte bitte!“
Widerwillig bleibe ich stehen.
„Ich muss zum Bus!“, murmle ich.
„Wie geht es deinem Onkel Christian?“
„Ich habe keinen Onkel Christian“, entgegne ich verlegen.
Habe ich jetzt gelogen, weil es diesen Onkel wirklich gibt? Aber ich darf ihn nicht einmal erwähnen, denn er ist ein Abtrünniger. Deshalb ist es schon richtig, dass es ihn gar nicht gibt.
„Das ist nicht gut, Johanna. Man darf niemanden allein nach seinem Glauben beurteilen und schon gar nicht verurteilen.“
Wovon redet die Frau?
„Keiner ist vierundzwanzig Stunden Christ oder Moslem, er ist vor allem ein Mensch, der isst und schläft und Liebe sucht.“
Ich habe keine Ahnung, wovon sie spricht und was sie von mir will.
„Ich muss zum Bus“, wiederhole ich, drehe mich um und lasse sie einfach stehen.
Ich weiß, dass das sehr unhöflich von mir ist, doch wenn ich den Bus verpasse, muss ich lange über Land laufen, bekomme obendrein Ärger mit der Mutter und am Ende kein Abendessen.
„Denke darüber nach!“, ruft mir die Lehrerin nach.
Kurz vor der Bushaltestelle bleibe ich stehen, weil mitten auf dem Fußweg Gerümpel liegt. Während ich drumherum gehen muss, schaue genauer hin, denn meist werden Sachen weggeworfen, die noch gut zu gebrauchen sind. Das größte Teil ist ein Gitterbett mit Matratze, das noch völlig in Ordnung ist. Fassungslos bleibe ich stehen und schüttle meinen Kopf. Neben dem Bett liegen eine Kommode mit einem Wickelaufsatz, ein Hochstühlchen und ein umgekippter Kindersportwagen. Das sind alles Dinge für ein Kleinkind und alle sehen nahezu ungebraucht aus. Weshalb wurden sie auf die Straße gestellt? Holt sie jemand ab? Oder werden sie nicht mehr gebraucht? Warum? Vielleicht gab es in der Familie ein furchtbares Unglück?
Dieser Gedanke lässt mir keine Ruhe und ich kann meinen Blick nicht von diesen so achtlos auf der Straße liegenden Möbel losreißen.
„Hallo, Johanna!“, spricht mich ein Mann an.
Ich brauche einen Moment, um die Bilder von dem möglicherweise toten Kind und seinen verzweifelten Eltern aus dem Kopf zu bekommen und den Mann zu erkennen, der nun neben mir steht und mich anlächelt.
Es ist der mit dem Bart, der Abtrünnige, der Ungläubige. Christian. Mit ihm möchte ich nichts zu tun haben. Suchend schaue ich mich um, ob vielleicht jemand in der Nähe ist, den ich kenne und der mir helfen könnte. Doch sämtliche Leute, die vorhin noch über den Platz liefen, sind wie vom Erdboden verschluckt. Ich bin ganz allein mit diesem unheimlichen Mann und weiß nicht, was ich machen soll. Auf jeden Fall muss ich ihn loswerden, bevor jemand bemerkt, dass ich hier mit ihm stehe und es am Ende Mutter erzählt.
Ich nehme all meinen Mut zusammen und sage so laut ich kann: „Lassen Sie mich in Ruhe! Ich muss zum Bus!“
Bevor ich weglaufen kann, ergreift er meinen Arm und hält mich zurück. Erschrocken schaue ich ihn an. Will er mir etwas tun? Doch seine dunklen Augen wirken ruhig, direkt freundlich.
„Entschuldige bitte“, sagt er sanft und gibt meinen Arm wieder frei.
Das überrascht mich jetzt. Und gleichzeitig bin ich wütend, weil ich aus den Augenwinkeln bemerke, dass der Bus gerade abfährt. Der nächste fährt erst am Abend. Selbst, wenn ich renne, schaffe ich es nicht mehr rechtzeitig nach Hause. Es sei denn, mich nimmt jemand mit dem Auto mit, der zufällig in meine Richtung fährt. Doch darauf kann ich nicht hoffen, weil wir viel zu abseits wohnen. Ich sehe schon die Mutter vor mir, wie sie mich anschreit und mit ihren harten Fingerknöcheln gegen meinen Kopf und meine Arme schlägt.
„Ich wollte dir nicht weh tun. Ich möchte dich nur näher kennenlernen.“
Aber ich will ihn nicht kennenlernen. Ich darf das gar nicht.
„Ich kenne Sie nicht und will Sie auch nicht kennen. Ich will nach Hause. Mein Bus fährt gleich und meine Eltern erwarten mich.“
Der Mann lächelt. Sicher hat er ebenso wie ich gesehen, dass der Bus längst abgefahren ist.
Doch es ist kein gehässiges Lachen, eher ein verlegenes.
„Ich bin Abdi, der Bruder deiner Mutter.“
„Sie lügen!“, sage ich mutig. „So einen Bruder hat meine Mutter nicht.“
„Früher hieß ich Christian.“ Bittend schaut er mich an. „Hat deine Mutter nie von mir erzählt?“ Ich schüttle den Kopf. Soll ich ihm sagen, dass wir seinen Namen nicht erwähnen dürfen, weil er ein Abtrünniger ist? Oder dass ich erst während der Wallfahrt erfuhr, dass es ihn überhaupt gibt? Dass ich Ärger bekomme, wenn ich mit ihm spreche?
„Und doch ist es wahr: Ich bin der jüngste Bruder deiner Mutter und natürlich auch von Michael.“
Ich schaue zu Boden und überlege, ob ich nun etwas sagen muss oder einfach davonlaufen kann.
„Ich wohne ein paar Tage bei meiner Mutter, also bei deiner Oma. Lass uns zusammen zu ihr gehen! Sie würde sich freuen, dich zu sehen und wir können in Ruhe reden.“
„Ich darf nicht. Ich kriege sowieso Ärger, weil ich den Bus verpasst habe.“
Schnell beiße ich mir auf die Zunge, weil er nun weiß, dass gar kein Bus mehr fährt. Doch es ist nun einmal gesagt und lässt sich nicht mehr zurücknehmen.
„Das tut mir leid.“ Sichtlich betroffen schaut er mich an und fragt: „Was machen wir denn jetzt?“
„Wir? Wieso denn wir?“
Kurz denkt er nach. Dann schlägt er vor, mich in seinem Auto nach Hause zu bringen.
„Meinen Sie, ich wäre so dumm, zu Ihnen ins Auto zu steigen?“
Ich werfe meinen Kopf zurück und versuche zu lachen. Er soll merken, dass ich keine Angst vor ihm habe. Dabei habe ich sehr wohl Angst, große sogar.
„Lassen Sie mich endlich in Ruhe, sonst rufe ich die Polizei!“
Energisch greife ich in meine Tasche und tue so, als suche ich mein Handy. Dabei habe ich gar kein Handy und schon gar nicht solch ein modernes Smartphone, das eigentlich alle Kinder in meiner Klasse besitzen.
„Ich gebe dir meine Telefonnummer. Dann kannst du mich anrufen, wenn du magst. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen. Deine Oma auch.“
Wortlos drehe ich mich um und laufe davon.
„Denk drüber nach!“, ruft er mir nach.
Es sind die gleichen Worte, die meine Lehrerin benutzte. Doch es hat keinen Sinn, darüber nachzudenken, denn mir ist der Kontakt mit ihm verboten. Ich kenne ihn nicht und will ihn auch nicht kennenlernen, denn Ärger habe ich auch so schon genug.
Ich werde zu spät nach Hause kommen und je nach Mutters Laune Schläge oder nichts zu essen bekommen – oder beides.
Eilig mache ich mich auf den Weg. Kaum bin ich außerhalb der Stadt, fängt es an zu nieseln. Ganz fein wie Nebel, der unter meine Jacke kriecht und die Jeans durchnässt. Ich ärgere mich, weil kein einziges Auto anhält. Warum nur bin ich nicht so mutig wie Lilli? Die hätte sich von Christians heimfahren lassen. Oder sie wäre mit ihm zu Oma gegangen. Mich wundert, dass ich noch nie über Mutters Mutter nachdachte. Ich weiß nicht einmal, wo sie wohnt, denn wir haben sie niemals besucht. Doch ich weiß nicht, warum. Sie wurde in unserem Haus nie erwähnt. Deshalb glaubte ich wohl, dass es sie gar nicht gibt.
*****
Mir fällt ein, dass ich diese Oma schon einmal gesehen habe, ein einziges Mal. Plötzlich kann ich mich an die Begegnung erinnern, als wäre sie gestern gewesen, obwohl sie schon viele Jahre her ist, kurz nach meiner Einschulung.
Die Sekretärin holte mich mitten aus dem Unterricht und führte mich zu einer Frau, die im breiten Flur stand und offensichtlich auf mich wartete.
„Ich bin deine Oma“, sagte sie und lächelte mich an.
Natürlich glaubte ich ihr nicht, denn ich kannte meine Oma. Unwillig schüttelte ich den Kopf.
Die Frau lächelte immer noch.
„Du kennst nur die andere Oma, die Mutter deines Vaters. Doch deine Mutter hat auch eine Mutter. Und die bin ich.“
Sie tippte sich auf die Brust und reichte mir ihre Hand zum Gruß. Artig griff ich zu, obwohl ich dazu keine Lust hatte. Ich kannte die Frau nicht, die behauptete, meine Oma zu sein. Um ihr nicht in die Augen sehen zu müssen, betrachtete ich ihre Kleidung. Sie trug einen giftgrünen Hosenanzug, dazu eine rotbraune Tasche und hohe Absatzschuhe in der gleichen Farbe. So wäre Mutter niemals auf die Straße