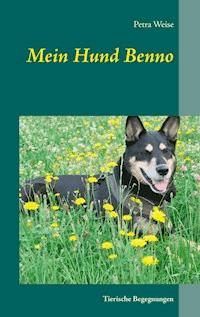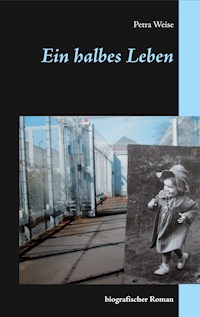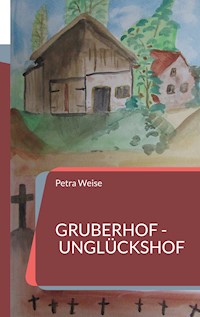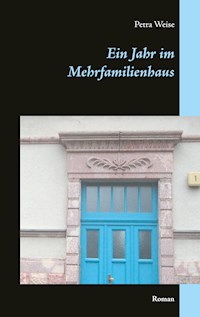Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Melanie schwanger wird, heiratet sie überstürzt einen Mann, der sie ignoriert. Auch von ihrer Mutter wird sie nicht beachtet. Den Grund dafür erfährt sie erst mit zweiunddreißig Jahren und auch, warum ihr Bruder nicht im Elternhaus aufwuchs. Melanie will ihrer kranken Mutter helfen, doch ihre Familie empfindet diese Hilfe als Übergriff. Damit gerät ihr gewohntes Leben immer mehr aus den Fugen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Menschen werden nicht wegen ihres edlen Charakters geliebt
und nur selten wegen ihrer Gemeinheiten verabscheut.
Inhalt
Daniel
Kindheit
Daniel
Jennifer
Timo
Hochzeit
Urlaub
Glaube
Büro
Lenya
Krankheiten
November
Pflege
Therapie
Schluss
Daniel
„Ich habe etwas über deinen Bruder herausgefunden“, flüstert mir Nicole ins Ohr und tut sehr geheimnisvoll.
Was soll an Daniel geheimnisvoll sein? Er ist einfach nur langweilig und lebt seit nunmehr zwanzig Jahren in Argentinien. Warum er dort lebt, weiß ich nicht, ich habe ihn nie gefragt. Daniel war schon immer sehr verschwiegen. Er sprach nicht gern, schon gar nicht über seine Gedanken und Pläne. Als ich klein war, habe ich ihn eine Zeitlang bewundert, doch nicht lange. Was ich ihn auch fragte, er antwortete selten mehr als ein Ja oder Nein. Also machte ich es bald wie all die anderen Leute und beachtete ihn nicht.
Mich packt auf einmal das schlechte Gewissen, weil ich überhaupt keine Vorstellung von seinem Leben in Argentinien habe. Immerhin ist er mein Bruder.
„Du weißt, was er in Argentinien macht?“, frage ich. „Nein, das weiß ich nicht. Ich rede von früher, als er noch klein war.“
Ich weiß nicht, wie er war, als er noch klein war. Daniel ist zehn Jahre älter als ich, ich kann mich kaum an ihn erinnern, weil er als Kind irgendwie unsichtbar war. Er schaute stundenlang aus dem Fenster. Das ist das Bild, das ich noch heute von ihm habe: ein großer Junge, der stumm aus dem Fenster schaut. Ich weiß nicht, was er dort sah oder worauf er wartete. Vermutlich auf Oma, die ihn oft in den Ferien und an den Wochenenden mitnahm in ihre Wohnung im Nachbardorf. Dort spielte sie Halma mit ihm, während meine Schwester Jenni und ich mit den Eltern ins Kino gingen oder in den Tierpark oder ans Meer fuhren.
Daniel war bei keinem unserer Ausflüge dabei. Ich weiß nicht, warum er lieber bei Oma war als bei uns.
Ich mochte ihn nicht, auch Vater konnte ihn nicht leiden. Deshalb hielt sich Daniel immer in seinem Zimmer auf, wenn Vater daheim war.
Die Eltern wohnen noch heute im neuen Haus. Eigentlich ist es kein neues Haus. Es heißt nur so, weil es das erste der neuen Siedlung am Waldrand war. Ich wuchs in diesem Haus auf und bin inzwischen zweiunddreißig Jahre alt. Meine Schwester Jenni ist ein Jahr jünger als ich und Daniel zehn Jahre älter. Wir sprechen nicht über ihn, aber ich weiß, dass Oma über WhatsApp Kontakt zu ihm pflegt. Mich interessiert das alles nicht.
Trotzdem frage ich Nicole: „Was hast du denn herausgefunden?“
„Alle im Dorf wissen es.“
„Was wissen alle?“, hake ich ungeduldig nach.
„Das möchtest du gern wissen, was? Habt ihr daheim nie darüber gesprochen?“
„Worüber denn?“
Diese Geheimnistuerei geht mir auf die Nerven.
Sie soll reden oder es bleiben lassen.
„Wenn du nicht bald redest, will ich es gar nicht mehr wissen“, gebe ich verärgert zurück.
„Dann eben nicht.“ Nicole geht ein paar Schritte zur Seite. Dann dreht sie sich um und schaut mich triumphierend an. „Er ist ein verbotenes Kind.“
Daniel ist kein Kind. Er ist schon über vierzig Jahre alt. Ein Kind kann nicht verboten sein, maximal etwas Verbotenes tun. Daniel tat nie etwas Verbotenes. Er war sogar braver als Jenni, die niemals Widerworte gab. Jenni war im Dorf beliebt, Daniel nicht. Auch ich mochte ihn nicht. Er war langweilig.
Außerdem kenne ich ihn kaum, weil er nicht bei uns wohnte, sondern weit entfernt in einem Internat. Wir sahen uns nur in den Ferien.
Ich war Vaters Lieblingskind, Jenni mehr das von Mutter. Daniel war niemandes Liebling.
Vater spricht nicht gut über Daniel, eigentlich gar nicht. Auch Mutter erwähnt ihn niemals. Als Kind machte ich mir keine Gedanken darüber, weil ich es nicht anders kannte. Erst später, als Daniel nach Argentinien ging, wollte ich wissen, warum er fortging und was er dort macht. Aber da war es zu spät. Er war nicht mehr da und keiner konnte oder wollte meine Fragen beantworten.
Kindheit
Ich lebe nicht im Dorf meiner Kindheit. Ich lebe in der Stadt und besuche nur einmal im Monat meine Eltern. Im Dorf habe ich keine Freunde, weil ich als Kind nicht draußen spielte. Ich wollte lieber lesen.
In den meisten Romanen haben die Personen viele Freunde, nicht immer nette Familien, aber immer gute Freunde. Ich hatte keine Freunde. Ich hatte Bücher.
Nie kicherte ich wie die anderen Mädchen, nie wollte ich von den Jungs geschubst und an den Haaren gezogen werden. Ich wollte auch nie durch Pfützen laufen, weil das die Schuhe nass macht und der Schmutz an die Hose spritzt.
„Eingebildete Zicke!“, nannten sie mich und tun es noch heute. Im Grunde sollte es mir egal sein, was die Leute denken und wie sie mich nennen. Aber es ist mir nicht egal. War es nie.
Ich bin die aus der Stadt. Jenni lebt ebenfalls in der Stadt, aber alle nennen sie eine von uns. Während ich bei den Eltern im Haus sitze, besucht sie ihre Freundinnen, die im Dorf geblieben sind. Jenni ist ständig mit irgendwelchen Freunden zusammen.
Ich nicht. Ich lese. Ohne Bücher kann ich nicht leben. Meine Wohnung ist vollgestopft mit Büchern.
„Du lebst nicht wirklich, du lebst nur in deinen Büchern“, hörte ich oft.
Das Dorf, in dem ich aufwuchs und in dem meine Eltern heute noch leben, ist winzig. Es hat keine Mitte, keinen Dorfplatz und keine Kirche – nur eine Straße mit kleinen verwinkelten Häusern, einem Bauernhof und der neuen Siedlung oben am Waldrand. Der Gasthof ist seit Jahren geschlossen, die Leute trinken ihr Bier lieber daheim.
Vater war der erste, der am Waldrand baute. Erst vor etwa zehn Jahren entstand die Waldsiedlung, die jedes Jahr wächst. Unser Haus fällt zwischen den modernen Architekturhäusern auf, weil es ein traditionelles Spitzdach und einen Holzbalkon am Giebel hat. Die neuen Häuser haben Flachdächer und Wände aus Glas.
Ich weiß bis heute nicht, warum meine Eltern in dieses verlassene Kaff gezogen sind und begreife nicht, warum sie immer noch hier leben. Leben ist stark übertrieben, denn hier gibt es nichts. Gar nichts. Nur eine feuchte Wiese und dahinter den Wald. Kein Geschäft, keine Schule.
Vater ist Gymnasiallehrer und fährt täglich die fast zwanzig Kilometer in die Stadt, Mutter arbeitet in der Gemeindeverwaltung, zu der sieben Ortschaften gehören.
Anfangs fühlte ich mich wohl im Dorf. Ich hatte ein eigenes Zimmer und alle Freiheiten der Welt. Wir Dorfkinder rannten über die Wiesen bis hinüber zum Wäldchen, bauten Dämme am Bach und fingen Wildkätzchen. Als ich lesen konnte, brauchte ich den Wald nicht mehr. Ich war oft so in ein Buch vertieft, dass ich in der Geschichte komplett versank. Ich fühlte nichts um mich herum, hörte nichts, sah nichts – ich las. Ich wollte in der Stadt leben, wo die Schule war und es Bibliotheken und Buchhandlungen gibt. Ich bin immer sehr gern zur Schule gegangen und lerne auch heute noch gern, weshalb ich an jeder Weiterbildung teilnehme.
Nach Abschluss der zehnten Klasse habe ich Mediengestalter gelernt und bin in der Stadt geblieben.
Auch Jenni lebt in der Stadt. Anfangs teilten wir uns eine kleine Wohnung, gingen zusammen ins Kino und Eis essen. Überall, wo wir waren, fiel meine Schwester auf. Manche Männer blieben sogar stehen, um ihr nachzuschauen. Jenni ist blond, größer als ich und sehr schlank. Doch das ist es nicht, weshalb sie von den Männern angestarrt wird. Es ist ihre Art, sich zu bewegen, sie geht nicht, sie schwebt – und das auf halsbrecherisch hohen Absätzen. Ich dagegen trage praktische flache Turnschuhe. Hinzu kommt Jennis einzigartige Stimme. Sie ist tiefer als meine und klingt wie Samt und Honig. Eigentlich wollte sie Sängerin werden.
Aber keiner lobte ihre Stimme, sondern immer nur ihr unglaublich gutes Aussehen. Doch Jenni wollte nicht auf ihr Aussehen reduziert werden. Deshalb trug sie ihre Haare rappelkurz, färbte sie orangebraun und trug nur noch Männerkleidung. Drei Jahre lang. Erst, seit sie mit Olaf zusammen ist, wagt sie es wieder, sich als die schöne Frau zu zeigen, die sie ist. Sie versteckt sich nicht mehr.
Heute wohnen wir nicht mehr zusammen. Wie sehen uns selten, wir telefonieren oder schicken uns kurze Nachrichten auf WhatsApp.
*****
Ich war sehr klein und dünn und Jenni schnell größer als ich, obwohl sie jünger ist. Mutter sagte, das liegt daran, weil ich so mäkelig bin. Ich mochte kein Fleisch und keine Wurst, nur Kartoffeln mit etwas Soße oder Brot mit etwas Butter. Deshalb schickte man mich, bevor ich in die Schule kam, zum Aufpäppeln in ein Kinderheim. Ich freute mich auf die fremde Gegend an einem Meer, das ich bis dahin nicht kannte. Auch Heimweh kannte ich nicht, zumindest nicht am Anfang. Weil ich unbedingt zunehmen sollte, sollte ich täglich viel essen, vor allem Fleisch und Mehlspeisen, was ich beides nicht mochte. Mir wurde schon übel, wenn ich den vollen Teller sah.
„Du isst alles auf!“, befahlen die Erzieher und Krankenschwestern. „Eher stehst du nicht vom Tisch auf!“
Ich saß also stundenlang ganz allein im großen Speisesaal, während die anderen Kinder draußen spielten oder am Strand entlangliefen. Seit dieser Zeit mag ich die See nicht, sie ist untrennbar mit meinen schlimmen Erinnerungen im Kinderheim verbunden.
Ich wurde misstrauisch und glaubte niemandem mehr. Meine Eltern hatten mir versprochen, dass mir die Zeit im Kinderheim gefallen wird. Aber das stimmte nicht. Es waren acht grauenvolle Wochen, in denen ich mich Nacht für Nacht in den Schlaf weinte.
Ich bin seit meinem zehnten Lebensjahr kurzsichtig und trage eine Brille. Mama sagt, das sei allein meine Schuld, ich hätte mir vom vielen Lesen die Augen verdorben. Ich habe haselnussbraune Haare, meine Schwester blonde Locken. Sie war die Niedliche, alle Leute mochten sie. Ihren Namen Jennifer konnte ich anfangs nicht aussprechen, weil er so lang ist. Ich nannte sie Jenni und dabei blieb es bis heute, obwohl Jenni ihren Babynamen nicht mag.
Meinen Namen spricht sie immer voll aus: Melanie.
Alle anderen nennen mich Melli, was ich viel netter finde. Melanie erinnert mich an Melancholie, das Dunkle. Mein Name bedeutet tatsächlich die Dunkle und Nachdenkliche und passt zu mir, weil meine Haare dunkel sind und ich rund um die Uhr nachdenke – auch nachts.
Jenni denkt nicht nach. Sie ist laut und fröhlich und kann alles so nehmen, wie es kommt. Alle Leute sind freundlich zu ihr und sie ist zu allen freundlich.
Immer. Nur zu mir nicht. Sie sagt, ich sei schwierig, weil ich so still und kritisch bin.
Als Kind wollte Jenni jeden Tag Vater-Mutter-Kind spielen, doch dazu hatte ich keine Lust mehr, als ich lesen konnte. Ich wollte in fremde Geschichten steigen und auf diese Weise Abenteuer erleben, die ich selbst nie erleben würde. Märchen mochte ich nicht, sie waren mir zu grausam und hatten nichts mit der wirklichen Welt zu tun. Es sollte eine gute wirkliche Welt sein. Deshalb konnte ich nicht wie Jenni über Tom und Jerry lachen. Ich fand die Maus schrecklich gemein.
„Du verstehst überhaupt keinen Spaß! Das ist doch nur ein gezeichneter Film!“, empörte sich Jenni.
Ob Film oder nicht, ich finde es nicht lustig, wenn jemand auf die Nase fällt oder verprügelt wird. Ich wünsche mir eine freundliche Welt und ertrage keine brutale Unterhaltung wie zum Beispiel einen Krimi.
Unsere Eltern besaßen viele Bücher, Mutter Romane über arme Frauen, die reiche Grafen heiraten.
Romane, die mir falsch und kindisch vorkamen.
Nichts davon schien mir im wahren Leben möglich.
Ich saß lieber über Vaters Lexika und Bildbänden über fremde Länder. Darin gab es zum Beispiel schwarze Menschen, die keine Kleider trugen, aber bunte Federn auf dem Kopf, große Scheiben in der Unterlippe oder viele Ringe um den Hals.
Seit ich Vaters Bücher entdeckte, habe ich begriffen, dass alle Menschen verschieden sind. Ich will immer wissen, wie andere Leute leben, was sie tun und warum sie es tun.
*****
Eines Tages suchte ich im Schrank meiner Mutter nach neuen Büchern. Bücher fand ich keine, nur allerhand Papiere, darunter meinen Taufbrief. Ich war getauft? Die Eltern erlaubten mir und meiner Schwester keinen Kirchgang, nicht einmal die Teilnahme am Religionsunterricht. Religion kannte ich nur aus Büchern und Geschichten. Gott kam nur beim täglichen Gruß vor und in Redewendungen wie „Gott sei Dank!“; oder wenn Oma ihre Hände über dem Kopf zusammenschlug und ausrief:
„Herrgott, Mädchen, so etwas tut man nicht!“
„Es ist nur ein Stück Papier, nichts weiter“, sagte Mutter.
Aber das glaubte ich nicht.
„Warum bewahrst du es dann auf?“
„Nimm ihn und mach damit, was du willst! Aber du sollst wissen, dass ich dich nicht taufen lassen wollte.“
„Warum nicht?“
„Das erkläre ich dir später, wenn du erwachsen bist.“
Diesen Satz bekam ich damals oft zu hören. Aber ich wusste mir zu helfen, nahm den Schein und suchte in Vaters Lexikon das Wort Taufe heraus.
Die Taufe ist das erste Sakrament und der Täufling wird damit in die Glaubensgemeinschaft der Christen aufgenommen.
Das heißt, ich bin Katholik, ohne es zu wissen.
Doch warum durfte ich nie in die Christenlehre der Kirche, nicht einmal in den Religionsunterricht der Schule und schon gar nicht wie die anderen Kinder zur Kommunion?
In der Urkunde sind zwei Paten vermerkt, die ich nicht kenne. Vermutlich sind es frühere Freunde meiner Eltern, die irgendwann fortzogen. Besucht haben sie uns nie und keiner von ihnen hat mich je so begleitet, wie es im Lexikon beschrieben steht.
*****
Als Kind litt ich unter schlimmen Albträumen, in denen ich mich stets verlief und nicht mehr nach Hause fand. Oft fiel ich im Traum in eine tiefe dunkle Schlucht und wurde schreiend wach. Ich fürchtete mich schon am Abend vor diesen Träumen und versuchte, wach zu bleiben, indem ich bis in die Morgenstunden las.
Böse Träume quälen mich noch immer, allerdings nicht mehr so heftig wie früher. Sobald ich abends im Bett liege, jagen Millionen Gedanken durch meinen Kopf, die alle gleichzeitig gedacht und sortiert werden müssen. Ich finde keine Ruhe und lenke mich mit Lesen ab, bis mir die Augen brennen und von selbst zufallen. Meine unruhigen Träume wecken mich mehrmals in der Nacht. Dann fürchte ich mich, mache überall Licht und lese. Am Morgen bin ich müde und wie gerädert.
Ich greife nach einem Pfirsich. Er ist so überreif, dass seine Haut nachgibt und ich mit meinen Fingern in braunem weichem Fleisch lande. Ich zucke zurück und aus dem Loch, den mein Finger in die Frucht gedrückt hat, kommen Wespen heraus.
Eine der Wespen kriecht mir im Nacken hinter den Pulli. Ich spüre, wie sie meinen Rücken herunter krabbelt und halte ängstlich die Luft an, denn ich befürchte, dass sie mich gleich stechen wird. Der Pulli sitzt eng. Die Wespe hat nicht viel Platz zwischen dem Stoff und meiner Haut und wird wohl ebenso ängstlich sein wie ich. Mit der Hand lüpfe ich ein wenig den Kragen im Nacken und hoffe, dass die Wespe diesen Ausschlupf nutzt. Aber sie kriecht weiter nach unten und sticht. Ich spüre einen heftigen brennenden Schmerz … und werde wach.
Ich begreife nicht sofort, dass alles nur ein böser Albtraum war und versuche, mit meinen Armen die schmerzende Stelle zu erreichen. Sicherheitshalber ziehe ich mein Nachthemd aus, wende und schüttle es. Natürlich fliegt keine Wespe heraus, aber ich gebe das Hemd in die Wäschebox und hole ein frisches aus dem Schrank. Wie kam nur dieser Traum zustande? Mama sagt, Träume sind heimliche Wünsche. Aber ich wünsche mir ganz sicher keine Wespe im Bett. Es gab auch heute keine Fernseh-Dokumentation über Wespen oder Pfirsiche. Als ich wieder ins Bett krieche, sehe ich einen Kugelschreiber, der mitten auf dem Laken liegt. Der hatte mich also gestochen und für den bösen Traum gesorgt.
Alles, was man mir erzählt, hinterfrage ich kritisch und denke über die Antworten nach. Genau das gefällt meinem Umfeld nicht. Deshalb sage ich oft nichts, trotzdem sieht man mir meine Zweifel an.
Alles sieht man mir an, die guten und die schlechten Gedanken. In meinem Gesicht kann man lesen wie in einem Buch.
Daniel
An Daniel habe ich kaum Erinnerungen. Ich sah ihn nur während der Schulferien, weil er in einem Internat weit von unserem Dorf entfernt lebte.
„Warum gehst du immer wieder fort?“, fragte ich ihn einmal, als die Ferien vorüber waren. „Warum wohnst du nicht bei uns daheim?“
„Weil ich ein Bastard bin.“
Das Wort hatte ich schon oft gehört, denn die Kinder riefen es Daniel nach. Aber ich wusste nicht, was es bedeutet.
„Das ist ganz einfach“, erklärte er mir. „Mich gab es schon lange, bevor die Mama den Papa kennenlernte.“
Wie sollte das gehen? Ich kannte die richtige Reihenfolge ganz genau: verliebt, verlobt, verheiratet.
Erst danach kommt das Baby und das neue Spiel heißt: Vater-Mutter-Kind.
Daniel behauptete, er hätte zehn Jahre lang bei der Oma gelebt und sei erst in unsere Wohnung gezogen, als ich bereits auf der Welt war. Natürlich glaubte ich ihm nicht.
Auf der Suche nach neuen Büchern durchwühlte ich wieder einmal Mutters Aktenschrank und fand Daniels Geburtsurkunde. Er wurde tatsächlich viele Jahre vor der Heirat unserer Eltern geboren. In der Spalte Eltern stand Thomas Winkler und Sabine Schmid. Schmid ist Mamas Geburtsname. Das wusste ich. Und Daniel sagte, dass die Eltern erst zehn Jahre nach seiner Geburt heirateten. Doch irgend etwas stimmte nicht, obwohl die Namen und Daten richtig waren. Schließlich fiel mir auf, dass Vaters Name mit einer anderen, viel steileren Schrift und in hellerer Tinte eingetragen war. Aber warum? Ich musste der Sache unbedingt auf den Grund gehen.
„Mama, ich habe Daniels Geburtsurkunde gefunden.“
„Gib sie her!“
„Warum hat Vaters Name eine ganz andere Tinte und auch eine andere Schrift als dein Name?“
„Wir haben erst nach Daniels Geburt geheiratet.“
„Ich weiß. Deshalb steht Sabine Schmid in der Urkunde und nicht Sabine Winkler.“
„Dann ist ja alles klar.“
„Nein! Vaters Name hat eine andere Tinte und auch eine andere Schrift“, wiederholte ich energisch. „Siehst du das nicht?“
Ich hielt ihr das Blatt vor die Augen. Sie riss es mir sofort aus den Händen.
„Du denkst dir wieder einmal Hirngespinste aus!“,
tadelte sie. „Was hast du überhaupt in meinem Schrank zu suchen?“
Mamas Stimme klang ungeduldig und mir war klar, dass sie ganz sicher wusste, was an dieser Urkunde falsch war. Aber sie würde es mir nicht sagen.
Auch Papa behauptete, ich rede Unsinn.
Vielleicht wusste es Daniel?
„Ich habe deine Geburtsurkunde gefunden“, platzte ich heraus.
„Na und?“
„Da steht Papa mit einer ganz anderen Schrift und einer ganz anderen Tinte drin als Mama.“
„Schon klar“, sagte er.
„Aber warum?“
„Weil ich die Strafe Gottes bin.“
„Was bist du?“
Das klang so absurd, dass ich ihn auslachte und stehen ließ.
Trotzdem dachte ich später lange darüber nach, kam aber nicht dahinter, was er damit meinte. Wie sollte ein Gott, den es gar nicht gibt, strafen?
*****
Daniel war seltsam, irgendwie nicht normal. Bevor er nach Argentinien ging, sah ich ihn am Waldrand, wie er sich an einen Baum lehnte. Ich wollte ihn erschrecken und schlich mich näher. Da sah ich, dass er weinte und gleichzeitig verzückt lächelte.
Er streichelte den Baum und sprach mit ihm.
„Was tust du da?“, fragte ich kichernd. „Redest du mit dir selbst?“
„Ich verabschiede mich“, antwortete er ernst und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht.
„Von wem?“
„Von meinem Baum. Er ist mein Freund.“
„Ein Baum ist ein Baum … eine leblose Pflanze, kein Freund.“
„Diese Eiche ist sehr wohl mein Freund. Sie hat mich gerettet“, erklärte er ernst.
„Gerettet?“
Ich lachte nun laut über diesen Unsinn.
„Gerettet“, bestätigte Daniel ernst.
„Wie kann dich ein blöder Baum retten?“
„Als ich ungefähr acht Jahre alt war …“
„Da gab es mich noch nicht.“
Daniel nickte.
„Ich wohnte bei Oma im Nachbarort.“
Erstaunt sah ich Daniel an. Dann fiel mir ein, dass er mir schon einmal erzählt hatte, dass er viele Jahre bei Oma wohnte.
„Und wo waren die Eltern?“
Daniel zuckte mit der Schulter und biss sich auf die Lippen. Er wandte sich ab, strich sanft mit seiner Hand über die Rinde der Eiche, erhob sich und wollte davon gehen.
Ich packte seinen Arm.
„Du hast noch nicht fertig erzählt. Wieso ist der Baum dein Freund und wieso hat er dich gerettet?“
„Ich war immer so einsam …“
„Aber wieso? Es gab so viele Kinder im Dorf. Hast du nicht mit ihnen gespielt?“
Er schüttelte mit dem Kopf und ich vermutete, dass er wie ich lieber lesen als draußen umher rennen wollte.
„Weil sie mich nicht mitspielen ließen.“
Seltsam. Bei mir war es anders. Ich wollte nicht mehr mitspielen, seit ich lesen konnte. Doch ich sah Daniel nie mit einem Buch. Er starrte nur stundenlang aus dem Fenster, wenn er daheim war.
„Warum?“
„Weißt du das nicht?“
Verblüfft schüttelte ich den Kopf.
Daniel kratzte sich im Nacken.
„Sag schon!“, drängte ich.
„Weil ich ein Bastard bin.“
Da war es wieder, dieses Wort. Und doch verstand ich damals damals nicht, weshalb ein Bastard nicht spielen darf.
„Wenn ich traurig war, lief ich ganz allein über die Felder. Eines Tages hörte ich eine Stimme, sie kam aus dem Wäldchen.“
„Wer war das?“
„Ich sah niemanden und wollte schon weitergehen, da meldete sich die Stimme noch einmal. Sie rief mich. Also ging ich in die Richtung, aus der die Stimme kam.“ Daniel schaute mich ernst an. „Es war diese Eiche hier. Sie hat mich gerufen.“
„Warum erzählst du mir solch ein Märchen?“, rief ich erbost aus.
„Denke, was du willst, aber es ist wahr, dass mich der Baum gerufen hat.“
„Wie denn? Daniel, komm zu mir?“, spottete ich.
„Ich weiß es nicht. Aber so war es.“
Mir war klar, dass mein Bruder verrückt ist. Seltsam und verschwiegen war er schon immer, doch dass er verrückt ist, merkte ich erst jetzt. Vielleicht war er auch wie alle Erwachsenen, die Kinder nicht ernst nahmen, Märchen erzählte und glaubte, dass ich sie glaube. Aber ich war nicht dumm und glaubte nicht mehr alles, was die Erwachsenen sagten.
„Was hast du dann gemacht?“, erkundigte ich mich trotzdem und sah ihn scharf an dabei, denn ich kann spüren, wenn jemand lügt.
„Ich habe mich ins Gras gesetzt, mich an den Baum gelehnt und mich plötzlich sicher und geborgen gefühlt, nicht mehr so schrecklich einsam wie zuvor. Seitdem besuche ich jeden Tag meine Eiche, wenn ich daheim und nicht im Internat bin. Ich begrüße sie, spreche mit ihr und verabschiede mich. Und heute muss ich mich für immer von ihr verabschieden, weil ich nach Argentinien gehen muss und nie wieder hierher zurückkehre.“
Fassungslos schaute ich ihn an. Noch niemals zuvor hatte ich gehört, dass jemand einen Baum umarmt und ihn seinen Freund nennt.
„Auch ich habe meinen Freund gerettet.“
Daniel klopfte leicht gegen die Rinde.
Ich seufzte, weil ich keine Lust auf ein weiteres Märchen hatte.
„Einmal sagte der Baum …“
Genervt verdrehte ich die Augen.
„…, dass er Schmerzen hat.“
„Und wo hatte er Schmerzen? In einem Zweig oder einem Blatt?“, foppte ich.
„Es blitze zwischen der Rinde auf und ich schaute genauer hin. Da steckte ein Nagel.“
„Aber Daniel! Wie sollte ein Nagel in einen Baum gelangen?“
„Irgendwelche Idioten hatten ihn eingeschlagen ohne jeden Sinn und Verstand. Ich konnte ihn nicht herausziehen. Also lief ich nach Hause und holte aus Opas Werkzeugkiste eine Zange und eine Lupe. Zurück am Baum suchte ich jeden Zentimeter in der Rinde ab, was nicht einfach war, denn die Nägel sah man kaum.“
„Nägel? Waren es mehrere?“
„Siebenundvierzig Stück.“
„Das glaubt dir kein Mensch.“
„Ich weiß“, antwortete Daniel.
Mir war diese Geschichte inzwischen zu dumm und ich ließ ihn stehen.
Heute bereue ich, dass ich ihn nicht fragte, warum er ausgerechnet nach Argentinien auswandern will.
Ich weiß nur, dass er in unserem Dorf keinen einzigen Freund hatte - nur einen Baum.
*****
Heute ist es Mode, Bäume zu umarmen, um deren Kraft und Energie zu tanken. Die Eiche wird als heiliger Baum unserer Vorfahren geschätzt, sie soll Energie geben, den Kreislauf anregen und das Selbstbewusstsein stärken. Ich kann mir das nicht vorstellen. Zwar bin ich sehr sensibel, doch mein Mitgefühl ist allein auf Menschen gerichtet, auch auf Tiere, aber nicht auf Pflanzen. Pflanzen haben keine Seele. Sie empfinden keine Schmerzen wie Mensch und Tier. Erforscht ist das nicht, aber was weiß schon die Forschung? Sie will alles messen, wiegen, auswerten, dokumentieren. Meist kennen die Wissenschaftler schon vorher die Ergebnisse ihrer Projekte. Deshalb vertraue ich der Forschung schon lange nicht mehr.
Ich bin Mediengestalter. Unser Büro hat sich auf das Thema Natur und Umwelt spezialisiert, weshalb wir nahezu täglich viele interessante Aufträge erhalten. Im Moment entwerfe ich Werbekarten für einen Fotografen, der ausschließlich Bäume fotografiert. Ich mag Bäume, doch die Gespräche mit diesem Mann gestalten sich schwierig. Er kommt mir beim Reden so nahe, dass ich nicht mehr sein gesamtes Gesicht wahrnehme, nur seine feuchten Lippen und den hektischen Atem. Immer, wenn ich mit meinem Stuhl ein wenig von ihm wegrücke, rutscht er augenblicklich nach. Ich fühle mich dann bedrängt und kann mich nicht mehr auf seine Worte konzentrieren, weil ich innerlich nur schreie:
Bitte etwas mehr Abstand! Er spricht sehr schnell und ausnahmslos über Bäume, uralte Bäume.
Mich interessiert das alles nicht. Ich muss nur wissen, welche Größe die gewünschten Karten haben sollen und wie viele er je Motiv benötigt. Auf den Karten ist jeweils ein dicker alter Baum abgebildet, daneben verschiedene Texte wie: Dieser Baum hat eine Seele. Wo ist deine? Oder: Die Weisheit dieses Baumes ist unendlich. Wie groß ist deine? Abgesehen davon, dass mir die Formulierungen nicht zusagen, zweifle ich daran, dass ein Baum Weisheit und eine Seele besitzt. Ich darf auch Plakate für seine Vorträge entwerfen und stelle mir dabei vor, was das wohl für Leute sind, die in solch einen Vortrag gehen. Tragen sie Anzug, Jeans oder orange Wallekleider?
Aber jetzt muss ich auf Klo und zwar dringend! Ich bitte um Entschuldigung und verlasse eilig das Büro. Dabei hasse ich es, während der Arbeitszeit auf Toilette zu müssen. Meine Kolleginnen rennen oft aufs Klo, aber mehr, um zu tuscheln und sich zu schminken. Ich gehe nur dorthin, um mir die Hände zu waschen, bevor ich einen Apfel oder mein Brot esse. Doch heute muss ich. Ich hätte keinen Kaffee trinken dürfen, weil ich weiß, dass er treibt. Vor der Klobrille, auf der so viele vor mir gesessen haben, ekle ich mich. Deshalb mag ich sie weder mit meinen Händen noch mit meinen Beinen berühren.
Ich bleibe gebeugt in der Hocke stehen. Mir ist plötzlich übel. Vielleicht liegt das am Fisch, den es zum Mittag gab. Er war pappig und schmeckte überhaupt nicht. In diesem Moment stürzt Durchfall aus mir heraus und ich fange vor Ekel an zu weinen. Wie soll ich mich hier in der Bürotoilette ordentlich säubern? Der Waschraum lässt sich nicht zusperren. Entsetzlich! Ich drehe mich um und betrachte die scheußliche Bescherung, denn weil ich mich nicht auf die Klobrille setzte, muss ich jetzt viel Unangenehmes reinigen. Ich reiße meterweise Papier von der Rolle und mein Ekel wird zu Wut.
Der Baum-Umarmer ist schuld! Das Gespräch mit ihm hat mich maßlos aufgeregt und bei Aufregung bekomme ich meist Durchfall. Beim Putzen denke ich mir Sätze aus, die ich ihm sagen werde, damit er weiß, was er mit seiner Baumgeschichte angerichtet hat. Aber als ich eine Viertelstunde später ins Büro zurück komme, ist der Baum-Mann inzwischen gegangen.
Um alles richtig zu machen, habe ich natürlich im Internet recherchiert und herausgefunden, dass es erstaunlich viele Leute gibt, die in ihrer Freizeit in den Wald fahren, um in einer Gruppe Barfußläufer beim Umarmen der Bäume den Sinn des Lebens zu entdecken.
Ich sehe den Sinn meines Lebens nicht im Umarmen von Bäumen. Aber ich erinnere mich plötzlich an Daniel und seinen Baum und ich nehme mir vor, den Baum, den Daniel so liebte, zu besuchen.
Jennifer
Jenni hat mich und unsere Mutter in ihre Wohnung in die Stadt eingeladen. Normalerweise bringe ich einen Strauß Blumen mit, wenn ich jemanden besuche, aber Jenni hält frische Blumen für Verschwendung, weil sie kaum eine Woche halten.
Sie mag nur pflegeleichte Grünpflanzen in Töpfen wie Weihnachtskaktus, Efeutute und Grünlilie, am liebsten Kunstblumen. Ich mag bunte Sträuße, die in der Küche und auf meinem Schreibtisch stehen.
Mama mag überhaupt keine Blumen und Pflanzen.
Und schon gar nicht will sie, dass irgendwelche Nachbarn in ihre Wohnung kommen, um Blumentöpfe zu versorgen, wenn sie verreist ist. Niemand soll sich in ihrer Wohnung umschauen, nicht einmal ich. Trotzdem bringe ich jedes Mal, wenn ich die Eltern besuche, eine Topfpflanze mit, damit es nicht so kahl aussieht in ihrer Wohnung. Aber es ist zwecklos, denn Mama hat einfach kein Talent zum Hegen und Pflegen. Sie gießt entweder zu spät oder zu viel. Alles, was bei mir wächst und wuchert, geht bei ihr ein.
Auf dem Tisch stehen drei Sektgläser und eine Schale mit Keksen. Mama blinzelt mir zu. Sie weiß offenbar, was uns Jenni erzählen wird. Ich dagegen bin völlig ahnungslos. Geburtstag hat sie jedenfalls nicht.
Kurz denke ich an ihren letzten Geburtstag, als sie uns eröffnete, dass sie Bungeejumping machen will. Als ich mir vorstellte, wie sie nur von einem Gummiseil gehalten in die Tiefe springt, fing ich an zu zittern. Warum will sich ein Mensch freiwillig von einer Plattform aus dreißig oder sechzig Meter in die Tiefe stürzen? Wozu ist das gut? Reiner Übermut? Oder eine Mutprobe? Wem will Jenni etwas beweisen? Auch wenn es dabei höchst selten Unfälle gibt, so sind doch gesundheitliche Folgen ein großes Risiko. Die Eltern, Olaf, ihre vielen Freunde, das gesamte Dorf würde um sie trauern - und ich natürlich. Um mich würde Oma trauern, auch Papa, aber ich mache derartigen Irrsinn nicht.
Jenni breitet ihre Arme aus und dreht sich vor uns im Kreis.
„Na, wie sehe ich aus?“
„Hübsch wie immer“, sagt Mama lächelnd.
Ich räuspere mich und nicke eifrig, weil ich ganz genau weiß, dass Jenni nur Zustimmung hören will und nicht meine ehrliche Meinung.