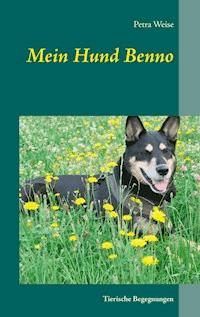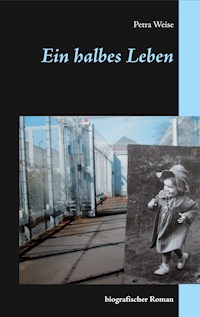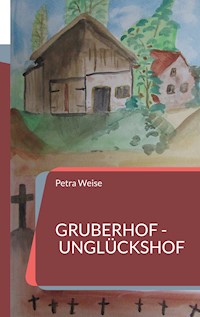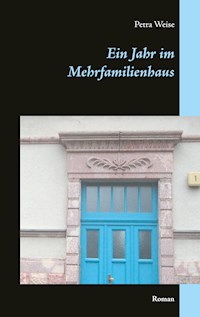Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ich bin Hanna und von daheim weggelaufen, als meine Mutter starb. Damals war ich fünfzehn und trieb mich zwei Jahre lang auf Münchens Straßen herum. Meine Freundin hat mich vor den Männern gewarnt, doch ich glaubte ihr nicht und habe alles falsch gemacht. Erst durch ein Unglück finde ich zurück zur Familie und erfahre ein schreckliches Familiengeheimnis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wer etwas durch Lügen erreicht hat,
wird es durch die Wahrheit verlieren.
Inhalt
Kindheit
Caritas
Robert
München
Navid
Bruch
Unfall
Chemnitz
Kirgisien
Lukas
Erzgebirge
Enthüllung
Chemnitz
Urlaub
Antrag
Verhör
Nora
Schluss
Was war das für ein Geräusch? Ist ein Fremder in meiner Wohnung? Panisch stürze ich aus dem Bett und schließe mich im Bad ein. Zitternd hocke ich vor der Heizung und klammere mich daran fest, als könnte sie mich beschützen. Ich kann keinen klaren Gedanken fassen und lausche an der Tür.
Nichts. Ich höre nichts. Keine Schritte und auch keine Stimmen. Trotzdem wage ich nicht, die Tür zu öffnen. Ich müsste nach den Mädchen schauen und prüfen, ob bei ihnen alles in Ordnung ist, ob sie friedlich schlafen. Aber ich traue mich nicht. Was bin ich nur für eine Mutter, die sich im Bad einschließt, statt ihre Kinder zu beschützen?
Es klopft an die Badtür.
„Hanna!“, ruft eine Männerstimme!
Woher weiß der Typ meinen Namen? Ich lösche das Licht, öffne das Fenster und schaue hinunter auf die Straße. Es ist kein Mensch zu sehen. Soll ich trotzdem um Hilfe rufen? Man soll nicht Hilfe schreien, sondern Feuer. Da stürzen die Leute aus ihren Häusern, um sich selbst zu retten und könnten am Ende auch mir helfen.
„Ist alles in Ordnung?“
„Verschwinden Sie! Mein Mann kommt gleich.“
„Hanna! Dein Mann ist gestorben.“
Was redet der Kerl? Ich habe gar keinen Mann. Ich wollte nur, dass er sich nicht sicher fühlt und gleich wieder verschwindet.
„Wer sind Sie?“, keuche ich atemlos.
Ich höre den Kerl lachen. Ein Perverser! Er wird mir Böses tun. Oder meinen Mädchen! Vielleicht haben sie ihn längst gehört, kommen ahnungslos in ihren Nachthemdchen angetapst und laufen dem Typ direkt in die Arme.
Und schon höre ich Anni rufen: „Mami! Mami!“
Sie ist noch viel zu klein, um vorsichtig zu sein. Die Angst um Anni ist auf einmal größer als die Angst um mich. Ich greife meine Nagelschere, öffne hastig die Tür und stoße dem Mann blitzschnell die Schere in den Bauch.
„Au!“, schreit er auf. „Bist du verrückt geworden?“
Sanft nimmt er mir die Schere aus der Hand und ich erkenne meinen Freund Lukas, mit dem ich seit über einem Jahr zusammenlebe. Gott, ist mir das peinlich.
„Nichts. Nur blöd geträumt.“
„Wieder von diesem schrecklichen Unfall?“
Ich sage Ja, obwohl das gelogen ist. Lukas glaubt, mein Mann wurde von einem Auto überfahren. Aber es gab keinen Unfall und verheiratet war ich auch nie.
Mich plagt ein ganz anderer Albtraum, es ist immer der gleiche: Es ist Nacht. Ein Mann verfolgt mich. Ich kann ihn nicht sehen, weil es stockdunkel ist, höre nur seine Schritte, die immer näher kommen.
Er packt mich und zischt: „Endlich habe ich dich!
Deine Untat wirst du mir büßen! Ich habe sie nicht vergessen“, und stößt mich auf die Straße. Dort bleibe ich liegen und taste nach meinem Kopf, der schrecklich weh tut. Meine Hand ist voller Blut. Ich sehe, wie ein Auto auf mich zurast. Es kommt schnell näher, aber ich bewege mich viel zu langsam wie in Zeitlupe und spüre bereits den Aufprall.
Ich schreie und werde wach.
Manchmal mag ich gar nicht einschlafen, weil ich mich vor diesem Traum fürchte. Lukas glaubt, ich habe gesehen, wie mein Mann überfahren wurde und ist voller Mitgefühl, weil ich dieses Geschehen nicht vergessen kann.
Ich träume auch vom Krieg, von Schüssen, Bomben, zerstörten Häusern und schreienden Menschen. Dabei habe ich nie einen Krieg erlebt und schaue keine Kriegsfilme. Ich weiß nicht, was diese Träume auslöst, vielleicht die Nachrichten im Fernsehen. In denen wird ständig vom Krieg berichtet. Etwas Erfreuliches hört man nie.
„Du solltest endlich zum Arzt gehen.“
„Und der gibt mir ein Mittelchen, mit dem ich nicht mehr träume?“
„Hanna, so geht das nicht. Du kommst keine Nacht zur Ruhe.“ Lukas schlingt seine Arme um mich und schon werde ich ruhiger. „Du musst eine Therapie machen, um deine Vergangenheit zu verarbeiten.“
Verarbeiten. Wenn ich dieses Wort höre, geht mir die Galle hoch.
„Dort werde ich gefragt, wo und wann der Unfall passierte. Du weißt, dass ich nicht darüber sprechen darf.“
Natürlich plagt mich die Erinnerung an ein schlimmes Erlebnis aus meiner Vergangenheit, aber nicht mit einem Auto. Ich habe getötet. Vielleicht. Doch eine Mörderin bin ich nicht. Ich kann diese Nacht nicht vergessen, mag aber auf gar keinen Fall darüber nachdenken und schon gar nicht darüber sprechen. Ich will endlich vergessen, damit mich die Angst vor Entdeckung nicht mehr jede Nacht wach rüttelt.
Und weil ich vergessen will, lebe ich hier in Chemnitz. Hier kennt mich keiner, jedenfalls keiner von früher. Außerdem begegnet man bei 250.000 Einwohnern höchst selten einem bekannten Gesicht, kaum den Nachbarn hier im Viertel. Obwohl ich Chemnitz zuvor nicht kannte, habe ich mit dem Umzug in diese Stadt zufällig den allerschönsten Stadtteil erwischt. Schloßchemnitz. In unmittelbarer Nähe gibt es den Küchwald, Parks, die lustige Parkeisenbahn, viele Spielplätze, Gasthöfe und wunderschöne alte Häuser. Wir leben direkt am Chemnitzfluss und fühlen uns wohl hier.
„Gehen wir wieder ins Bett?“, hauche ich. „Ich sehe nur schnell nach Anni.“
Anni ist meine Jüngste, seit Donnerstag zwei Jahre alt. Ab nächsten Montag darf sie in den Kindergarten. Dann habe ich endlich mehr Zeit für mich.
Bereits in der letzten Woche durfte ich sie mit zum Kindergarten nehmen, als ich ehrenamtlich zwei Stunden am Nachmittag auf die Kinder aufpasste.
Ich will das jetzt jede Woche machen. Das steigert mein Ansehen und kommt mir irgendwann zugute. Meine Große besucht die gleiche Einrichtung. Ich habe den Platz für Nora ohne Wartezeit bekommen, weil ich alleinstehend bin.
Ich gebe Anni einen Kuss und decke sie zu. Sie schläft sofort wieder ein. Dann schlüpfe ich zu Lukas ins Bett.
„Hast du wieder an deinen Mann gedacht?“, fragt er mitfühlend.
Ich nicke.
„Gibt es immer noch keine neuen Erkenntnisse über den Unfall?“
„Nein. Die wird es auch nie geben. Du weißt ja, dass ich nicht einmal seine Leiche sehen durfte.“
Lukas umarmt mich und schaut mich dann mit gerunzelter Stirn an.
„Und wenn er gar nicht tot ist?“
„Wie meinst du das?“
„Du hast gesagt, dass es keine Beerdigung gab.“
Ich seufze.
„Lass uns nicht mehr darüber reden! Ich mag nicht so gern daran denken.“
Lukas umarmt mich noch einmal, löscht das Licht und schläft sofort ein, während ich noch lange wach liege. Mein ganzes Leben zieht nachts durch meinen Kopf, aber nicht geordnet, sondern durcheinander. Ich bin gleichzeitig ein Kind und eine Frau, die Kinder hat, die einen Mann liebt, während sie mit einem anderen verheiratet ist. Ich lebe in München und in fernen Ländern und weiß nie, was in die Wirklichkeit und was zur Fantasie gehört.
Lukas lernte ich in Noras Kindergarten kennen. Er machte dort ein Praktikum, weil er vom Sozialarbeiter zum Erzieher umschult, um mehr Geld zu verdienen und vor allem, um geregelte Arbeitszeiten zu haben. Hier in Sachsen ist jeder zehnte Erzieher in Kindergärten ein Mann. Das finde ich sehr ungewöhnlich, denn Männer interessieren sich höchst selten für soziale Berufe. Das war schon immer so. Trotzdem erlernen inzwischen etwa zwanzig Prozent der Männer einen sozialen Beruf wie Psychologe, Erzieher oder Altenpfleger.
Kindheit
Geboren wurde ich 1997 in Garching bei München. Meine Mutter gab Zeichen- und Malkurse in der Volkshochschule, Vater arbeitete im Max-Planck-Institut, vermutlich heute noch. Meine Eltern gingen abends oft mit Freunden aus. Ich war viel allein.
Geschwister habe ich nicht. Nur zwei Cousins, die Söhne meiner Tante Toni. Ferdinand, also Ferdl, ist genauso alt wie ich und war mein innigster Spielkamerad. Doch als sein Bruder Georg auf die Welt kam, durften wir uns nicht mehr sehen. Den Grund dafür kenne ich bis heute nicht. Wir trafen uns manchmal heimlich draußen beim Spielen oder in der Schule. Doch Ferdl hatte sich verändert. Er lachte kaum und hatte keine Lust auf lustige Streiche. Manchmal stieß er sogar mit den Füßen nach mir. Einmal flüsterte er mir zu, dass er bald von daheim wegläuft, weil seine Mutter ihn jeden Tag schlägt, obwohl er nichts Schlimmes getan hatte.
„Wo willst du dich verstecken? Und wer macht dir etwas zu essen?“, wollte ich wissen.
Seine Antwort „Das geht dich nichts an“, verletzte mich so sehr, dass ich nicht mehr mit ihm sprach. Noch schlimmer war, dass es ihm nichts ausmachte, dass ich nicht mehr mit ihm sprach. Er ging mir einfach aus dem Weg und spielte mit anderen Kindern.
Als ich klein war, saß ich oft in Mutters Atelier auf dem Boden und schaute ihr beim Malen zu. Ich wollte bei ihr sein, obwohl sie mich nie bemerkte. Mutter malte Vögel mit langen Schnäbeln, starren Augen und bunten Flügeln. Überall im Raum standen ihre Leinwände mit all den Vögeln. Ich mochte sie nicht, weil ich jede Nacht träumte, wie sie mit ihren Flügeln schlugen, mich anstarrten und mit ihren scharfen Schnäbeln nach mir hackten.
Als ich in die Schule kam, hörte ich auf, Mutter beim Malen zuzusehen. Ich freundete mich mit Franzi an und war häufiger bei ihr als daheim. Ihre Mutter kochte Mittag und wartete mit dem Essen auf uns. Sie zeigte mir, wie man die Gabel hält und dass der Ellenbogen nicht auf den Tisch gehört.
Meine Mutter kochte nicht gern, eigentlich überhaupt nicht. Sie war trotzdem lieb und fürsorglich, doch wusste sie nichts mit mir anzufangen. Wenn ich zum Beispiel über Bauchweh klagte, schaute sie mich besorgt an, aber sie tat nichts dagegen, kochte keinen Tee, steckte kein Wärmekissen an und tröstete mich nicht. Ich wusste, dass sie so etwas hätte machen müssen, denn genau das tat Franzis Mutter.
Dafür konnte Franzis Mutter nicht so schön malen wie meine. Mutter wollte, dass ich mich für Malerei begeistere, aber dazu hatte ich überhaupt keine Lust, bis heute nicht.
Mutter liebte es, in der Sonne zu liegen und verbrachte viele Stunden in ihrem Liegestuhl auf dem Balkon. Die Sommer verlebte sie immer an der italienischen Riviera. Vater mag das Meer nicht, er liebt Wanderungen in den Bergen. Ich hasse das Meer, aber ich liebte meine Mutter und fuhr jeden Sommer mit ihr nach Rapallo, während Vater in Garching blieb. Erst im Oktober nahm er Urlaub, weil das die beste Zeit für Wanderungen in den Alpen ist. Doch Mutter bekam nur während der Ferien Urlaub – so wie ich.
*****
Als ich fünfzehn Jahre alt war, starb meine Mutter. Ich fand sie damals, wie sie friedlich in ihrem Bett lag und schlief. Ich ließ sie einfach schlafen. Doch als am Abend Vater nach Hause kam, schlief sie immer noch. Ich wollte sie wecken, damit sie nicht zu spät zu ihrem Malunterricht in der Volkshochschule kam. Ich küsste, streichelte und rüttelte sie, doch sie wurde nicht wach. In meinen Ohren drückte es, als ob sie platzen wollten. Schließlich ertönte ein irrsinnig lauter Pfeifton, der meinen ganzen Kopf zu zerspringen drohte. Ich presste die Hände gegen die Schläfen, aber es nützte nichts.
Vater schob mich zur Seite. Ich verstand seine Worte nicht, weil seine Stimme klang, als wäre er unter Wasser. Mein Kopf dröhnte immer lauter. Ich hörte das Blut in den Ohren rauschen und stellte mir vor, dass es gleich aus ihnen herausfloss. Aber es kam nicht heraus. Es klopfte nur heftig von innen gegen die Schädeldecke.
Irgendwann legte jemand eine Decke um mich, weil ich nicht aufhören konnte zu zittern.
Getrauert habe ich nicht. Ich spürte nur Schmerzen im ganzen Körper. An die Beerdigung kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß nur noch, dass den ganzen Tag die Sonne schien, was mich wütend machte. Die Leute auf den Straßen hatten entsetzlich frohe Gesichter, die ich einfach nicht ertrug.
Mutters jüngere Schwester Betti strich mir ständig über den Kopf und küsste mich, während mich die ältere Schwester Toni an meinen Schultern packte und vor sich her schob. Sie tat mir weh. Deshalb lief ich einfach weg, setzte mich ins Eiscafé und bestellte einen Schokobecher mit Blaubeeren und viel Sahne, danach noch ein Pizza Eis. Mir war schrecklich übel. Doch ich war zufrieden, weil mir das viele Eis so furchtbar schwer im Magen lag und nicht die Beerdigung meiner Mutter.
Ich hätte dringend Franzi gebraucht, doch sie war mit ihren Eltern und Brüdern nach Frankreich gezogen. Natürlich habe ich sie angerufen. Aber ein Anruf ist nicht das gleiche wie ein Gespräch, wenn sie mir gegenüber sitzt. Wir haben noch ein halbes Jahr per WhatsApp geschrieben, aber dann hörte auch das auf.
Tante Toni erzählte jedem, der es hören wollte, Mutter habe sich selbst getötet, Schlaftabletten geschluckt und dazu eine ganze Flasche Obstler getrunken. Ich glaubte das lange nicht, denn Mama trank nur Wein, am liebsten Wermut. Ich mochte Tante Toni nicht. Sie behauptete, Mama und Betti wären verrückt und ich wäre es auch. Mit Verrückten wollte sie nichts zu tun haben. Toni sagte, Teenager wie ich treiben ihre Eltern zur Verzweiflung. Deshalb war ich überzeugt, Mutter habe sich wegen mir umgebracht.
Ich sprach mit niemandem darüber, weil mich die Schuld fast erdrückte. Ich suchte Trost bei Vater. Doch der kam nur noch selten heim, weil er es in der leeren Wohnung nicht aushielt. Toni behauptete, dass er sich jeden Tag mit einer anderen Frau trifft, aber das glaubte ich nicht. Ich hörte ihr gar nicht mehr zu, weil sie den ganzen Tag schimpfte: Auf mich, Vater und Tante Betti. Betti verschwand für viele Wochen in einer Klinik. Toni sagte, weil sie verrückt ist. Ich dagegen war sicher, sie war unfassbar traurig über Mamas Tod und hatte niemanden, der ihr beistand. Nur mich.
Großeltern gab es keine. Mutters Eltern lebten schon viele Jahre nicht mehr und Vaters Eltern kamen nicht einmal zur Beerdigung. Sie waren nach Teneriffa ausgewandert.
Ich war ganz allein. An nichts hatte ich Freude, saß nur den lieben langen Tag in einer Ecke und hoffte, dass mich niemand bemerkt.
*****
Vater erwartete, dass ich Abitur mache und danach studiere. Doch Schule war für mich immer ein rotes Tuch. Ich hasste es, mir den ganzen Tag dummes Zeug anzuhören, das kein Mensch braucht. Und ich hasste Garching. Es ist flach, trist und von zwei Autobahnen umschlossen. Es gibt zwar mehr Studenten als Einwohner, aber die sieht man nicht in der Stadt.
Wenn Vater wütend auf mich war, schimpfte er: „Du bist genau wie deine Mutter!“
Auch Mutters Schwestern sagten oft, dass ich ihr immer ähnlicher werde. Da bekam ich Angst, dass ich tatsächlich so werde wie sie, obwohl ich genau wusste, dass ich ganz anders war, auch wenn ich so aussah wie sie. Ich hatte die gleichen blonden Haare, blaue Augen, eine etwas zu kleine Nase und einen zu großen Mund mit vollen Lippen.
Die Haare meines Vaters waren bunt, wirkten in der Sonne blond, im Schatten fast schwarz und bei künstlichem Licht sogar rot. Seine Augen waren mal braun, mal gelb und manchmal grün. Ich fand das komisch und war froh, dass ich nicht so aussah wie er, sondern wie meine Mutter ausgesehen hatte.
Damals waren für mich die Nächte schlimmer als die Tage. Ich hatte keine Angst im Dunkeln, aber ich sah Dinge, die es gar nicht gab. Ich wusste, dass es sie nicht gab, doch ich sah sie trotzdem. Oft sah ich Mama, obwohl sie tot war und in einer Kiste unter der Erde lag. Deshalb wollte ich meine Augen nicht schließen und auch nicht schlafen. Ich lief viel lieber die ganze Nacht draußen umher. Und eines Nachts kam ich überhaupt nicht mehr nach Hause zurück.
Ich ging nie wieder zurück nach Garching und auch nicht in die Schule, sondern trieb mich in München herum und lebte fast zwei Jahre lang bei verschiedenen Freunden oder in leeren Häusern mit anderen Jugendlichen auf der Straße. Weil ich kein Geld hatte, durfte ich nirgendwo lange bleiben. Es war kein Luxusleben, aber ich fühlte mich frei und sehr erwachsen.
Caritas
Wieder einmal stand ich mit meinem Plastikbeutel auf der Straße, weil mich wieder einmal Freunde zum Teufel schickten. Wo sollte ich hin? Es war Mitte Dezember und es pfiff ein eiskalter Wind. Mir fiel nur die Bahnhofsmission ein, von der mir schon einige Straßenkinder erzählt hatten, dass man sich dort aufwärmen konnte und sogar Essen bekam.
Ich ging hin und stand unschlüssig in der Tür.
„Komm rein!“, forderte mich eine alte Frau auf.
„Möchtest du einen heißen Tee?“
Dankbar schaute ich sie an und wärmte meine eiskalten Hände an der Teetasse. Schluck für Schluck ging es mir besser.
„Hast du Appetit auf Linseneintopf? Der schmeckt heute besonders gut.“
Natürlich hatte ich Hunger und ich wusste auch, dass man deutlich sagen musste, was man will. Ich hatte auch keine Probleme damit zu betteln, doch meiner Erfahrung nach bekam man viel mehr Hilfe, wenn man sich ängstlich gab und nichts verlangte. Deshalb nickte ich nur und sah schüchtern zur Seite. Im Eintopf schwammen viele Wurstwürfel, die lecker schmeckten und wunderbar satt machten. Es gab sogar eine Scheibe Brot dazu.
Die Alte erzählte von ihrer Jugend, wie schwer es für sie war und dass sie vier Monate auf der Straße leben musste. Das hat sie geprägt, weshalb sie so gern in der Mission arbeitet. Die Caritas habe sie gerettet, weil sie dort Essen, Kleidung und sogar ein Zimmer bekam, auch eine nützliche Aufgabe.
Sie putzte, verteilte Essen und sortierte Altkleider.
Möglicherweise waren diese Aufgaben nützlich, doch nichts für mich. Wer hat schon Lust zum Putzen?
„Die Caritas betreibt auch Mädchenwohnheime, wo du unterkommen kannst.“
Mädchenwohnheim, das klang gut. Ich machte mich sofort auf den Weg. Das Haus war zugesperrt und machte einen verratzten Eindruck. Von der Tür blätterte die Farbe ab. Ich klingelte und lächelte die Frau an, die mir öffnete. Ich verstand es, mit dem Mund schüchtern zu lächeln und gleichzeitig traurig zu schauen. Das half immer, vorausgesetzt, ich war wie jetzt frisch gewaschen.
„Mein Name ist Hanna. Mich schickt eine sehr nette alte Dame aus der Bahnhofsmission. Sie sagt, ich könne hier wohnen.“ Wieder lächelte ich. „Darf ich hereinkommen?“, fragte ich zaghaft.
„Du hast Glück, denn vorgestern wurde ein Zimmer frei. Es kostet nur 350 € im Monat.“
„So viel?“ Entsetzt trat ich einen Schritt zurück. „Ich habe kein Geld.“
„Nichts ist umsonst im Leben. Wir vermieten nur an Schüler, Praktikanten und Lehrlinge, die ein regelmäßiges Einkommen haben.“
Leider hatte ich weder Papiere noch Geld und schon gar keine Ausbildung.
Deshalb fing ich sofort an zu weinen.
„Mein Vater hat mich vor die Tür gesetzt, als meine Mutter starb“, schluchzte ich. „Ich durfte nichts mitnehmen. Keine Kleider, kein Geld und auch keinen Ausweis.“
Meine Verzweiflung war echt, obwohl ich längst auf Knopfdruck Tränen vergießen konnte, um Mitleid zu bekommen. Ich sagte nicht, dass meine Mutter bereits vor zwei Jahren starb und auch nicht, dass ich freiwillig von daheim weglief. Doch ich weinte.
Die Tränen kamen von ganz allein. Mir war elend zumute, weil ich nicht wusste, wohin ich gehen soll, wenn mich die Frau wegschickt. Das Herumziehen hing mir längst zum Hals heraus. Draußen war es bereits dunkel und ganz bestimmt sehr kalt.
Die Frau nannte mir die Adresse einer Notunterkunft, wo man mich drei Tage bleiben lässt. Ich tat, als hätte ich nichts verstanden und bettelte weiter.
„Vielleicht kann ich für die Miete arbeiten. Putzen oder so“, schlug ich vor.
„Das Zimmer ist leer“, mischte sich eine andere Frau ein.
„Über Weihnachten wird es Neuzugänge geben. So viel Platz haben wir nicht.“
„Aber jetzt ist das Zimmer leer. Da Hanna arbeiten will, könnten wir es mit ihr versuchen“, wiederholte die andere Frau. „Bald ist Weihnachten. Da sollten wir barmherzig sein.“
Ich durfte bleiben und bezog ein warmes kleines Zimmer mit sauberer Bettwäsche. Viel Arbeit gab es nicht, da die Bewohner die Gemeinschaftsräume selbst putzen mussten. Auch die Küche hatte jeder nach dem Benutzen gründlich zu reinigen.
Die nette Frau riet mir, eine Ausbildung als Hauswirtschafterin zu machen. Vom Lehrgeld könnte ich leicht das Zimmer bezahlen. Das Gute daran war, dass die Caritas als Ausbilder auftrat, das Schlechte, dass ich keine Papiere hatte. Ein Lehrvertrag war nur möglich, wenn ich meinen Hauptschulabschluss und die Geburtsurkunde besorge und den Personalausweis beantrage. Mit sechzehn Jahren besteht Ausweis- und Meldepflicht. Mit sechzehn war ich daheim weggelaufen und hatte ganz andere Probleme, als einen Ausweis zu beantragen.
Doch nun musste ich meine Unterlagen holen und möglichst etwas Geld. Ich beschloss, von Vater mindestens fünfhundert Euro zu verlangen. Er hatte zwei volle Jahre Ruhe vor mir und war mir einiges schuldig.
Allerdings vermutete ich, dass Vater inzwischen weggezogen war, denn er hasste Altbauten. Mutter nicht. Sie liebte die hohen Decken, die breiten Flure, unseren Erker mit der Sitzbank und dem großen runden Tisch, die große Küche, ihr Atelier mit den wunderschönen Bogenfenstern, den besonderen Charme einer Altbauwohnung. Aber Mutter war nicht mehr da.
Am Klingelschild stand ein fremder Name. Ich läutete trotzdem.
„Was willst du?“, fragte barsch eine ziemlich dicke Frau.
„Meine Sachen. Ich habe hier mal gewohnt.“
„Hier gibt es keine Sachen. Geh weiter!“
Die Frau schlug so heftig die Tür zu, dass es dumpf im Hausflur widerhallte.
*****
„Ich bin Birger“, stellte sich ein junger Mann vor.
So einen seltsamen Namen hatte ich noch nie zuvor gehört. Birger stammte aus Sassnitz, ein Ort, der auf der Ostseeinsel Rügen liegt. Er konnte nicht glauben, dass ich noch nie zuvor von der Insel hörte und war fassungslos, weil ich die See nicht mag.
„Nirgendwo auf der Welt ist es schöner als am Meer“, schwärmte er und erzählte von Kreidefelsen und einer Aussichtsplattform mit Blick auf die Ostsee.
Was gibt es da zu sehen? Nur Wasser! Das musste ich während meiner gesamten Kindheit in jeden Sommerferien ertragen.
„Wasser ist überall gleich: kalt und nass“, maulte ich.
„Du kannst auf Rügen auch durch Buchenwälder wandern. Es ist wunderschön.“
Im Wald gibt es nur Bäume, das war nie meine Welt. Aber ich sagte nichts mehr, um Birger nicht zu verärgern.
„Ich bin hier, um dir zu helfen“, verkündete er stolz.
Wobei will er mir helfen? Ich hatte nichts zu tun.
„Ich studiere Rechtswissenschaft und kenne mich in allen Gesetzen aus. Bei der Caritas arbeite ich ehrenamtlich.“
Mir war noch immer nicht klar, was das mit mir zu tun hatte. Doch schnell stellte sich heraus, dass mich Birger bei allen Amtswegen begleiten sollte und mir helfen, meine Identität nachzuweisen und einen Ausweis zu beantragen.
Ich weiß nicht, ob es an Birger lag oder daran, dass die Ämter einfach ihre Arbeit machten. Jedenfalls schickte mir die Schule mein Zeugnis zu, das gar nicht mal so übel aussah und den Abschluss der 9. Klasse bewies. Vom Meldeamt erhielt ich meine Geburtsurkunde, mit der ich den Ausweis beantragen konnte. Nun stand meiner Ausbildung nichts mehr im Wege.
Obwohl das erste Lehrjahr bereits seit vier Monaten lief, durfte ich sofort einsteigen. Ich arbeitete in der Küche und der Wäscherei im nahen Altenheim und ging zweimal pro Woche zur Schule. Die Arbeit war nicht schwer, aber langweilig und gleichzeitig abwechslungsreich. Ich mochte nur das Kochen und natürlich das Essen.
Ganz besonders gern mochte ich Birger.
Birger war mein erster Freund. Er fühlte sich für mich verantwortlich, was ich so zuvor noch nicht kannte. Mir gefiel, dass er mir alles um mich herum erklärte und begründete, warum es so ist wie es ist und was man dagegen tun kann. Ich musste nicht viel sagen, weil Birger meist schon vorher wusste, was ich sagen wollte. Ein guter Anwalt muss wohl so sein. Ich habe ihn deshalb sehr bewundert.
„Wenn ich fertig studiert habe und Anwalt bin, werde ich für dich sorgen. Dann hast du keine Not mehr.“
Das machte mich glücklich. Er sagte, dass das Leben voller Tücken und Fallen ist, die er alle kennt und vor denen er mich beschützt. Meine zwei Jahre Erfahrung auf der Straße taugten seiner Meinung nach nichts fürs wirkliche Leben. Was auch immer in meinem Leben schief geht, er wäre für mich da und würde mich überall verteidigen.
Deshalb war ich ihm sehr dankbar und liebt ihn umso mehr.
Wenn Birger bei mir übernachtete, mussten wir leise sein, da Männerbesuche über Nacht nicht erlaubt waren. Trotzdem war es besser, als zu ihm in die Studentenbude zu gehen. Dort saßen seine Freunde einfach auf seinem Bett. Mehr Platz war ja nicht, aber mir verging jedes Mal die Lust auf eine Umarmung, wenn fremde Leute in Jeans auf seiner Decke saßen und ihre nackten Füße aufs Kopfkissen legten.
Birger fand das seltsam, denn ich hatte ihm einige der schmutzigen Plätze gezeigt, in denen ich früher übernachtet hatte oder wohin ich bei schlechtem Wetter gekrochen war. In solchem Schmutz wollte ich nie wieder hausen, weshalb für mich alles blitzsauber sein musste. Ich duldete keinen Krümel auf dem Tisch und keinen Fussel auf der Kleidung oder im Bett und nervte Birger damit.
*****
Fast genauso wichtig wie Birger waren mir meine Freundinnen Thea und Olli, mit denen ich in der Berufsschule lernte.
Olli hieß eigentlich Olivia, doch den Namen mochte sie nicht, weil sie Oliven eklig fand. Dabei bedeutet der Name die Friedliche. Sie war wie ich erst achtzehn Jahre alt, hatte aber bereits einen dreijährigen Sohn. Ihr Kind war ihre einzige Familie.
„Du musst doch Eltern haben, Großeltern, Tanten, Cousins“, wunderte sich Thea.
„Ich habe niemanden, weil ich direkt nach der Geburt ins Heim gegeben wurde, dort aufwuchs und mit sechzehn schwanger wurde.“
Thea riss ihre Augen auf vor Entsetzen.
„Habt ihr nicht geheiratet?“
„Wen meinst du?“
„Deinen Freund, den Vater deines Jungen. Hast du ihn nicht wahnsinnig doll geliebt?“
Olli lachte und verzog dabei ihren Mund.
„Sex hat nichts mit Liebe zu tun. Für uns war das wie Tischtennis spielen.“
Bestürzt schaute ich sie an. Ich könnte niemals mit einem Jungen ins Bett gehen, wenn ich ihn nicht mehr als alles andere auf der Welt liebe. So wie ich Birger liebte.
„Ihr seid naiv“, sagte sie und tippte sich mit dem Finger an die Stirn. „Ihr müsst den Burschen den Kopf verdrehen, dürft sie aber nicht zu nahe an euch heranlassen.“
„Ich warte bis zur Hochzeit“, verkündete Thea. „Die ist im nächsten Sommer.“
Olli verdrehte die Augen und wandte sich mir zu.
„Wenn sie dich einmal im Hollerbusch …“
„Hollerbusch?“
„Sagt man so. Ich meine, wenn du ihnen erlaubst, mit dir zu schlafen.“
Ich wurde rot.
„Meist erlischt danach das Interesse an dir.“
„Das verstehe ich nicht.“
„Und doch ist es so. Also halte dir die Mannsbilder vom Leib so lange es geht und verschwinde, bevor sie dich zum Teufel schicken.“
Olli hatte nur schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht und glaubte, dass alle Männer Schweine sind. Ich glaubte das nicht.