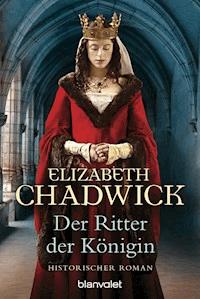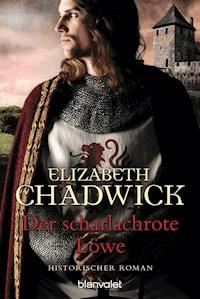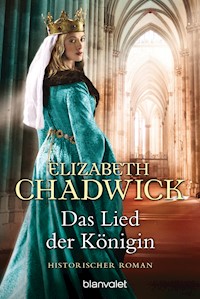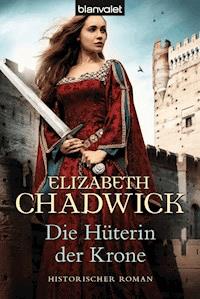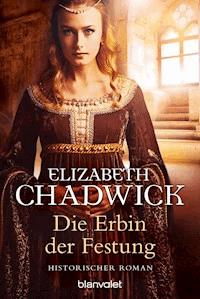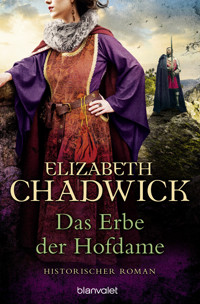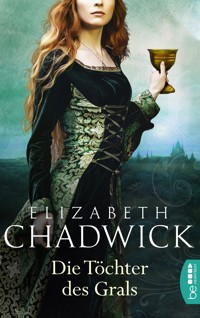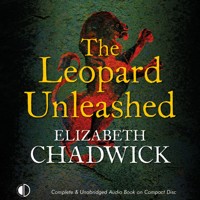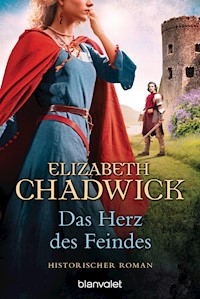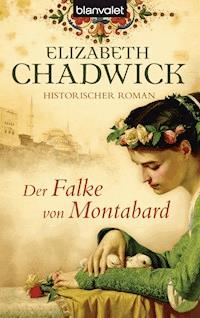
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Ein opulenter Mittelalterroman voller Gefühl und Dramatik!
England im 12. Jahrhundert: Der verwegene Krieger Sabin FitzSimon hat seinen guten Ruf gründlich verspielt. Da bietet ihm Ritter Edmond Strongfist an, ihn ins Heilige Land zu begleiten, um dort dem König von Jerusalem beizustehen. Mit auf die Reise geht Strongfists schöne und kluge Tochter Annaïs. Und als diese verheiratet wird, spüren Annaïs und Sabin plötzlich, dass sie mehr als nur Zuneigung füreinander empfinden ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 855
Ähnliche
Buch
Barfleur 1120: Sabin FitzSimon, illegitimer Sohn eines normannischen Earls, ist in Gefahr, seinen Ruf als geschickter und mutiger Krieger durch eine Reihe von Skandalen zu verspielen. Als er dabei ertappt wird, die Lieblingsmätresse des Königs zu verführen, kommt jede Rettung zu spät. Verprügelt von den Soldaten des Königs und in einem normannischen Hafen zurückgelassen, muss er sehen, wie er allein nach England zurückfindet. Doch dann bietet sich eine ungeahnte Möglichkeit, seine Ehre wiederherzustellen: Ritter Edmund Strongfist bricht ins Heilige Land auf, um dem König von Jerusalem seine Dienste anzubieten – und er willigt ein, Sabin mitzunehmen. Ebenfalls mit auf die Reise geht Strongfists Tochter Annaïs, ein schönes, scheues Mädchen, das in einem Nonnenkloster erzogen wurde. Dankbar für die Chance, die Strongfist ihm gibt, gelobt Sabine sich von Annaïs fernzuhalten – allerdings nicht ohne Bedauern, denn er fühlt sich zu der geistreichen, mutigen jungen Frau hingezogen und bewundert ihr begabtes Harfenspiel. Auch Annaïs bleibt nicht ungerührt von der Begegnung mit dem stürmischen Krieger. Doch das Schicksal will es anders: Annaïs wird mit einem angesehenen Edelmann verheiratet und Sabin Ritter an dessen Hof. Doch das Heilige Land befindet sich in einem Zustand völliger Zerrüttung. Als in den Wirren des Krieges der König gefangen genommen wird, geraten auch Annaïs und Sabin in den Strudel der Geschichte …
Autorin
Elizabeth Chadwick lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in Nottingham. Sie hat diverse historische Romane geschrieben, die allesamt im Mittelalter spielen. Elizabeth Chadwick wurde u. a. mit dem Betty Trask Award ausgezeichnet, und ihre Romane gelangten immer wieder auf die Auswahlliste des Romantic Novelists’ Award.
Inhaltsverzeichnis
1
Hafen von Barfleur,25. November 1120
Sabin FitzSimon stand in der hereinbrechenden Dunkelheit am Kai und beobachtete mit zusammengekniffenen grünbraunen Augen, wie die Mora, das Schiff von König Heinrich, in See stach. Ein eisiger Wind brach die stahlgrauen, silbern aufblitzenden Wellen, während die Galeere, die sich durch die Wellentäler quälte, langsam zu einer kleinen Schaluppe schrumpfte. Das leiser werdende Platschen der Ruder entlockte Sabin ein Lächeln, weil es den Erfolg seiner Ränke verkündete. Mit der Abreise des Schiffs aus der königlichen Flotte nach England war der Weg für ihn frei.
Die junge Frau an seiner Seite rückte an ihn heran, bis sich ihre Hüften berührten. Die Kapuze hatte sie zum Schutz gegen die Kälte tief ins Gesicht gezogen, doch vereinzelte Strähnen ihres kastanienbraunen Haars hatten sich unter dem Schleier gelöst und flatterten in dem Wind, der vom Meer her kam. Lora war noch unverbraucht, strahlte noch den Charme der Unschuld aus, die unter den Huren am Hof ein so flüchtiges Gut war – wer sollte das besser wissen als Sabin FitzSimon? Mit seinen zweiundzwanzig Jahren hatte er sie alle gehabt … oder fast alle. Die jungen Ritter am Hof erzählten sich, dass Sabin für jede Eroberung eine Kerbe in einen Stock schnitzte, aber das stimmte nicht. Für ihn war nicht die Erinnerung an diejenigen wichtig, die er gehabt hatte. Ihm ging es um die Jagd, und in diesem Fall hatte das Abenteuer einen besonderen Reiz, da Lora zu den Lieblingsmätressen von König Heinrich gehörte und Sabin somit im königlichen Revier wilderte.
Ein Träger mit einem Weinfass auf der Schulter tauchte aus einer der Tavernen am Hafen auf und marschierte breitbeinig auf eine vertäute Galeere zu. Im Zwielicht leuchtete der Plankengang des Schiffs wie Schwanenfedern, und der Bug war stolz und elegant geschwungen. Runde Schilde in kühnen Farben säumten den Setzbord, so dass der Freibord größer wurde und die Reisenden vor dem hochspritzenden Wasser schützte. Am Mast flatterten seidene Banner, deren Farben im letzten Tageslicht leuchteten. Es war die Blanche Nef, das weiße Schiff, der Stolz in König Heinrichs Flotte und das angemessene Beförderungsmittel für den Thronfolger, Prinz William, und die jüngeren Mitglieder des Hofes, die immer noch aufgeregt am Ufer herumkrakeelten.
»Sollen wir hineingehen?« Sabin deutete auf die Herberge, aus der der Träger herausgekommen war. »Wir könnten uns zurückziehen, bis wir an Bord gehen.« In seiner Stimme lag nichts Drängendes, doch sein Blick war vielsagend.
Sie sah ihn unter gesenkten Lidern von der Seite her an. In der Dämmerung schimmerten ihre Augen dunkel, doch er wusste, dass sie im Tageslicht blaugrün waren wie das Meer, in dem sich die Sonne spiegelte. »Wenn Ihr das wünscht«, antwortete sie. Die Förmlichkeit ihrer Worte täuschte nicht über den Übermut und die schiere Lust hinweg, die ihr Gesicht ausstrahlte. Wenn Loras Liste der Eroberungen nicht so lang war wie die von Sabin, dann nur, weil sie erst vor kurzem die Arena betreten hatte. Es war ihre Entscheidung, die Jagd fortzusetzen. Wenn sie gewollt hätte, hätte sie auf König Heinrichs Schiff mitsegeln können, statt ihre Zeit mit den Nachtschwärmern zu vertrödeln … insbesondere mit diesem einen.
Er fasste sie unter und wandte sich mit ihr in Richtung des Fackelscheins, der aus der Herberge drang. Trunkenes Lachen und laute Stimmen lockten das Paar, das über den mit Stroh vermischten Matsch auf die Tür zuging. Ihnen folgten die Blicke von drei bewaffneten und noch nüchternen Soldaten, die ebenfalls nicht auf König Heinrichs Schiff mitgesegelt waren.
Sabin hob die kichernde Lora auf seine Arme, trug sie über die Schwelle und setzte sie auf eine Bank. »Einen Krug von deinem besten Wein, wenn du noch welchen hast«, bestellte er beim Wirt. »Und etwas zu essen, damit wir nicht zu schnell betrunken sind.«
»Wir haben noch ein Fass, Mylord.« Der Wirt wischte sich die Hände an dem Tuch, das in seinem Gürtel steckte, ab. »Aber das ist für Prinz Williams Schiff bestimmt.«
Sabin kramte in seinem Beutel und zog eine Hand voll Silberstücke heraus – den Gewinn aus einem Würfelspiel. »Jetzt nicht mehr«, sagte er mit einem breiten Grinsen. »Einen Krug für mich und die Dame, und den Rest verteile unter den anderen.« Er warf einen Blick in die düsteren Ecken des Schankraums und schnaubte verächtlich, als er einen jungen Burschen sah, der zusammengesunken auf einer Bank lag, die schlaffe Hand noch um einen Krug geschlungen. Er ging zu ihm hinüber, packte den blonden Haarschopf und blickte in das Gesicht seines betrunkenen jüngsten Halbbruders. »Simon?«
Der Junge blinzelte wie eine Eule. »Iss es schon Zeit zu geh’n?«, nuschelte er und rülpste Sabin von dem sauren Wein ins Gesicht.
»Nein, ich wollte nur sehen, ob du noch lebst.« Sabin verzog seinen Mund zu einem spöttischen Grinsen. »Du hast ja schon so viel intus, dass du damit ein ganzes Schiff zu Wasser lassen könntest.«
»Iss ‘n guter Wein. Solltest mal probieren …« Simons Kopf kippte nach hinten auf die Bank. Speichel lief aus seinem offenen Mund, als er zu schnarchen anfing.
Sein Kopf würde am nächsten Morgen wie ein Glockenturm am Ostermorgen dröhnen, dachte Sabin schadenfroh. Wenn Simons Mutter und Stiefvater ihn jetzt sehen könnten, würden sie wütend werden – sowohl auf den Jungen als auch auf ihn. Immer wenn es Schwierigkeiten gab, wurde Sabin dafür verantwortlich gemacht, selbst wenn er ausnahmsweise mal unschuldig war.
Er überließ seinen Halbbruder dem Schlaf und ging zu Lora zurück. Das Klimpern der Silbermünzen hatte den Wirt dazu veranlasst, ein halbes gebratenes Huhn, einen Laib Weizenbrot und ein Kompott aus Äpfeln mit Honig heranzuschaffen. »Wenn du einen Platz hast, wo ich mit meiner Dame in Ruhe essen kann, werde ich sehen, wie weit meine Großzügigkeit reicht.« Zur Bekräftigung seiner Worte legte Sabin eine Hand auf den Beutel an seinem Gürtel.
Der Wirt hob wissend eine Augenbraue, stellte das Essen auf ein Tablett und ging zur Tür. »Hier entlang, Mylord«, sagte er.
Sabin packte ihn am Ärmel. »Und pass auf den Jungen dort auf.« Er drehte seinen Kopf zu Simon, der bewusstlos dalag.
»Als wäre er mein eigen Fleisch und Blut.« In der Verbeugung des Wirts lag eine Spur von Hohn. Dann führte er Sabin und Lora zu einem Zimmer im hinteren Teil der Herberge. Oberhalb der Schänke gab es einen großen öffentlichen Schlafsaal, doch der Wirt hatte scharfsinnig erkannt, welchen Gewinn er herausschlagen konnte, wenn er auch privatere Unterbringungsmöglichkeiten anbot. Seine Frau hatte ihn für verrückt gehalten, als er den alten Heuschober umbauen ließ. Jetzt kleidete sie sich in blaues flämisches Tuch und war dankbar für seinen Geschäftssinn.
Das Zimmer war freundlich eingerichtet: an einer der Wände eine Bank, in der Mitte eine Feuerstelle, in der Holzkohle glimmte, die den Vorteil hatte, dass sie nicht rauchte, eine bemalte Truhe und, das Wichtigste, ein breites Bett mit einer mit Federn gestopften Matratze. Der Wirt stellte das Tablett auf die Truhe und zündete in den Nischen rechts und links vom Bett Kerzen an. Mit einem gemurmelten Dank nahm er von Sabin das Geld entgegen und verließ unter Verneigungen das Zimmer.
Sabin wartete, bis das Schloss einrastete, dann drehte er sich mit einem fröhlichen Grinsen zu Lora. »Von diesem Moment habe ich schon seit Wochen geträumt. Du und ich und ein Bett.« Er nahm den Krug und schenkte zwei Becher Wein ein.
Lora trat auf ihn zu, nahm ihm den Becher aus der Hand, tauchte ihren Zeigefinger hinein und leckte ihn langsam der ganzen Länge nach ab. Im Schein der Kerze waren ihre Augen schwarz wie die Sünde. »Ich hoffe, es wird sich für mich lohnen«, schnurrte sie und tauchte ihren Finger wieder in den Wein, diesmal aber, um seine Lippen damit nachzuzeichnen. In Sabin loderte die Lust auf und am liebsten hätte er Lora gepackt, aufs Bett geworfen und sie, so wie sie war, wie eine Straßenhure genommen.
»Das wird es – in jeder Hinsicht!«, erwiderte er mit gepresster Stimme. Seine Lust schnürte ihm die Kehle zu. Mit zitternden Händen schob er ihre Kapuze zurück und zog die goldenen Nadeln aus ihrem Schleier. Ihre Zöpfe schimmerten wie die kupferfarbenen Blätter einer Buche im Spätsommer, und sie roch verführerisch nach Zimt und Rosen.
»Du weißt, dass es ein gefährliches Spiel ist, dem König die Beute abzuluchsen«, warnte sie ihn schelmisch. Ihr vom Wein feuchter Zeigefinger hinterließ eine rote Spur um seinen Hals.
»Ich bin ja auch ein gefährlicher Mann, meine Süße«, murmelte er, legte seine Hände um ihre Taille und zog sie an sich. Damit wurde sein Sehnen gleichzeitig befriedigt und vergrößert.
Sie lachte und rieb sich an ihm. »Genau das ist es, was man über dich erzählt. Ich bin mehr als einmal gewarnt worden, mich von dir fern zu halten.«
»Und hast dem offensichtlich keine Beachtung geschenkt.«
»Oh, das habe ich sehr wohl. Aber meine Neugier war größer. Ich wollte selbst sehen, was an den Gerüchten dran ist.«
»Welche Gerüchte?«
Sie sah ihn kokett an und ließ ihre Hand an seiner Hüfte hinuntergleiten. »Wie groß dein Kerbholz ist«, meinte sie.
Unter Lachanfällen, die von lüsternem Drängen und erregtem Keuchen unterbrochen wurden, wälzten sich Sabin und Lora übers Bett und zogen sich gegenseitig aus. Die Schnüre, mit denen Sabins Unterzeug, vor allem seine Bruche, zusammengehalten wurde, waren verknotet, und der Aufschub wurde zur süßen Qual, als Lora kichernd die Knoten mit ihren scharfen Fingernägeln löste.
Schmollend zog sie die Lippen zusammen. »Du willst nur nicht, dass ich meine Belohnung zu sehen bekomme!« Ihre kastanienbraunen Locken hingen ihr übers Gesicht bis zu ihrem üppigen, mit Sommersprossen übersäten Busen.
»Glaub mir, du wirst sie nicht nur zu sehen bekommen!«, keuchte Sabin heiser.
»Was hast du denn noch damit vor?«, schnurrte sie kehlig.
»Endlich!« Sie hatte den letzten Knoten gelöst und ließ Sabins Bruche nach unten gleiten. »Oh.« Voller Bewunderung riss sie die Augen auf.
Sabin grinste. »Ich bin eher ein Mann der Tat als der Worte. Ich zeige dir lieber, was ich mache, als dass ich dir davon erzähle.«
Lora wollte etwas erwidern, dann brach sie in Lachen aus. Er stürzte sich auf sie, warf sie auf die weiche Matratze und legte sich auf sie.
Sabin war gerade tief und fest in sie eingedrungen, als die Tür aufgestoßen wurde und drei Soldaten ins Zimmer stürzten. Einer trug ein Panzerhemd, die beiden anderen gefütterte Waffenröcke.
Lora stieß einen Schrei aus wie ein Fischweib. Blitzschnell hatte er sich von ihr gelöst und tastete nach seinem Gürtel mit dem Schwert.
»Halt!«, brüllte der Soldat in der Rüstung, und im nächsten Moment schon waren die Schwerter aus den Scheiden gezogen und Sabin war umstellt. Seine Brust berührte beim Einatmen die Spitzen der drei blinkenden Klingen. Durch sein zerzaustes Haar hindurch blickte er die drei Angreifer an und ließ die Arme sinken. Seine Lust ließ schneller nach, als ein vom Sturm gepeitschter Baum zu Boden gedrückt wurde. Lora wimmerte auf dem Bett und suchte hektisch nach etwas, um sich zuzudecken.
»Was wollt ihr?«, fragte Sabin, aber er kannte die Antwort schon. Dies waren keine Diebe, die nach seinem Beutel trachteten. Dies waren Männer des Königs. Der Wilddieb war auf frischer Tat ertappt worden – und hatte mehr als nur die Hand in der Schlinge.
»Wenn König Heinrich es weniger gut mit dir meinen würde, dein Gemächt«, knurrte der Anführer wütend, womit er Sabins Verdacht bestätigte. Zur Bekräftigung seiner Worte senkte er sein Schwert zu Sabins Schoß hinab. »Du hast ihn zum Narren gehalten, und jetzt wirst du dafür bezahlen.« Er schnippte mit den Fingern zu Lora. »Zieh dich an, du Hure.«
Leise vor sich hin wimmernd, schlüpfte Lora in ihr Hemd und ihr Kleid. Ein kurzer Befehl und Sabins Arme wurden nach hinten gerissen und zusammengebunden. Die beiden Soldaten drückten ihn nach unten, so dass er sich im dichten Stroh hinknien musste.
»Tut ihm nichts«, flehte Lora mit vor Angst überkippender Stimme.
»Mein Gott, Arnulf, schaff sie hier raus und bring sie aufs Schiff!«, schnauzte der Anführer. Einer der Soldaten packte sie am Handgelenk und riss sie vom Bett. Schluchzend und schreiend wurde sie aus dem Zimmer gezerrt.
Sabin rührte sich nicht, spürte aber, wie sich seine Eingeweide zu verknoten schienen. Er wusste, dass es schlimm werden würde, und er konnte nur beten, dass sie ihn nicht für immer zum Krüppel machen würden.
»Jetzt zu uns beiden.« Der Anführer ging um Sabin herum. Das frische Stroh unter seinen Stiefeln raschelte. »Ich bin befugt, dafür zu sorgen, dass du für die Beleidigung, die du deinem König angetan hast, büßen wirst.« Er schnappte sich Sabins Beutel und ließ die verbliebenen Münzen in seine Hände gleiten. Aber auch eine prächtige silberne Umhangspange englischer Herkunft fiel mit heraus.
Sabin machte einen Satz nach vorne, wurde aber jäh von einem gezückten Schwert zurückgehalten. »Die hat meinem Vater gehört!«, rief er und kämpfte gegen seine Fesseln an.
Der Anführer hieb mit dem Schwertgriff gegen seine Schläfe. Sabin wurde schwarz vor Augen, und er schwankte, da landete eine Stiefelspitze zwischen seinen Schulterblättern und er stürzte mit dem Gesicht nach vorn ins Stroh.
»Genau, sie hat ihm gehört.« Der Anführer steckte das Geld und die Schnalle in seinen Beutel, band sich Sabins Schwertgehenk um und zog die Klinge aus der Scheide. »Ganz anständig, wenn ich auch schon bessere gesehen habe. Aber es sollte doch einen guten Preis bringen.« Während er es wieder in die Scheide steckte, hob er mit dem Stiefel Sabins Kopf an. »Schaff ihn rüber, Richard. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Ach was, ich habe noch gar nicht angefangen.«
Durch das eine nicht ganz zugeschwollene Auge erkannte Sabin die tropfende Kerze in einer der Nischen. Die andere war erloschen, so dass diese Seite des Gemachs in Dunkelheit gehüllt war. Wenn eine Stelle an seinem Körper noch nicht wehtat, dann nur, weil sie taub war – die Höllenqualen würden später einsetzen. König Heinrichs Männer verstanden ihr Handwerk. Sabins hohe Geburt und seine guten Verbindungen schützten ihn zwar davor, getötet zu werden, aber nicht vor einer nachdrücklichen Warnung.
»Mein Gott«, stöhnte er und richtete sich mühsam auf. Seine Hände waren immer noch hinter dem Rücken zusammengebunden, und er war nackt. Ein purpurrot angelaufener Stiefelabdruck prangte auf seinen Rippen, und sein Unterleib fühlte sich an, als hätte ihn jemand als Dreschboden benutzt. Es war nicht das erste Mal in seinem Leben, dass er unter solchen Schmerzen zu leiden hatte, aber gewöhnlich waren seine Angreifer noch schlimmer dran.
Das Kohlenfeuer war zu grauer Asche erloschen, und die Novemberkälte machte sich im Zimmer breit. Wie lange lag er schon hier? Er wusste es nicht. Sein einziger Hinweis waren die Kerzen, die noch frisch gewesen waren, als er mit Lora das Zimmer betreten hatte. Gleich würde er im Dunkeln sitzen. Er kämpfte sich hoch, nur um gleich wieder umzufallen, und erst nach einem weiteren Versuch schaffte er es, zum Bett zu taumeln. Er schmeckte frisches Blut auf der Zunge, als durch die Anstrengung ein schon getrockneter Riss an der Lippe wieder aufplatzte. Mit dem Gesicht nach unten fiel Sabin auf die Matratze, drehte den Kopf zur Seite, um atmen zu können, und gab sich dem Vergessen hin.
Als er das nächste Mal wieder zu Bewusstsein kam, sickerte das fahle Licht der Morgendämmerung durch die Fensterläden. Er war durchgefroren bis auf die Knochen und starr wie ein Toter. Jemand kniete über ihm.
»Lebt er noch?«
Sabin erkannte Simons ängstliche Stimme.
»Gerade noch, Mylord«, antwortete der Wirt. »Aber ich glaube nicht, dass er noch lange im Land der Lebenden ist.«
Sabin spürte ein heftiges Ziehen an seinem Rücken, als der Wirt mit einem scharfen Dolch die Fesseln um seine Handgelenke durchtrennte.
Sabin stöhnte. Seine Arme waren steif geworden, und als er sie endlich wieder bewegen konnte, durchzuckte ihn ein Stechen. Sein ganzer Körper tat weh, ein teils dumpfer, teils scharfer und brennender Schmerz, der ihn außer Gefecht setzte.
»Heilige Jungfrau, was ist mit dir passiert?« Simon ging um das Bett herum. Sein blasses Gesicht zeigte nicht nur die Spuren einer durchzechten Nacht, sondern auch seine Sorge um Sabin.
»Die Mietlinge von König Heinrich«, krächzte Sabin. Seine Lippe platzte erneut auf und blutete. »Ich war mit Lora hier … Gott, hör auf, mich so verängstigt wie ein blödes Schaf anzugucken. Geh. Lass mich in Frieden sterben.«
Simon hörte nicht auf seine Worte und beugte sich zu ihm hinunter. »Ich habe dir doch gesagt, du sollst die Finger von ihr lassen.«
Am liebsten wäre Sabin einfach aufgestanden und gegangen, aber so konnte er nur das halb geschwollene Auge schließen und hoffen, Simon würde den Wink verstehen.
»Die Blanche Nef ist ohne uns in See gestochen.« Der Junge klang niedergeschlagen. Er hatte sich darauf gefreut, auf der schönsten Galeere von König Heinrichs Flotte mitzusegeln. »Auch die anderen Schiffe sind schon alle fort. Wir müssen ein Lastschiff finden, das uns nach Hause bringt.«
Sabin brummte. Solche praktischen Probleme überstiegen im Moment seine Kräfte.
Die Frau des Wirts kam mit einer Schüssel warmem Wasser, einem Tuch und einer Salbe. Blutegel, die an Sabins Auge gesetzt wurden, ließen die Schwellung zurückgehen, und der Riss an seiner Lippe wurde mit einem Fett behandelt, das zwar ekelhaft schmeckte, aber seinen Dienst tat und verhinderte, dass die Wunde jedes Mal, wenn Sabin den Mund auftat, von neuem aufplatzte.
Mühsam, und nur unter Schmerzen, aber weit von der Pforte zum Reich des Todes entfernt, zog sich Sabin an und wankte runter in den Schankraum der Herberge, wo er vorsichtig etwas in Milch getunktes Brot und einen Becher mit Wasser versetzten Wein zu sich nahm. Er vermisste das gewohnte Gewicht seines Schwertes an der Hüfte und musste sich Simons zweite Spange leihen, um seinen Umhang zu verschließen.
»Mutter wird sich nicht freuen, wenn sie dich so sieht.« Über den Becher Wein gebeugt, den er kaum angerührt hatte, betrachtete Simon Sabins übel zugerichtetes Gesicht. »Es ist kein Zoll an dir, der nicht schwarz, blau oder rot wäre.«
»Deine Mutter freut sich nie, wenn sie mich sieht«, erwiderte Sabin und schob sich ein Stück in Milch getauchtes Brot zwischen die nur einen schmalen Spalt geöffneten Lippen. Sein Kiefer tat höllisch weh, und mindestens zwei Zähne waren locker. »Du weißt so gut wie ich, dass sie sich wünscht, ich wäre nie geboren worden.«
»Sie war immer anständig zu dir«, verteidigte Simon sie. »Es hat dir nie an etwas gefehlt.«
Sabin zuckte mit den Schultern, was er sogleich mit einem stechenden Schmerz bezahlen musste. Lady Matilda, Gräfin von Huntingdon und Northampton, hatte sich immer anständig verhalten – ganz gerecht, so dass niemand sie beschuldigen konnte, sie würde ihre Pflicht versäumen oder den Sohn ihres Mannes meiden, den Bastard einer Nonne, gezeugt auf dem Heimweg von einem der großen Kreuzzüge. Was ihm fehlte, war die Wärme, die sie ihren eigenen Kindern schenkte. Das Lächeln, das sie für Sabin übrig hatte, war immer gezwungen, das für Waltheof, Maude und Simon immer offen und herzlich. Ihre Kinder konnten nichts Falsches tun. Sabin jedoch, weil das Schicksal es so wollte und manchmal, weil er einfach Aufmerksamkeit suchte, wurde oft bei irgendeinem Fehltritt ertappt. Das war nicht so schlimm gewesen, als sein Vater noch gelebt hatte. Seine Zuneigung, wenn auch von Schuldgefühlen gefärbt, war ein Trost gewesen, doch nach seinem Tod wurden die Umstände für Sabin widriger, und es war ihm oft so vorgekommen, als müsste er einen steilen, schlüpfrigen Weg hinaufsteigen. Manchmal dachte er, dass es die Mühe nicht lohnte und er sich still und leise in die Hölle hinabgleiten lassen sollte. Oder war er vielleicht schon dort?
»Warum hast du das gemacht?«, fragte Simon.
»Was gemacht?«
»Lora nachgestellt, wenn du dir eine von den Hofdamen hättest nehmen können.« Neid blitzte in Simons Augen auf.
»Mir gefällt es eben, mit dem Feuer zu spielen«, erwiderte Sabin flapsig und schob seine noch halb volle Schale mit dem eingeweichten Brot zur Seite. »Ich könnte dich genauso gut fragen, warum du dich gestern bis zur Besinnungslosigkeit betrunken hast. Du wusstest, dass du heute Morgen einen Brummschädel haben würdest, du wusstest, dass dir übel sein würde, aber trotzdem hast du’s getan.«
»Der Wein war gut« – Simon war in die Ecke gedrängt – »und außerdem segle ich nicht gerne, auch nicht auf der besten Galeere der Flotte.«
»Oder liegt der Grund vielleicht darin, dass es deinem Stiefvater nicht gefällt, wenn du dich in einer Hafenschenke besäufst, und du ihm beweisen wolltest, dass du ihm keinen Gehorsam schuldest?«
Simons Hals bekam rote Flecken. »Ich habe mich doch nicht betrunken, um meinem Stiefvater eins auszuwischen!«
Darauf erwiderte Sabin nichts, aber sein Blick war vielsagend. Zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes hatte Lady Matilda den Prinzen von Schottland, David MacMalcolm, geheiratet. Sicher, diese Eheschließung war ein politischer Schachzug gewesen, aber einer, aus dem sich tiefe Zuneigung entwickelt hatte. Die Ehe war mit weiteren Nachkommen gesegnet, das älteste Kind war erst sechs Jahre alt. Prinz David nahm seine väterlichen Pflichten ernst, auch gegenüber seinen Stiefkindern. Als Bastard von Lady Matildas erstem Mann wurde Sabin allerdings kaum Achtung geschenkt und man trug eigentlich nur seine Vergehen Prinz David zu. Dies allerdings kam so oft vor, dass er sich schon einen gewissen Ruf eingehandelt hatte, und der Vorfall der vergangenen Nacht würde ein Übriges tun.
Simon täuschte großes Interesse an einem zweifelhaften Fleck auf der Bank vor.
Geschickt hob Sabin den Becher so an die Lippen, dass er die Wunde nicht berührte, und leerte ihn mit einem Zug. »Ich war hinter Lora her, weil mir ihr Lachen gefiel, und ich wollte wissen, wie es ist, ihr Haar zu lösen und durch meine Hände gleiten zu lassen«, erklärte er. »Sie ist nicht so tumb wie etliche der Frauen am Hof. Und vielleicht wollte ich tatsächlich auch wissen, ob ich sie dazu verführen konnte, vor König Heinrichs Nachstellungen heimlich in mein Bett zu flüchten. Ich muss zugeben, dass ich mich womöglich überschätzt habe …« Sabin unterbrach sich, als die Frau des Wirts von einem Gang zu den Fischerbooten zurückkam. An ihrem Arm trug sie einen Korb mit zwei großen Krabben und einem halben Dutzend Flundern. Die Farbe war aus ihrem Gesicht gewichen und zitternd ließ sie sich auf eine Bank fallen. Besorgt eilte ihr Mann zu ihr und fragte sie, was mit ihr sei.
Tränen traten in ihre Augen, als sie zu ihrem Mann aufblickte und dann zu Sabin und seinem Bruder hinübersah. »Die Blanche Nef«, begann sie. »Ich habe gerade gehört, dass sie gestern Abend gegen den Felsen von Chartreuse geprallt und untergegangen ist.«
Schweigend starrten die drei Männer sie an.
»Bist du sicher?«, durchbrach ihr Mann schließlich die Stille. Er deutete auf ihren Korb. »Du weißt, Thomas bringt mehr falsche Gerüchte in Umlauf, als er Fische verkauft.«
»Das habe ich nicht von Thomas«, empörte sie sich. »Emma hat es mir erzählt. Ihr Mann war draußen auf dem Meer und hat im Morgengrauen einen Mann aus dem Wasser gefischt. Er hat gesagt, dass die Blanche Nef auf das Riff gelaufen ist, und als sie versucht haben, sie wegzustemmen, ist sie gesunken.« Sie zuckte mit den Schultern. »Frag sie doch selbst, wenn du mir nicht glaubst. Geh und schau nach. Sie sagen, dass am Kap schon Wrackteile und mindestens eine Leiche angespült wurden. Diese vielen jungen Menschen … gestern Abend noch haben wir sie bewirtet … und nun sind sie alle ertrunken, einschließlich des Prinzen.« Sie bedeckte ihr Gesicht und schwankte, von einem Weinkrampf geschüttelt, auf der Bank vor und zurück.
»Heiliger Jesus«, flüsterte Simon und bekreuzigte sich. Dann warf er Sabin einen erschreckten Blick zu. »Eigentlich hätten auch wir auf dem Schiff sein sollen.«
Sabin blickte ausdruckslos zur Tür, die die Frau in ihrem Schrecken nicht geschlossen hatte. Der kalte Novemberwind blies in die Gaststube. Gestalten tauchten in dem hellen Rechteck auf und verschwanden wieder, um ihren Geschäften nachzugehen. Möwen kreischten über den von den Booten angelandeten Fischen. »Vielleicht stimmt es ja doch nicht«, behauptete Simon. »Falsche Gerüchte verbreiten sich so schnell wie eine Feuersbrunst.«
Sabin erhob sich mühsam und ging mit steifen Beinen zur Tür. Am Kai herrschte ein Treiben wie am Vorabend, doch jetzt war es das Stadtvolk, das heftig feilschte und Neuigkeiten austauschte. Wie Simon gesagt hatte, mochte an dem Gerücht nichts dran sein, doch das Gefühl in seinem Bauch sagte ihm, dass dem nicht so war.
Eine plötzliche Unruhe kam auf und die Leute rannten zum Ufer, wo ein Fischerboot an den Strand gezogen wurde. Der Kapitän und seine Männer standen bis zu den Knien im Wasser. Einer der Jungen winkte und rief. Simon schob sich an Sabin vorbei und rannte zum Boot. Sabin torkelte hinter ihm her. Als der Wind gegen sein Gesicht blies, zuckte der Schmerz der lockeren Zähne über sein ganzes Gesicht.
Die Fischer hoben etwas aus ihrem Boot und legten es jenseits der Wasserlinie ans Ufer. Sabin sah, wie sein Bruder den Hals reckte, um besser sehen zu können, und sich dann plötzlich abwandte.
»Es ist Lora«, sagte Simon und musste schlucken. »Gütiger Gott, ich habe nicht geglaubt, dass es stimmt … ich habe es nicht geglaubt.« Er beugte sich vor und musste sich übergeben. Während sich Sabin seinen Weg durch die Menge bahnte, achtete er nicht mehr auf den äußerlichen Schmerz, ein viel stärkerer machte sich in seinem Innern breit – als würde jemand seine Eingeweide mit der Faust umklammern und herumdrehen.
Sie lag auf dem Rücken, ihr kastanienbraunes Haar klebte an ihren Schultern wie Seetang, ihr Gesicht zeigte die bläuliche Blässe des Todes. Auch die Lippen hatten ihre Farbe verloren, die vorher lachenden Augen waren matt wie zwei Steine. Wenn er sie nicht gedrängt hätte, wäre sie jetzt beim König, in Sicherheit. Er trug die Schuld an ihrem Tod.
Jemand brachte eine Trage, und sie legten sie darauf. Sand und Stücke von Muschelschalen klebten in ihrem Haar und dem nassen Kleid. Der Duft von Zimt und Rosen, der Sabin am Abend zuvor die Sinne betäubt hatte, war verschwunden. Jetzt stieg der Geruch nach Meerwasser und Fischerboot von ihr auf. Er trat an die Trage und strich zärtlich eine Strähne ihres Haars von ihrer Wange, die kalt wie Marmor war.
»Ich hätte auch sterben sollen«, sagte er, wusste aber nicht, ob es ein Segen oder ein Fluch war, dass König Heinrichs Soldaten sein Schwert mit zum Grund des Meeres genommen hatten. Hätte es an seinem Gürtel gehangen, wäre er versucht gewesen, es herauszuziehen und sich in die Klinge zu stürzen. Benommen wankte er zu der Taverne zurück. Die Schankstube füllte sich bereits mit Gästen, die es kaum erwarten konnten, sich über das Ereignis auszutauschen. In ihren Gesichtern spiegelte sich eine Mischung aus Schrecken und Wonne. Es gab nur wenig Wein zu verteilen, aber genug herben Apfelmost, dem man nun heftig zusprach. Sabin hielt sich im Hintergrund und beobachtete seinen Bruder, der sich ein Trinkhorn füllen ließ.
Er ertrug den Lärm nicht und machte sich humpelnd auf den Weg in das Zimmer, in dem er mit Lora in der Abenddämmerung des vorherigen Tages so ausgelassen herumgetollt hatte. Hier roch es immer noch nach Zimt, nach dem Wachs der abgebrannten Kerzen und dem vergossenen Wein. Er hob den Krug auf, der im ersten Handgemenge im Stroh gelandet war, und entdeckte zwischen den Halmen ein Haarband aus grüner Seide. Er hob es auf und wickelte es um seine Finger. Es schillerte wie der Kopf einer Ente im Frühling. Die Lider über seinen brennenden Augen kribbelten, aber er weinte nicht. Ein paar Tränen, damit hätte er es sich zu leicht gemacht. Als Kind war er oft wegen seiner Streiche und Vergehen bestraft worden, und mit der Zeit hatte er einen Schutzwall um sich herum aufgebaut: Sein Stolz waren die Steine und sein Trotz der Mörtel. Dieser Wall war so hoch und stark, dass er jedem Angriff standhielt. Er hielt jeden Feind draußen, machte Sabin zugleich aber zu einem Gefangenen seiner selbst.
Das Haarband noch immer um die Finger gewickelt, legte er sich aufs Bett und bedeckte seine brennenden Lider mit dem Arm. An diesem Tag würden keine Vorratsschiffe mehr nach England auslaufen. Morgen vielleicht, beladen mit der grausamen Nachricht. Grimmig verdrängte Sabin jeden Gedanken und jedes Gefühl aus seinem Bewusstsein und flüchtete sich in den Schlaf, einen finsteren, abgrundtiefen Schlummer, dem Tode so nah, wie ein Mensch nur kommen konnte, ohne tatsächlich zu sterben.
2
Burg von Roxburgh, schottisches GrenzlandDezember 1120
Kalte Winternebel zogen bei Einbruch der Nacht herauf, als Edmund Strongfist und seine Tochter Annaïs auf Prinz Davids neuen Wohnturm in Roxburgh zustrebten. Mit gesenkten Köpfen trotteten ihre Pferde über den Weg, den andere Pferde und Ochsenkarren zuvor schon zu einem zähen, braunen Matsch aufgewühlt hatten. Das Lastpony war ein starrköpfiges, aufsässiges Tier, und hin und wieder musste Strongfists Waffenmeister fest an seinem Zügel reißen, um es daran zu erinnern, wer hier der Herr war.
»Solide Verteidigungsanlage«, sagte Strongfist in anerkennendem, aber schroffem Ton. Eine Wolke bildete sich vor seinem Mund, vereiste Tropfen zierten seine Augenbrauen und seinen dichten, blonden Bart. »Die Festung hier steht seit ewigen Zeiten, aber Prinz David hat ihr seinen Stempel aufgedrückt … und seine Gräfin auch«, fügte er nach kurzer Pause hinzu.
Annaïs hob den Blick zu der Burg mit ihren Verteidigungsanlagen, die aus dem feuchten Nebel emporragten. Unterhalb floss murmelnd der Tweed vorbei, der zu dieser Jahreszeit Hochwasser führte. Fackeln warfen ihren Schein über den Torbogen und lockten Reisende über die Holzbrücke in den Innenhof. »Sie wirkt riesig im Vergleich zur Priorei«, stellte sie fest.
»Das soll sie auch.« Strongfist wandte seinen Blick von den Mauern ab und sah sie an. »Sind dir etwa Zweifel gekommen?«
Annaïs schüttelte den Kopf. »Nein, Vater, ich bin mir ganz sicher.«
Er brummte irgendetwas vor sich hin und richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf die Burg. »Solange du weißt, was du willst«, meinte er. »Sofern eine Frau das jemals tut.«
Die Grimasse, die sie hinter seinem Rücken schnitt, war nicht böse gemeint. Sie hatte die vergangenen fünf Jahre in einem Nonnenkloster gelebt, wo sie unterrichtet und erzogen worden war, während ihr Vater bei Prinz David in Diensten stand. Da ihre Mutter schon früh an einem Fieber gestorben war, schien die Priorei von Coldingham, in der ihre Tante Mesnerin war, der beste Platz für sie zu sein. Ihr Vater hatte gesagt, eine Erziehung wäre von großem Nutzen, wenn sie ins heiratsfähige Alter kommen würde. Jetzt war sie siebzehn, doch bisher hatte noch kein passender Mann um sie und ihre bescheidene Mitgift angehalten. Diejenigen, die jung und hübsch waren, konnten ihr keine gesicherte Zukunft bieten; die anderen, die dazu in der Lage waren, waren viel älter als sie, und Strongfist weigerte sich, seine Tochter mit einem Mann zu verheiraten, der älter war als er selbst. Da sie nicht den Wunsch hatte, den Schleier zu nehmen und bei ihrer Tante im Kloster zu bleiben, und sich die Lebensumstände ihres Vaters erst vor kurzem geändert hatten, war sie derzeit so frei, wie es eine junge Frau von ihrem Stand nur sein konnte.
Sie ritt hinter ihrem Vater in den Hof. Widerstrebend blieb das Lastpony auf der Brücke stehen, und erst mehrere Flüche und ein kräftiger Schlag von Tam, dem Waffenmeister und Diener, brachten es dazu, mit einem Satz nach vorne zu preschen, so dass es gegen sein Pferd stieß und ihn beinahe vom Sattel hob.
Annaïs betrachtete die von den Fackeln beleuchteten Mauern aus grob behauenen Steinen, die einen krassen Gegensatz zu den sich in ihrem Schatten duckenden Wirtschaftsgebäuden aus gekalktem Holz bildeten. Selbst in dem Nieselregen drang der verführerische Duft von geschmortem Hammelfleisch in Annaïs’ Nase und ihr Magen begann zu knurren. Die Disziplin und das spärliche Essen im Kloster waren etwas, an das sie sich nie gewöhnen konnte, und während der Zeit in Coldingham hatte sie unter ihrem ständigen Hunger gelitten. Sie stieg allein von ihrer Stute und schüttelte ihre Röcke aus. Obwohl sie ihren Winterumhang aus doppelt gewebtem Tuch trug, hatte sich die Feuchtigkeit im Rock darunter festgesetzt.
Der Waffenmeister führte die Pferde zu den Ställen, um dann das Gepäck in den Saal zu bringen, wie man ihn geheißen hatte. Annaïs schürzte ihren Rock und folgte dem Vater auf seinem Weg zwischen den Kuh- und Pferdeställen und Werkstätten hindurch, bis sie ein hübsches, mit Holzschindeln gedecktes Holzhaus erreichten, dessen schwere Eichentür mit schmiedeeisernen Ornamenten verziert war.
»Wir werden gleich trocken sein«, munterte er seine Tochter auf, als er einen Schritt zur Seite trat, um einem Soldaten Platz zu machen, der nach draußen wollte. Strongfist erkannte ihn nicht gleich, dann aber murmelte er einen Gruß und klopfte ihm auf die Schulter. »Duncan, schön, dich zu sehen, Mann.«
Der Ritter rang sich ein Lächeln ab und murmelte etwas zur Antwort, doch sein Blick blieb finster.
»Was ist los? Hast du deinen Sold schon wieder beim Würfeln verloren, oder quält dich deine Schwiegermutter?«
Duncan machte eine Geste, so als wäre Strongfists Heiterkeit ganz verfehlt. Dann kniff er die Augen zusammen. »Du hast es wohl noch nicht gehört, oder?«
»Was gehört?«
»Von der Blanche Nef?«
Strongfist schüttelte den Kopf und deutete auf Annaïs. »Ich war in Coldingham, um meine Tochter abzuholen, und die Priorei ist so abgelegen, dass kaum ein Gerücht dorthin gelangt. Warum, was ist geschehen?«
Duncan schnalzte mit der Zunge. »Der Hof war auf dem Rückweg von der Normandie. Die Blanche Nef ist vor dem Hafen von Barfleur untergegangen, alle sind ertrunken, einschließlich des Thronfolgers William. Wir haben die Nachricht vor zwei Tagen von einem Kurier des Königs erhalten.«
»Gott schütze ihre Seelen, das ist ja furchtbar!« Strongfist und Annaïs bekreuzigten sich.
»Ja, das ist es«, stimmte Duncan zu. »Und ich fürchte, dass uns die Tragödie auch unmittelbar trifft. Wahrscheinlich waren der Sohn unserer Gräfin Matilda und sein Halbbruder Sabin an Bord und sind ebenfalls umgekommen.«
»Heiliger Jesus, nein!«
»Im Haus herrscht tiefe Trauer. Wenn du dich bei Prinz David melden willst, er ist mit der Gräfin und ihrer Tochter in der Kapelle. Ich an deiner Stelle würde mir allerdings im Saal einen Schlafplatz suchen und bis morgen warten.«
Strongfist nickte steif. »Danke für die Warnung.« Er überlegte, was er zum Trost sagen könnte. »Wenigstens hat die Gräfin noch ihre Nachzügler und die anderen beiden aus erster Ehe.«
»Ja, aber du weißt, wie viel Aufhebens sie um den Jungen gemacht hat. Zudem stand er kurz davor, ins Mannesalter zu kommen.«
»Besteht die Möglichkeit, dass sie überlebt haben?«
Duncan verzog das Gesicht. »Wenn sie auf der Blanche Nef waren, nein. Sie ist zwei Meilen vor der Küste bei völliger Dunkelheit gesunken. Der einzige Überlebende, der von der Sache erzählen konnte, war ein gewöhnlicher Metzger, der an Bord war, um Schulden einzutreiben. Aber wir unterhalten uns später noch, ich muss jetzt meinen Dienst antreten.« Er klopfte Strongfist auf die Schulter, nickte Annaïs zu und stapfte davon.
Vater und Tochter traten in den verrauchten Saal. Eine dicke Schicht Binsen bedeckte den Boden aus gestampfter Erde, und nicht nur die Fensterläden, sondern auch schwere Vorhänge schützten vor dem Eindringen der nasskalten Luft.
»Möge Gott sich ihrer Seelen erbarmen«, murmelte Strongfist, als er zum Feuer ging und seine Hände ausstreckte, als könnte die Wärme Duncans Worte vertreiben.
Annaïs machte ein finsteres Gesicht. Ihr Vater stand zwar bei Prinz David in Diensten, aber sie hatte mit ihm oder dessen Familie nie etwas zu tun gehabt. Sie wusste, dass der Prinz eine englische Witwe, Matilda, die Gräfin von Huntingdon und Northampton, geheiratet hatte, die bereits drei Kinder aus erster Ehe besaß. Der Älteste hatte die heilige Weihe empfangen, das mittlere Kind war eine Tochter, und der Jüngste war derjenige, um den getrauert wurde. Doch ihrem wachsamen Geist war die Erwähnung des Halbbruders nicht entgangen. »Wer ist Sabin?«, fragte sie.
Ihr Vater rieb die Hände aneinander und streckte sie wieder aus. »Ein Taugenichts, der Bastard vom ersten Mann der Gräfin«, erklärte er. »Wild, nach allem, was man hört, und er hat einen schlechten Einfluss auf Simon. Ich kenne ihn nur flüchtig, und unsere Wege haben sich nur selten gekreuzt, so dass ich eigentlich nicht sagen kann, ob an dem Gerede etwas dran ist.«
Einige Kameraden ihres Vaters aus dem Gefolge des Prinzen gesellten sich zu ihnen. Er wurde begrüßt, die Männer unterhielten sich über die Tragödie und die Folgen für Prinz David und seine Frau … und für König Heinrich, der seinen einzigen legitimen Sohn verloren hatte. Als diese Themen schließlich abgehakt waren, ging das Gespräch zu Persönlicherem über.
»Dann erzähl uns doch mal, ob an den Gerüchten was Wahres ist«, verlangte Alexander de Brus, ein Ritter, mit dem Strongfist oft in der Eskorte ritt.
»Welche Gerüchte?« Strongfist bedachte ihn mit einem ahnungslosen Blick.
»Ach, jetzt komm schon, Mann, tu doch nicht so. Wir haben gehört, du ziehst nach Jerusalem, um dein Schwert in den Dienst von König Balduin zu stellen.«
Strongfist verschränkte die Arme und erhob sich. »Na, und wenn schon?«
»Na, und wenn schon?« De Brus lachte. »Das ist doch keine Entscheidung, die man von einem Moment zum anderen trifft – so als ginge es darum, loszureiten, um den Tag mit Jagen zu verbringen.«
Strongfist stellte sich breitbeinig hin, so als wollte er seinen Stand behaupten – und Überlegenheit über seine Freunde demonstrieren. »Es sind mehr als zwanzig Jahre her, dass ich mit meinem Vetter Fergus bei der Eroberung von Jerusalem dabei war. Bartlose Jungen, die sich ihre Lorbeeren noch nicht verdient hatten.« Er schnaubte, als er sich an die damalige Zeit erinnerte, und zog an seinem dichten Bart, der sein Gesicht mittlerweile zierte. »Fergus ist dort geblieben, um weiterhin zu dienen, was ich auch getan hätte, wenn ich nicht meinem Vater versprochen hätte, unversehrt zurückzukehren und ihm eine Hand voll Staub von den Wegen mitzubringen, über die Christus höchstpersönlich gewandelt ist. Dann habe ich die Mutter dieses Mädchens geheiratet, und mit meiner Wanderlust war es zu Ende.« Er streckte einen Fuß aus und blickte über seine verschränkten Arme hinweg auf den Sporn an seiner Ferse, dem Zeichen für seine volle Ritterwürde. »Jetzt sind meine Frau und mein Vater tot, und mein älterer Bruder herrscht über das Land unserer Familie. Fergus ist Herr über riesige Ländereien und schreibt mir, dass ich genauso viel besitzen könnte, wenn ich nach Outremer zurückkehre. Sie brauchen dringend erfahrene Ritter.«
Alexander legte seine Hand auf Strongfists Schulter. »Deswegen macht dir doch keiner Vorwürfe«, meinte er. »Jeder wird einsehen, dass es mehr Gründe für dich gibt, zu gehen als zu bleiben. Schließlich bist du deinem Bruder niemals wirklich nahe gestanden.«
Darauf erwiderte Strongfist nichts, zog aber seine Mundwinkel vielsagend nach unten. Der Charakter seines Bruders war in etwa so anziehend wie die Hafergrütze vom Vortag, die auf der kalten Fensterbank stand. Solange ihr Vater noch gelebt hatte, hatte Strongfist die Zähne zusammengebissen, aber jetzt war es Zeit zu gehen.
»Und was geschieht mit deinem Mädchen?« De Brus warf einen Blick zu Annaïs hinüber, die in der Gesellschaft der Männer sittsam schwieg. »Nimmst du sie mit?«
Auch Strongfist wandte seinen Kopf zu ihr. »Ja. Ich möchte sie nicht für den Rest ihres Lebens hinter Klostermauern stecken, wenn sie sich nicht berufen fühlt. Und ohne schlechtes Gewissen könnte ich sie auch nicht der Obhut meines Bruders überlassen.« Sein Gesicht war ausdruckslos. »Bei ihm würde sie kein Glück finden, auch wenn sie ein folgsames Mädchen ist, und ich bin keineswegs überzeugt davon, dass er einen Mann für sie aussuchen würde, der zu ihr passt. Ich hoffe, dass ihr ihre Erziehung eine Stellung am Hof von König Balduin verschafft. Wenn Gott es gut mit ihr meint, wird sie vielleicht sogar einen Grafen von Outremer abbekommen.« Er warf ihr ein stolzes Lächeln zu, das sie jedoch mehr pflichtbewusst als von Herzen erwiderte.
Sie war froh, als sie von den Zofen der Countess in die Frauengemächer oberhalb des Saales geführt wurde. Es war nicht angenehm, wenn über einen geredet wurde, ohne dass man sich an dem Gespräch beteiligen konnte – als wäre sie eine preisgekrönte Stute oder eine Hure. Nach fünf Jahren in der trauten Gemeinschaft von Nonnen war es schwer, sich an die Gesellschaft rauer Soldaten zu gewöhnen. Annaïs bekam einen Schlafplatz im Gemach der Zofen vor dem von Countess Matilda zugewiesen und erhielt einen Becher warmen Wein, eine Schale Suppe mit Hammelfleisch und einen halben Laib Brot. Die Countess sei noch mit ihrem Mann und der ältesten Tochter beim Gebet in der Kapelle, wurde ihr gesagt. Dort würden sie noch bis spät in die Nacht bleiben.
Die Jüngeren waren von der Kinderfrau versorgt und in dem kleinen Nebengemach ins Bett gebracht worden. Annaïs konnte einen kurzen Blick auf sie erhaschen, während sie Suppe und Brot hinunterschlang: ein kräftiger, rotblonder Junge und zwei hellblonde Mädchen, das jüngere kaum älter als ein Wickelkind.
Als sie mit dem Essen fertig war, spülte sie ihre Schüssel im bereitgestellten Bottich ab und half den anderen Frauen dabei, die Strohlager für die Nacht vorzubereiten. Unter der strengen Ordensregel in Coldingham hatte sie sich an alle Arten von Arbeit gewöhnt. Trotz ihres hohen Ansehens war die Priorei kein Zufluchtsort für vornehme junge Damen, die sich nur mit Stickerei beschäftigten. Annaïs wusste sowohl wie man ein Huhn als auch wie man ein Strohlager bereitet. Sie konnte feine Säume, aber auch eine von einem Kampf herrührende Wunde nähen. Sie schrieb fließend Latein und Französisch, war aber ebenso geübt darin, eine Wand mit einer Bürste aus Schweineborsten zu kalken.
Sobald die Strohlager ausgelegt waren, bereiteten sich die Frauen für die Nacht vor. Annaïs zog sich aus und breitete ihre Kleider so gut es ging über eine Truhe aus, damit der feuchte Stoff trocknen konnte. Ihre Kleider müssten eigentlich ordentlich ausgebürstet werden, aber das würde wohl noch warten müssen, da sie und ihr Vater am nächsten Tag zur Burg ihres Onkels in Branton weiterziehen wollten.
Als sie ihren Schleier entfernt hatte, nahm sie aus ihrer Reisetasche den Kamm, löste die Zöpfe und kämmte ihr Haar, bis es wie dunkle, polierte Eiche glänzte. Als Nächstes wurde gebetet, und an diesem Abend mussten viele Gebete gesprochen werden. Nach jedem Bittgebet ließ Annaïs einen ovalen Achat von ihrem Rosenkranz durch die Finger gleiten. Ihr letzter galt den vermissten jungen Männern.
Ihr Lager befand sich gleich neben der Tür, so dass ihr Schlaf immer wieder gestört wurde. Als die Angeln quietschten, riss sie den Kopf hoch und sah im flackernden Kerzenschein, wie mehrere Leute den Raum betraten. Besonders eine Frau mit dicken, roten Zöpfen unter ihrem Schleier fiel ihr auf; sie tröstete ein schlankes Mädchen in jugendlichem Alter. Hinter ihr ging ein Mann von durchschnittlicher Größe und Statur, aber mit finsterem Gesicht und wachsamen Augen. Sein Umhang war mit Hermelinschwänzen gesäumt, und die Goldstickerei darauf schimmerte im Kerzenlicht. Annaïs dachte, dass dies die Countess, ihre Tochter Maude und Prinz David MacMalcolm sein mussten, der in jeder Hinsicht, außer dem Titel nach, der König im schottischen Grenzland war.
Leise durchquerten sie den Vorraum und verschwanden durch den Vorhang in die Privatgemächer der Countess. Kurz darauf hörte Annaïs Murmeln und unterdrücktes Weinen. Ein Hauch von Weihrauch aus den Kleidern der Familie hing in der Luft. Annaïs seufzte und schloss die Augen. Sie versuchte, nicht an die jungen Männer zu denken, die ertrunken waren – nicht so sehr um deretwillen, obwohl sie noch ein weiteres inniges Gebet für ihre Seelen gen Himmel schickte, sondern um ihrer selbst willen. Auf dem Weg nach Jerusalem mussten sie viele Meere überqueren, auch den engen Kanal zwischen England und der Normandie, der die Blanche Nef gefordert hatte. Ihr Vater hatte oft von den Reisen erzählt, die er in jungen Jahren unternommen hatte. Manchmal, wenn er vom Trinken geschwätzig geworden war, hatte er von Wellen berichtet, die so hoch wie eine Kathedrale gewesen waren, und von Fischen mit riesigen Mäulern und Zähnen wie Dolche. Als kleines Mädchen hatten ihr die Geschichten Angst gemacht, so dass sie Alpträume bekommen und die Mutter ihn für seine Erzählungen gerüffelt hatte. Im Lauf der Jahre hatte Annaïs ihre Angst zwar verloren, doch allein der Gedanke an die Reise ließ in ihrem Kopf wieder die Bilder riesiger Fische und tosender Wellen entstehen.
Die Tür ging wieder auf, und diesmal beleuchtete die Kerze zwei männliche Gestalten. Annaïs überlegte, ob sie schreien sollte, da die beiden vorsichtig, ja, schon beinahe verstohlen an ihrem Lager vorbeischlichen, und einer von ihnen ein Schwert trug. Allerdings kam sie zu dem Schluss, dass die beiden schon an mehreren Wachen vorbeigekommen sein mussten und es wohl mehr Anlass zur Neugier als zur Angst gab.
Der mit dem Schwert war blond und entwuchs seiner Statur nach zu urteilen gerade dem Kindesalter, und an den Wangen und Schläfen zeigten sich Pickel, von denen junge Leute oft verunstaltet wurden. Sein Begleiter hatte dunkle Haare, und mit seinem garstigen Gesicht – ein Auge und die Lippen waren dick geschwollen – sah er aus wie ein Teufel in Menschengestalt. Er bewegte sich sogar wie ein Wesen aus der anderen Welt, hatte seine Schultern hochgezogen und humpelte so seltsam, dass Annaïs schon glaubte, gleich würden unter seinem langen Umhang Hufe und ein Schweif hervorsehen. Aber als Annaïs unwillkürlich das Kreuzzeichen machen wollte, musste sie sich für diese Dummheit doch schelten.
Sie hatten fast den Vorhang zum inneren Zimmer erreicht, als der Blonde über das Strohlager einer schlafenden Zofe stolperte. Die Frau wachte auf, blickte zu den Eindringlingen hinauf und begann gellend zu kreischen. Die jungen Männer hätten sich ihr Schleichen sparen können, denn augenblicklich war alles hellwach. Als ein Kind zu weinen begann, wankte die Kinderfrau hin, um es zu trösten. Der Vorhang zum Gemach der Gräfin öffnete sich, und hastig wurden Kerzen angezündet.
»Was ist hier los?« Countess Matilda, die sich einen Umhang über ihr leinenes Unterhemd geworfen hatte, erschien in der Tür. Ihr volles, rotbraunes Haar ergoss sich über ihre Schultern. Als sie die beiden jungen Männer sah, leuchteten ihre Augen vor Freude. »Simon!«, rief sie. Jegliche Anstandsregeln missachtend, rannte sie auf den jungen Mann zu, warf ihre Arme um ihn und brach in Tränen aus. Nach kurzem Zögern erwiderte er ihre Umarmung mit ebensolcher Heftigkeit. Der Dunkelhaarige trat einen Schritt zurück, und obwohl sein Gesicht kaum zu erkennen war, dachte Annaïs, dass es härtere Züge bekam, und beinahe spürte sie, wie er sich innerlich zurückzog.
»Wir dachten, du wärst ertrunken«, schluchzte Matilda, die ihren Sohn nur losließ, um ihn der Umarmung seiner Schwester zu überlassen. Während sie sich die Augen mit dem Ärmel trocknete, wandte sie sich dem Dunkelhaarigen zu, wich aber entsetzt zurück.
»Ich bin gestürzt, Mylady«, sagte er mit ausdrucksloser Stimme. »Es stimmt, dass die Blanche Nef mit dem Thronfolger an Bord gesunken ist, aber wir haben ihre Abfahrt verpasst.«
Prinz David begrüßte die beiden. Simon umarmte er herzlich, die Hand des anderen drückte er nur zurückhaltend. Die Familie zog sich in ihr Gemach zurück, nachdem die Dienerschaft losgeschickt worden war, um Wein und etwas Essen zu holen. Nach der anfänglichen Aufregung kehrte wieder Ruhe ein. Nur gedämpft und undeutlich drang die Unterhaltung durch den Vorhang, so dass die Frauen nichts verstanden. Die älteste Zofe ordnete an, dass sich alle wieder schlafen legen sollten, und zur Bekräftigung ihrer Worte blies sie die Kerzen aus – auch die dicke auf dem Leuchter, die sonst die ganze Nacht über brannte. Das leise Flüstern zweier Mädchen wurde durch eine harsche Zurechtweisung unterbunden.
Annaïs’ Augen brannten schon vor Müdigkeit, doch sie lag noch lange wach und grübelte über die Szene nach, deren Zeugin sie eben geworden war. Sie war eher praktisch veranlagt, aber dennoch war sie empfindsam für Stimmungen – und in diesem Zusammentreffen waren die Gefühle so deutlich gewesen, dass man sie greifen zu können meinte.
Prinz David von Schottland, der auch Earl von Huntingdon und Northampton war, solange sein Stiefsohn die Volljährigkeit noch nicht erreicht hatte, strich müde über seinen Bart und betrachtete den jungen Mann, der vor ihm saß. Auf dem aufgebockten Tisch zwischen ihnen lagen die Überreste des Frühstücks: Haferpfannkuchen und Quark sowie ein halber Krug braunes Heidekrautbier.
»So«, begann er. »Jetzt will ich die Wahrheit hören: Was ist in Barfleur wirklich passiert?« Er klang freundlich. An seinem Französisch war nur das leichte gerollte R der Schotten zu bemängeln, da er die meiste Zeit seines Lebens am englischen Hof verbracht hatte. »So sehr ich mich auch freue, dich und Simon gesund wiederzuhaben, würde ich doch gerne wissen, was mich und die meinen das kostet.«
Sabin ertrug Davids stechenden Blick nicht und senkte den Kopf. Nur mit Mühe konnte er den Drang unterdrücken, einfach wegzulaufen. Das Verhalten des Prinzen von Schottland war von größter Ehrlichkeit geprägt, die er allerdings auch von anderen erwartete.
»Was wir Euch erzählt haben, ist die Wahrheit, Sir«, wehrte sich Sabin. »Wir waren betrunken, und die Blanche Nef stach ohne uns in See.«
»Und in deiner Trunkenheit bist du nicht nur einmal, sondern gleich mehrmals gestolpert?« David hob eine Augenbraue.
Sabin zuckte mit den Schultern. »Spielt es eine Rolle, was passiert ist? Wäre alles wie geplant gelaufen, lägen wir jetzt mit den anderen als Fischfutter am Meeresboden.«
»Werde nicht anmaßend.« David spannte die Kiefer an, so dass die Muskeln hervortraten. Er klang zwar immer noch ruhig, aber nicht mehr so freundlich wie vorher.
»Das lag nicht in meiner Absicht. Ich meinte nur, dass Ihr das Wesentliche wisst. Es gibt keinen Grund für Euch, Euch mit dem Unwesentlichen herumzuschlagen.«
»Diese Entscheidung überlass mal mir.« David verschränkte die Arme. »Wenn du es mir nicht erzählst, werde ich Simon fragen, aber ich würde die Geschichte gerne aus deinem Mund hören. Denn die Verantwortung trägst du, nicht dein Bruder.«
Sabin seufzte. »Da gibt es nicht viel zu erzählen. Simon hat zu viel getrunken und ist mit dem Kopf auf dem Tisch eingeschlafen.«
»Und du?«
Es wäre leicht zu lügen. Sabin überlegte, ob er sagen sollte, dass er wegen eines Würfelspiels in eine Prügelei geraten war, aber er wusste, dass die Wahrheit schließlich doch herauskommen würde. Wenn nicht hier in Roxburgh durch einen Versprecher, dann am Hof, wo sein Gesicht, egal in welchem Zustand, alles andere als willkommen war. »Ich wurde mit der jüngsten Mätresse des Königs im Bett erwischt«, gestand er. »Sie hat Heinrich überredet, noch bleiben zu können und später auf der Blanche Nef nach England zu segeln. Ich habe sie in eine Taverne mitgenommen. Zu dem Zeitpunkt hat Simon schon beim Wein geschnarcht.«
»Ich verstehe.« Davids Muskeln spannten sich noch mehr an, und seine Mundwinkel zogen sich leicht abschätzig nach unten. »Und dein Gesicht?«
Sabin zuckte mit den Schultern. »Der König war eifersüchtiger um seine Rechte besorgt, als ich dachte. Er hatte ein paar Männer dagelassen, die ihr nachspioniert haben … sie haben uns auf frischer Tat ertappt, und das ist das Ergebnis. Ich bin nicht stolz darauf. Ihr habt Recht, dass Ihr mich so anschaut. Lora ist tot. Ohne mein Drängen würde sie noch leben.«
David seufzte und stützte sein Kinn auf den aneinander gelegten Fingerspitzen ab. »Was soll ich bloß mit dir machen? Immer wieder gerätst du aus eigener Schuld in die Klemme. Wenn es nicht das Spiel ist, sind’s die Huren. Wenn es nicht die Huren sind, dann sind es Trinkgelage und Raufereien. Sicherlich wurde dir anderes beigebracht als das, oder? Was würde dein Vater sagen, wenn er dich jetzt sehen könnte?«
Darauf hatte Sabin nur gewartet. Jedes Mal, wenn er etwas angestellt hatte, wurde ihm sein Vater vorgehalten. »Da er tot ist, werden wir das nie erfahren, und auch wenn Ihr mit seiner Witwe verheiratet seid, habt Ihr kein Recht, ihm Worte in den Mund zu legen.« Er erhob sich so abrupt, dass er die Bank beinahe umwarf.
»Setz dich«, befahl David in eisigem Ton. »Ich bin noch nicht fertig.«
»Es gibt nichts, was ich noch hören wollte«, entgegnete Sabin. »Ich wünschte, ich wäre mit der Blanche Nef untergegangen. Es tut mir meinet- und Euretwegen Leid, dass dem nicht so ist. Wer weiß, vielleicht haben wir beide das nächste Mal mehr Glück.« Er drehte sich auf dem Absatz um und verließ das Zimmer. Gerade zu stehen und mit langen Schritten zu gehen, bedeutete Höllenqualen, die ihm seine Rippen und sein Bauch verursachten, doch sein Stolz zwang ihn dazu. Irgendwie erwartete er, dass David ihn zurückrufen oder Wachen schicken würde, aber es passierte nichts. Nur meinte er zu spüren, wie sich der Blick seines Stiefvaters in seinen Rücken bohrte.
Er wusste, dass er frech und unverschämt gewesen war, aber er hatte sich nur verteidigt. Wenn Prinz David ihn nicht abgeurteilt hätte, wäre Sabin vielleicht auch versöhnlicher gewesen. Abgesehen davon war er innerlich gespalten. Einerseits sorgte er sich wirklich darum, was sein Vater über ihn denken würde, doch andererseits war er immer noch wütend auf ihn, weil er tot war und alles, was er gefühlt oder gesagt haben mochte, mit ins Grab genommen hatte.
Rasch war er durch den Saal hinaus in den Hof gelaufen. Kalter Wind blies ihm entgegen, und das leichte Nieseln vom Vortag hatte sich zu einem stetigen, unerbittlichen Regen gewandelt. Ein Vorbote des Winters, dachte Sabin. Dieser stellte sich hier in den Bergen immer früher ein als im milderen Süden.
Einer der Ritter von Prinz David bereitete sich auf sein Fortgehen vor. Sabin kannte Edmund Strongfist nur vom Sehen und wusste von ihm nichts weiter, als dass er englische Vorfahren hatte, die nach Hastings von den Normannen verdrängt worden waren und sich auf der schottischen Seite der Grenze angesiedelt hatten. Als Strongfist seinem Pferd die Sporen gab und sich zum Tor wandte, sah Sabin, dass er in weiblicher Begleitung war. Von der Frau konnte er allerdings nur wenig erkennen, da sie dick vermummt war. Doch als sie vorbeiritt, meinte er, rehbraune Augen und ein Stück eines dunklen Zopfes zu erkennen. Sabin hatte keine Zeit, lange darüber nachzusinnen, weil das Paar weiterritt, im Gefolge ein bewaffneter Mann und ein Lastpferd. Zitternd stand Sabin im Hof, unentschlossen, ob er wieder hineingehen, sich ein warmes, verstecktes Plätzchen suchen und sich für den Rest des Tages verbergen sollte, oder ob er sich lieber auf den Weg in die Stadt machen, eine Ecke in der Taverne in Beschlag nehmen und Prinz Davids schlimmste Erwartungen erfüllen sollte. Der Anblick von drei Soldaten, die keinen Dienst tun mussten, brachte die Entscheidung, und er folgte ihnen über die Zugbrücke. Ihre Gesellschaft versprach Trost und Zusammenhalt, und ihnen würde es egal sein, was sein Vater über sein Verhalten denken oder nicht denken würde.
3
In seiner Trunkenheit wusste Sabin nicht mehr, wer angefangen hatte. Er wusste nur, dass der Kampf völlig unerwartet und mit der Wucht eines Sturms losgebrochen war. Vielleicht war jemand mit dem Ellbogen gerempelt worden und ein Bier war umgekippt, oder vielleicht war ein Würfel ungünstig gefallen, oder der Grund war ein schiefer Blick gewesen. Vom Alkohol angestachelt, wurde laut geschimpft, dann erhielt Sabin einen Schlag in seinen ohnehin schon empfindlichen Unterleib, so dass er mit weit aufgerissenem Mund zusammensackte und verzweifelt nach Luft schnappte.
Über ihm blitzte ein Messer auf. Es wurde noch lauter geschrien, und Sabin sah nur noch Umrisse und Schatten. Er ließ sich auf die Seite rollen, um der Klinge auszuweichen, verhedderte sich in seinen Umhang und stieß mit letzter Kraft die Füße gegen seinen Gegner, um nicht aufgespießt zu werden. Sein Angreifer stolperte, schlug mit dem Kopf an der Ecke der Holzbank auf und blieb ausgestreckt liegen. Sein Messer zuckte noch einmal in seiner Hand, dann fiel es ins Stroh. Das Schreien erstarb. Ein Soldat beugte sich über Sabin und dann über den Angreifer. »Robbie?« Er schüttelte seinen auf dem Bauch liegenden Kameraden an der Schulter, erhielt aber keine Antwort. Als er ihn auf den Rücken drehte, war klar, warum: In seinem Kopf prangte ein drei Finger breites Loch. Robbie war tot. Das Röcheln stammte von den Lebenden, die entsetzt zusahen. Robbie blickte zurück, ohne zu zwinkern oder sich zu bewegen.
Sabin versuchte aufzustehen, schwankte, fiel wieder hin und blieb liegen.
»Was wird jetzt mit Sabin passieren?«
Countess Matilda hielt mit ihrer Sticknadel mitten in der Bewegung inne und blickte zu ihrem Sohn auf. Simon war mehrere Minuten lang ziellos im Zimmer umhergewandert.
»Das wird dein Stiefvater entscheiden«, antwortete sie. Sobald die Nachricht von der Rauferei mit dem tödlichen Ausgang die Burg erreicht hatte, hatte David angeordnet, Sabin Fesseln anlegen und in den Kerker von Roxburgh sperren zu lassen. Matilda hatte ihren phlegmatischen Mann noch nie so nahe daran gesehen, die Kontrolle zu verlieren – geballte Fäuste, zuckende Nasenflügel und die Lippen so fest zusammengepresst, dass sie ganz weiß waren. Er hatte Mühe gehabt, seine Wut im Zaum zu halten. Sie vermutete, dass er Sabin hatte fortschaffen lassen, um einen zweiten Totschlag zu verhindern.
Mit finsterem Blick verschränkte Simon die Arme. »Es war doch nicht Sabins Schuld. Alle sagen das.« Er war kürzlich in den Stimmbruch gekommen und nun kippte seine Stimme vor Aufregung um.
»Das ändert nichts daran, dass ein Mann tot ist. Außerdem waren alle Zeugen so betrunken, dass sie sich am Morgen kaum erinnern konnten, wie sie heißen, geschweige denn daran, was den Abend zuvor passiert ist.« Sie schürzte die Lippen. »Gott sei Dank warst du nicht dabei.«
Trotzig stampfte Simon auf. »Das wäre ich aber gerne gewesen.«
»Das kann nur ein dummes Kind sagen«, fuhr Matilda ihn an, die sich in ihrer Sorge zu diesem Ton hinreißen ließ. Es kostete sie einige Mühe, sich wieder zu beruhigen. »Dein Stiefvater wird ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen, so wie immer, und das weißt du.«
Er warf ihr einen wütenden Blick zu. »Genau das habe ich Sabin über Euch erzählt, als wir in Barfleur waren. Aber er war bitter und hat gesagt, Euch wäre es lieber, wenn er nie geboren worden wäre.«
Matilda nahm ihre Stickerei wieder auf, als könnte sie mit Hilfe der stetigen Bewegung der Nadel ihre Gedanken ordnen. Sie ließ sich zwar nichts anmerken, aber Simons Worte hatte ihr schlechtes Gewissen wachgerufen.