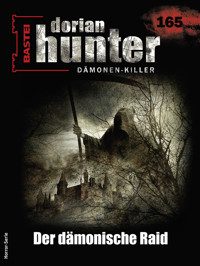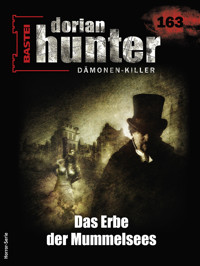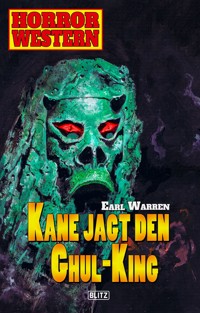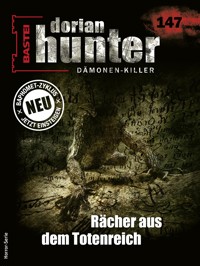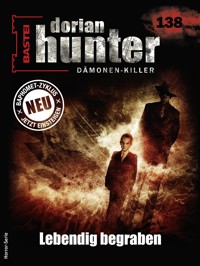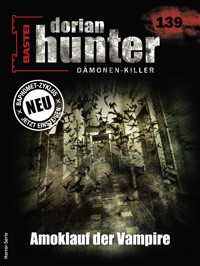2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Es ist ein sehr merkwürdiger Brief, den Jennifer Cunard eines Tages von ihrer Freundin erhält. Susan schreibt, dass ihr Vater, ein berühmter Ägyptologe, von einer Mumie auf schreckliche Weise ermordet wurde. Obwohl Jennifer nicht an solche Spukgeschichten glaubt, reist sie sofort nach Inverness, um Susan beizustehen. Als Jennifer wenig später ihre Freundin wiedersieht, erschrickt sie maßlos über deren schlechtes Aussehen. Außerdem stammelt Susan immer wieder etwas von einer »mordenden Mumie«. Jennifer zweifelt ernsthaft an Susans Geisteszustand. Doch schon bald muss sie feststellen, dass die Mumie tatsächlich existiert und Dinge inszeniert, die weitaus schlimmer sind als der Tod.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Earl Warren
Der Tod kam als die Mumie tanzte
Romantic Thriller
Es ist ein sehr merkwürdiger Brief, den Jennifer Cunard eines Tages von ihrer Freundin erhält. Susan schreibt, dass ihr Vater, ein berühmter Ägyptologe, von einer Mumie auf schreckliche Weise ermordet wurde. Obwohl Jennifer nicht an solche Spukgeschichten glaubt, reist sie sofort nach Inverness, um Susan beizustehen. Als Jennifer wenig später ihre Freundin wiedersieht, erschrickt sie maßlos über deren schlechtes Aussehen. Außerdem stammelt Susan immer wieder etwas von einer »mordenden Mumie«. Jennifer zweifelt ernsthaft an Susans Geisteszustand. Doch schon bald muss sie feststellen, dass die Mumie tatsächlich existiert und Dinge inszeniert, die weitaus schlimmer sind als der Tod.
1. Kapitel
Der gellende Schrei ließ Susan erwachen. Sie setzte sich in ihrem Bett auf. Noch war sie nicht richtig bei sich und glaubte schon, ein Traum hätte sie genarrt, als sie plötzlich einen weiteren Schrei vernahm.
»Hilfe! So helft mir doch! Susan, ruf schnell die Polizei! Mein Gott!«
Mit einem Mal war die junge Frau hellwach.
Es war die Stimme ihres Vaters. Sie klang so vom Grauen verzerrt, dass Susan sie kaum erkannte. Mit einem Sprung war sie aus dem Bett, und ohne den Hausmantel überzuziehen - obwohl es kühl war - riss sie die Balkontür auf.
Der Schrei war aus dem Garten erklungen. Susan trat auf den Balkon im ersten Stock des Herrenhauses in der Nähe von Inverness. Es war Nacht, wie spät, danach hatte Susan nicht gesehen. Grauer Nebel zog vom Moray Firth und dem Loch Ness über das Grundstück und lagerte darüber wie ein klammes Leichentuch. Bäume und Büsche des Parks, der zum Herrenhaus gehörte, wirkten geisterhaft.
Die Kugellampen im Park und die Außenbeleuchtung des Hauses brannten und gaben einen gelblichen Schein, in dem Susan alle Einzelheiten erkennen konnte. Das Herz wollte ihr stocken. Mit angehaltenem Atem verfolgte sie die Szene, ohne sich zunächst rühren zu können.
Ihr Vater stand in dem nebligen Park unter einem kahlen Baum, an dessen Stamm er sich stützte. Professor William McAndrews war vollständig angezogen. Er presste die rechte Hand auf sein Herz und schaute zur Hecke, hinter
der sich jemand oder etwas befinden musste, das ihn mit höchstem Entsetzen erfüllte.
Susan sah ihn. Zunächst schob sich ein mit weißen Binden umwickelter, mächtiger Arm in ihr Blickfeld. Ihm folgte die ganze Gestalt einer Mumie, die sich drohend dem Professor näherte. Professor McAndrews streckte ihr abwehrend die Hand entgegen.
Die Mumie erschien Susan riesig. Sie musste weit über zwei Meter groß sein. Von Kopf bis Fuß mit Bandagen umwickelt, bot sie einen erschreckenden Anblick. So ein Unwesen durfte nicht leben und umhergehen. Es hatte in einem Sarkophag zu liegen und seit Jahrtausenden tot zu sein.
Doch diese Mumie lebte. Von einer Energie erfüllt, die sich Susans Verständnis entzog, und voller Mordlust bewegte sie sich auf den bebenden Professor zu, die bandagierten Hände wie Krallen vorgereckt.
Nebelschwaden umwehten die Mumie und den Mann, auf den sie es offensichtlich abgesehen hatte. . Professor McAndrews hatte seine Tochter noch nicht gesehen. Er war wahrscheinlich überhaupt nicht in der Lage, etwas anderes zu sehen als die Mumie.
Gerade als sie ihn packen wollte, warf er sich herum, entwischte den wie Zangen nach seiner Kehle packenden Mumienhänden und rannte in den Nebel davon. Die Mumie verfolgte ihn mit ungelenken, jedoch schnellen und langen Schritten.
Ein heiseres Knurren und gutturale Laute drangen aus ihrer Kehle.
»Nein, mich wirst du nicht fassen!«, hörte Susan ihren Vater noch schreien.
Dann verschluckte der Nebel ihn und seinen unheimlichen Verfolger. Jetzt erwachte Susan aus ihrem starren Entsetzen. Sie musste endlich handeln, sie musste ihrem Vater helfen.
»Daddy!«, schrie sie voller Angst.
Noch einmal vernahm sie einen Laut. Es sollte das letzte sein, was sie je in ihrem Leben von ihrem Vater hörte. Voller Angst um den Vater lief Susan ins Schlafzimmer, schlüpfte hastig in die Pantoffeln und zog den Hausmantel über. Sie wollte die Polizei in Inverness verständigen und dann hinauslaufen und ihrem Vater beistehen.
Sie wusste, dass er im Schreibtisch seines Arbeitszimmers immer eine Pistole aufbewahrte. Susan wollte sie nehmen und ihrem Vater und der Mumie folgen. Dem letzten Schrei nach musste er in Richtung des Daviot-Moors gelaufen sein. Dort drohte schon bei Tag und ohne Verfolger Gefahr.
Jetzt aber, in seiner Panik, würde der Professor bestimmt in ein Sumpfloch laufen. Oder aber, was noch schlimmer wäre, die Mumie würde ihn einholen.
Susan wollte die Treppe hinunterlaufen ins Erdgeschoß. Doch schon auf der zweiten Stufe spürte sie plötzlich einen Ruck am Fuß, als ob jemand ihn festhalten würde. Susan stürzte vornüber und fiel die Treppe hinunter.
Den Aufprall spürte sie kaum noch. Bewusstlos blieb sie liegen.
*
»Speit Tod und Mord der Hölle Schlund, steh ich dir bei in schwerer Stund.«
Jennifer Cunard schüttelte den Kopf. »Mit diesen Knüttelversen kannst du mich auch nicht begeistern oder von unseren wirklichen Problemen ablenken, Mark. Ich habe endgültig beschlossen, unsere Beziehung zu beenden. Wir haben einfach zu grundverschiedene Lebensanschauungen.«
»Ah, und das fällt dir jetzt auf, nach vier Jahren«, sagte Mark Ferguson vorwurfsvoll.
Er saß neben Jennifer auf einer Bank im noch kahlen Park im Zentrum von Aberdeen.
Jennifer war dreiundzwanzig, vier Jahre jünger als er. Sie hatte halblange braune Locken, blaue Augen und eine etwas zu kleine Nase. Mittelgroß war sie und schlank. Jennifer äußerte sich gern geradeheraus.
Mark, blond und hochgewachsen, überragte sie um einen ganzen Kopf. Er hatte graue Augen, eine gebogene Nase und kleidete sich eher nachlässig, während Jennifer Wert auf eine gewisse Eleganz legte.
Mark fuhr fort: »Doch eine Liebe so groß, so grenzenlos, wie die unsere, gab es nie. So liebten Ältere nie, so liebten Weisere nie, und wären die Engel auch noch so scheel, sie trennten doch nicht meine Seel von der Seel...«
»... der lieblichen Annabel Lee«, ergänzte Jennifer das dichterische Können ihres Freundes. »Das gefällt mir schon besser. Allerdings ist es von Poe, nicht von dir. Versuch nicht mehr, mich abzulenken, Mark. Hast du denn nicht gehört, was ich gerade gesagt habe?«
Mark vergrub die Hände in den Taschen seines Burberrys. Er sah traurig drein.
»Ist das wirklich dein letztes Wort, Jennifer?«
»Mein allerletztes.«
»Aber warum denn, warum? Ich liebe dich mehr denn je. Es war doch so schön zwischen uns.«
»Ja, und jetzt ist es vorbei. Wir haben einfach zu unterschiedliche Ansichten,
Mark. Sieh einmal, du bist Kriminalist. Dass du in deiner Freizeit Gedichte schreibst und musische Interessen pflegst, täuscht nicht darüber hinweg, dass du ein kritischer, misstrauischer Geist bist. Du verfolgst Kriminelle. Du stellst ihnen Fallen, du überlistest sie. Du verstehst sogar, dich in die Denkweise von Verbrechern hineinzuversetzen. Das hast du gelernt. Manchmal frage ich mich, was dich eigentlich von den Verbrechern unterscheidet.«
Mark schaute betroffen drein. »Wie kannst du das sagen, Jennifer. Es muss Gesetze geben, ohne sie funktioniert das menschliche Zusammenleben nicht. Und es muss eine Polizeibehörde geben, die Verbrechen aufklärt, die Täter ermittelt und festnimmt und sie der Justiz zur Aburteilung übergibt. Ich bin Inspektor bei der Aberdeener Kriminalpolizei. Für meine siebenundzwanzig Jahre ist das schon recht ordentlich. Was ist verkehrt daran? Warum gefällt es dir nicht? Betrachte es doch einmal von diesem Standpunkt aus. Du studierst Medizin und willst einmal Ärztin werden. Ein Chirurg zum Beispiel schneidet erkranktes Gewebe aus dem Körper und sorgt dafür, dass der Patient genesen kann. Die Gesellschaft ist wie der menschliche Körper. Krankheitserreger müssen bekämpft werden, weil sonst das Ganze darunter leidet oder sogar zugrunde geht.«
»Der Arzt hilft den Menschen. Er dient der Gesundheit. Seine erfolgreiche Arbeit verlängert das Leben, heilt oder lindert Leiden und erzeugt Positives. Was ist das Ergebnis deiner Arbeit? Verurteilungen, Unglück und Hass.«
»Bei den Schuldigen, ja, aber das haben sie sich doch selbst zuzuschreiben. Stifte ich jemanden zu Verbrechen an oder begünstige sie? - Nein. Auch ich bewirke Positives.«
»Du wühlst im Schmutz. Du beschäftigst dich ständig mit Kriminellen, mit
Übeltätern. Das färbt auch auf dich ab und auf die Menschen, mit denen du zusammenlebst.«
»Na, na«, sagte Mark. »Dann würde ja jeder Priester heilig, nur weil er die Messe hält und predigt. Ärzte müssten nach deiner Theorie ständig krank sein. Da dürfte eigentlich keiner die ersten fünf Berufsjahre überleben.«
»Ich will nicht weiter mit dir diskutieren, Mark. Es tut mir leid. Ich kann dich nicht heiraten. Es ist vorbei zwischen uns.«
Jennifer wollte aufstehen. Doch Mark hielt ihre Hand fest.
»Steckt ein anderer Mann dahinter?«, fragte er eifersüchtig. »Ist es ein Arzt? Einer von deinen Kommilitonen?«
»Es ist kein anderer Mann, Mark. Es verhält sich so, dass ich festgestellt habe, dass ich mit dir nicht leben kann. Unsere Beziehung hat keine Zukunft.«
»Beziehung. Wie sich das anhört. Ich habe immer von Liebe gesprochen.«
»Was du dafür hältst«, erwiderte Jennifer. Sie küsste Mark auf die Wange. »Lass uns im Guten auseinandergehen. Versuch nicht, mich in der nächsten Zeit anzurufen oder zu besuchen. Ich fahre für längere Zeit weg.«
»Ja, aber dein Studium ...«
»Du weißt doch, dass ich Semesterferien habe.«
Jennifer küsste Mark noch einmal, diesmal auf den Mund. Es fiel ihr schwer, ihre Lippen von seinen zu lösen. Ihre Knie wurden weich. Doch sie musste jetzt standhaft bleiben und gehen. Sie liebte Mark nicht mehr so wie am Anfang. Vielleicht würde eine Trennung eingeschlafene Gefühle wieder erwachen lassen. Es wäre schön, dachte Jennifer, doch man musste abwarten.
Jennifer riss sich abrupt von ihm los und ging davon. Sie musste diese Minuten jetzt durchstehen, auch wenn sie die bittersten ihres Lebens waren. Wie gern hätte sie Mark jetzt in die Arme genommen und getröstet, doch sie durfte jetzt nicht schwach werden. Sie drehte sich noch einmal um und sah direkt in Marks tief bestürztes Gesicht.
Jennifer zweifelte plötzlich daran, ob ihr Entschluss, diese Beziehung zu beenden, wirklich richtig gewesen war. Doch dann sagte sie sich auch, dass ihre Liebe zu Mark nur dann dauerhaft sein könnte, wenn sie jetzt weiterging. Sie brauchte eine Pause von Mark, eine räumliche und eine innerliche Entfernung.
Mark stand noch immer da wie gebannt, während zahlreiche Spaziergänger an ihm vorbeigingen, die das schöne Wetter ins Freie gelockt hatte.
Jennifer beschleunigte ihren Schritt, so sehr sie konnte. Tränen standen ihr in den Augen, und sie sah ihre Umgebung wie durch einen Nebelschleier.
Unaufhörlich hämmerte eine Frage in ihrem Kopf: War ihr Entschluss, Mark zu verlassen, richtig gewesen?
Die ersten zwei Jahre ihrer Liebe waren schließlich wunderbar gewesen. Doch dann hatte Jennifer allmählich ein kritisches Bewusstsein entwickelt, dass sie ihre Umwelt und auch Mark mit anderen Augen sehen ließ.
Er war dafür ziemlich blind gewesen. Erst neulich hatte er ihr einen Heiratsantrag gemacht, nachdem er in eine höhere Besoldungsstufe aufgerückt war. Zudem glaubte er, sie seien nun lange genug zusammen und es wäre an der Zeit, die Ehe zu schließen.
Jennifer konnte ihre Zukunftsvorstellungen jedoch partout nicht mit einer Ehe mit Mark in Einklang bringen. Er war einfach nicht der richtige Mann für sie. Sie wollte ihr Studium beenden, dann würde sie weitersehen. Innerlich hatte sich Jennifer bereits von Mark gelöst, wie sie glaubte.
Deshalb war sie jetzt von dem Schmerz überrascht und von dem tiefen Abgrund, in den sie hineinfiel. Ein Teil von ihr klammerte sich an Mark. Er flüsterte ihr zu, sie solle wieder umkehren und Mark in die Arme schließen, ihm sagen, es wäre alles nicht wahr, alles sei gut, und sie habe es sich überlegt und wolle ihn heiraten.
Sie wollte Mark wieder so lieben wie früher, und für alles würde es eine Lösung geben. Doch Jennifer wusste auch, wenn sie jetzt schwach wurde, würde das nur der Anfang einer langen Kette von Entscheidungen sein, die sie gegen ihr eigenes Ich und ihren Verstand fällte.
Jennifer lief zur Straßenbahn. Sie sah Mark aus dem Park kommen. Er winkte und rief verzweifelt hinter ihr her. Zum Glück fuhr gerade eine Straßenbahn an die Haltestelle. Rasch stieg Jennifer ein. Mark konnte die Bahn nicht mehr erreichen. Jennifer wandte den Kopf zur Seite, als die Straßenbahn an ihm vorbeifuhr.
Sie konnte Mark jetzt nicht in die Augen sehen. Sonst stieg sie vielleicht doch noch aus, und dann ...
Ein Kriminalist konnte ihr niemals das geben, was sie brauchte und sich unter einer Partnerschaft vorstellte. Es war unmöglich!
Die Straßenbahn bog bimmelnd um die Ecke. Mark blieb stehen - allein und verlassen. Jennifer hielt sich krampfhaft am Haltegriff fest.
»Warum weinst du denn?«, fragte sie plötzlich ein kleiner Junge, der ebenfalls mitfuhr.
»Mir tut etwas weh«, antwortete Jennifer. Sie versuchte zu lächeln, doch es missglückte kläglich.
»Ist dir jemand auf den Fuß getreten?«, fragte der Knirps treu. »Dann weine ich auch.«
»So ähnlich«, erwiderte Jennifer.
Aufs Herz, dachte sie.
Jennifer wollte nach Inverness reisen, um ihre« Freundin Susan McAndrews zu besuchen. Sie kannte Susan aus ihrer gemeinsamen Internatszeit. Da waren sie jahrelang die besten Freundinnen gewesen - Susan, die einzige Tochter eines berühmten Ägyptologen, und Jennifer, die Tochter eines Hoch- und Tiefbau-Ingenieurs. Während sich Susans Vater, ein Witwer, oft zu Ausgrabungen im Ausland befand und seine Tochter daher ins Internat gegeben hatte, hatte sich Jennifer mit der zweiten Frau ihres Vaters, die zwei eigene Kinder mit in die Ehe brachte, nicht vertragen.
Jennifer hatte von sich aus darum gebeten, ein Internat besuchen zu dürfen, um nicht mit der ungeliebten Stiefmutter und deren Rangen unter einem Dach zu leben. Ihrem Vater war es zwar nicht recht gewesen - er hätte lieber ein herzlicheres Verhältnis und eine intaktere Familie gehabt - aber er hatte es nicht ändern können.
Jennifer war in Sorge um die Freundin. Susan hatte ihr in letzter Zeit allerlei seltsames Zeug geschrieben. Ihr Vater war kurz zuvor unter merkwürdigen Begleitumständen ums Leben gekommen. Anscheinend wirkte sich das auf Susans Geisteszustand aus.
Jennifer war der Ansicht, dass die Freundin sie jetzt dringend als Beistand brauchte. Zudem war Susan gerade im Moment recht froh, aus Aberdeen wegzukommen, wo sie wohnte und studierte und alles an Mark Ferguson erinnerte. In einer fremden Umgebung konnte sie am besten zur Ruhe kommen und ihren Liebeskummer vergessen. In Inverness würde sie genug Muße haben, um sich über ihre Gefühle zu Mark klar zu werden.
Jennifer wusste, es würde eine schwere Zeit werden, aber sie hoffte deswegen um so mehr, den richtigen Weg für ihre Zukunft zu finden - sei es mit Mark oder ohne.
*
Ihr Gepäck hatte Jennifer schon zur Bahn gebracht, das meiste aufgegeben und ihr Handgepäck in ein Schließfach gestellt. Wegen der Studentenbude, die sie mit einer Freundin teilte, war auch alles geregelt. Jennifer brauchte deshalb nicht mehr zu der Wohnung, wo Mark bestimmt über kurz oder lang auftauchen würde.
Jennifer verließ die Straßenbahn am Hauptbahnhof, holte ihr Handgepäck aus dem Schließfach und verbrachte die Zeit bis zur Abfahrt des Zugs im Wartesaal 1. Klasse. Von Aberdeen nach Inverness verkehrte der Trans-Caledonian-Express, dem Jennifer um 15.30 Uhr auf dem Bahnhof von Inverness entstieg.
Vergeblich schaute sie sich auf dem Bahnsteig nach ihrer Freundin Susan um. Sie hatte am Vorabend mit Susan telefoniert und ihr genau mitgeteilt, wann sie eintreffen würde. Der Zug hatte keine Verspätung gehabt. Der Bahnsteig leerte sich rasch von den Reisenden, die den Trans-Caledonian mit ihr verlassen hatten. Jennifer stand verloren auf dem Bahnsteig, ihr Köfferchen vor den Füßen, wie bestellt und nicht abgeholt.
Sie schaute sich immer wieder nach Susan um. Ein Dreivierteljahr hatte sie die Freundin nicht gesehen.
Warum kam Susan bloß nicht? Sie war eigentlich immer pünktlich gewesen. Jennifer beschloss, sich auf eine Bank zu setzen und zu warten. In dem Moment trat ein mittelgroßer junger Mann mit Hornbrille auf sie zu.
Er hatte zahlreiche Sommersprossen und bewegte sich ungelenk. Seine Hände und Füße besaßen Proportionen, als ob sie für einen weit größeren Men-
sehen vorgesehen gewesen waren und er sie nur aus Versehen erhalten hätte. Der junge Mann lief ständig Gefahr, über die eigenen Füße zu stolpern.
Er verneigte sich leicht vor Jennifer, die ihn amüsiert anschaute, und fing an zu stottern: »S-s-sind S-Sie M-Miss Jennifer Cunard?«
»Seit meiner Geburt. Mit wem habe ich das Vergnügen?«