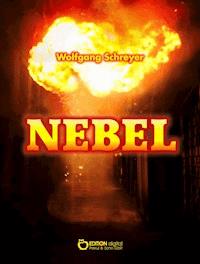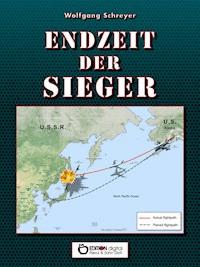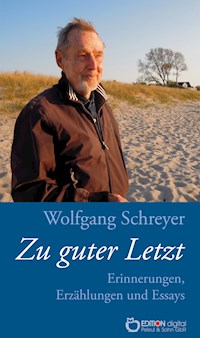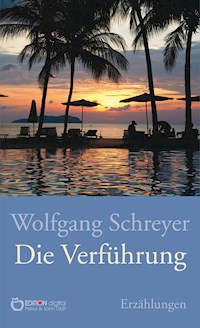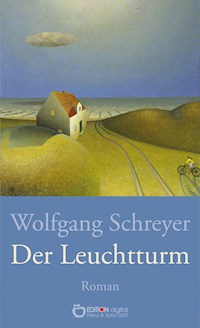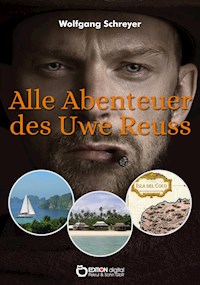7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Zwei Eigenschaften zeichnen die Texte von Wolfgang Schreyer aus: er schreibt immer abenteuerlich und spannend, sie fesseln den Leser. Und Schreyer schreibt immer politisch und auf der Grundlage gut und präzise recherchierter Fakten. Das gilt auch für diese beiden Texte, die sich mit sozialen Kämpfen in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts in Lateinamerika und in Portugal befassen. In der ersten der beiden Erzählungen, die in Uruguay spielt, stellt sich zunächst der Erzähler vor, der eine Niederlage erlitten hat. Sein Vater, von dem er sich losgesagt hat, ist übrigens ein Armee-Oberst und steht auf der anderen Seite: Jetzt will ich alles, was passiert ist, aufschreiben, und zwar ohne es zu glätten oder Wesentliches wegzulassen; sonst würde es wertlos. Ich schreibe in meiner Stenografie, die außer mir niemand lesen kann. Der Bursche, den mein Vater mir ans Bett gesetzt hat, damit er mich vor Mördern schützt, nimmt den Text immer mit, wenn er abgelöst wird. Er ist dem Oberst ganz ergeben, ich riskiere also den Verlust der Blätter nicht. Bisher hab ich über die Erfahrungen unseres Kampfes, über meine Haltung zur Partei – in den Meinungsverschiedenheiten der Leitung – Vertrauliches nie zu Papier gebracht. Dazu war keine Zeit, auch schien mir, es könnte schaden. (Aus Furcht, unserer Sache zu schaden, schaden wir unserer Sache.) Aber nun, bis zur Brust in Gips, bleibt mir nichts anderes übrig. Na ja, ihr werdet sehen, wie schön es ist, Theoretiker zu sein! Denken ist Leben, für mich jetzt Medizin; und die Analyse von Niederlagen kann genauso befriedigen wie die von Siegen. Die zweite Erzählung „Die Durststrecke“ spielt etwa ein Jahrzehnt später im Nach-Nelkenrevolution-Portugal Ende 1975: Der Brunnenbau-Ingenieur Luís Branco, der den trockenen Alentejo bewässern hilft, bekommt Schwierigkeiten mit den Menschen, denen er doch helfen will – armen Bauern, die Angst um ihr Wasser haben: Sie taten so, als lauschten sie, bereit, seinen Erguss taktvoll zu überhören, ihm zu erlauben, das Gesicht zu wahren. Er wollte es kurz machen, ihre Höflichkeit nicht ausnutzen, aber nun brach es doch aus ihm heraus: „Ich bin ja nicht bloß Ingenieur, der seine Arbeit tun möchte, sondern auch Portugiese, der das Volk achtet und sein Bestes will. Deshalb sehe ich in diesem Boykott mehr als den Irrtum, den Schaden und Verlust. Dieser Boykott ist nämlich auch ein Kind der Revolution – Teil des demokratischen Kampfes auf dem Lande; eine Aktion, die mich trotz allem stolz macht.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Schreyer
Die Entführung
Zwei Erzählungen
ISBN 978-3-86394-105-5 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1979 beim Mitteldeutschen Verlag Halle/Saale
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2012 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Die Entführung
Prolog
Für Mélida Turcios Lima und Mario Tobias
Politik in einem literarischen Werk ist wie ein Pistolenknall mitten in einem Konzert, sie wirkt roh und plump, und doch kann man ihr seine Aufmerksamkeit unmöglich versagen.
Stendhal
Jetzt will ich alles, was passiert ist, aufschreiben, und zwar ohne es zu glätten oder Wesentliches wegzulassen; sonst würde es wertlos. Ich schreibe in meiner Stenografie, die außer mir niemand lesen kann. Der Bursche, den mein Vater mir ans Bett gesetzt hat, damit er mich vor Mördern schützt, nimmt den Text immer mit, wenn er abgelöst wird. Er ist dem Oberst ganz ergeben, ich riskiere also den Verlust der Blätter nicht.
Bisher hab ich über die Erfahrungen unseres Kampfes, über meine Haltung zur Partei – in den Meinungsverschiedenheiten der Leitung – Vertrauliches nie zu Papier gebracht. Dazu war keine Zeit, auch schien mir, es könnte schaden. (Aus Furcht, unserer Sache zu schaden, schaden wir unserer Sache.) Aber nun, bis zur Brust in Gips, bleibt mir nichts anderes übrig. Na ja, ihr werdet sehen, wie schön es ist, Theoretiker zu sein! Denken ist Leben, für mich jetzt Medizin; und die Analyse von Niederlagen kann genauso befriedigen wie die von Siegen.
Freude am kritischen Denken, die weckte vor allem Professor Córdova in mir, unser Lehrer für Finanz- und Arbeitsrecht an der Universität San Carlos – obschon ein Liberaler, der sich manchmal abwegig äußert. So sagte er etwa, skurril vom Stoff abschweifend, keine einzige Ideologie sei fähig, die Bewegungsgesetze der Welt ganz zu erklären, stets bliebe da ein bedauerlicher Rest. Selbst wenn man, wie es ihm vorschwebe, fünf Prozent aller gesellschaftlichen Dinge mit Hilfe einer Rassentheorie, 30 Prozent mit der Lehre von Freud und 60 Prozent marxistisch deute, so seien noch immer unbekannte Faktoren am Werk, unerforschte und auch unberechenbare, wie irrationale Leidenschaften oder der historische Zufall! Dies verkündete er uns mit Emphase.
Gern hätte Córdova, das gab er schon zu, sich ganz zum Marxismus bekannt. Doch es gelang uns beispielsweise nicht, ihn davon zu überzeugen, dass in unserem Land dereinst die Arbeiterklasse die führende Kraft sein werde. Vorhanden war sie ja, nur viel zu schwach, zu wenig klassenbewusst – das räumten wir ihm ein. Wir sollten, stieß er dann gleich nach, uns doch mal selbst ansehen, wie viel Proletarier seien wir denn? Einer auf zehn bestenfalls!
Blanca, unser As in Theorie (wir nannten sie La Importante, die Wichtige) konterte im besten Jargon: "Der Kampf für den Sieg der Arbeiterklasse schließt nicht aus, dass zeitweilig auch andere revolutionär-demokratische Kräfte an der Spitze der Volksbewegung stehen, wie das auf Cuba gewesen ist, und dass es unter den Bedingungen der terroristischen Militärdiktatur eben bewaffneter Kampf sein muss!" Dann grinste der kleine Hector Córdova sie an, sein Gesicht überzog sich mit hundert Querfältchen, und er fragte: "Wo ist sie denn, eure Volksbewegung? Warum gebt ihr nicht einfach zu, dass ihr an die Macht wollt, und zwar gewaltsam, ohne demokratische Legitimation?"
Auf den Professor komme ich noch zurück. Er hat uns ebenso geschafft wie El Caudillo oder, auf die weinerliche Tour, der jammervolle Don Fernando... Aber von nun an der Reihe nach.
1
Die Sache begann vor gut einem Jahr, im Mai 1965. Natürlich reicht meine Geschichte weiter zurück, doch ich will mich auf diese Aktion beschränken. Damals nämlich, im vorletzten Mai, spürte ich allmählich Veränderungen um mich; anfangs rein instinktiv. Es mehrten sich gewisse Situationen, wie man sie aus Gangsterfilmen kennt. Wenn etwa nachts gelegentlich das Telefon klingelt, wenn sich bei verschwiegenen Wanderungen am Zaun des Botanischen Gartens Silhouetten bewegen und, geht man auf sie zu, zu unglaubwürdigen Posen verliebter Pärchen erstarren, wenn gegenüber deinem Haus ein Typ so tut, als lese er Zeitung oder warte auf den Bus, in den er dann nicht steigt – da begreifst du, dass es Zeit wird, zu verschwinden. Es ging nicht mir allein nur so. "Beim ersten Mal kann's Zufall sein", hatte Herbert gesagt – so heißt Luis Turcios Lima bei uns; "beim zweiten Mal vielleicht noch Pech. Beim dritten Mal ist es mit Sicherheit der Feind."
Natürlich hing dieser kaum merkliche Wandel mit bestimmten Entwicklungen inner- und außerhalb des Landes zusammen. Soeben war der Armeeoberst Molina erschossen worden, derselbe Gangster, dem Herbert schon drei Jahre zuvor die Attrappe einer Bombe, an der eine Warnung hing, ins Auto geworfen hatte. Mein Vater, als Waffengefährte, regte sich sehr auf, doch ich wies ihm nach, dass Molina der ranghöchste Verbindungsmann zum nordamerikanischen Geheimdienst gewesen und für etliche Morde verantwortlich war. Dann richtete meine Gruppe in der Zone VI den Polizeichef Napoleon hin, nebst einem früheren Batista-Mann, der diesen Mafioso beraten hatte. Auf der Atlantik-Straße nahm Herbert eine ganze Kompanie gefangen, während die Armee ergebnislos nach ihm die Berge absuchte... Die Armee zeigte sich all dem überhaupt nicht gewachsen, wie mein Vater erbittert feststellte. Außerdem waren die Yankees gerade in Santo Domingo gelandet, um ein "zweites Cuba" zu verhindern: die freie Welt war in Gefahr.
Gleich ein paar Worte zu meinem Vater. Es fehlt mir da gar nicht an Mitgefühl. Sein Vater wiederum hatte es schon mit vierzig zum General gebracht, vor dem 44er Umsturz, als es bei uns den Rang noch gab. Der General Otto Valdés Frey (meine Urgroßmutter kam aus Deutschland) muss ein bewunderter und gehasster, jedenfalls ein dominanter Mann gewesen sein – das hat es dem Sohn nicht leicht gemacht. Vater ist ja empfindsam, eine künstlerische Natur, eigentlich wollte er malen, wurde aber Militär. Niemand fragte je nach seinen Bildern. Man kam eben nicht auf die Idee, er könne noch etwas anderes im Auge haben als die Karriere. Denn er war stets seriös, höchst korrekt und auch bei starker Gemütsbewegung beherrscht; in seiner Unbeholfenheit manchmal rührend. Kein Denker, eher ein fleißiger Merker mit einem Hang zur Akkuratesse, deutsches Erbgut wohl, in seinen Malutensilien, und nicht nur dort, herrscht mustergültige Ordnung.
Heute ist er einer unserer zahlreichen Obristen – es müssen an die hundert sein, immer einer auf sechzig Mann – ohne viel Einfluss. Ein Dutzend von denen hat sich nämlich den Kuchen geteilt, de facto die Generalität. Die nimmt ihn nicht auf, das weiß er bestimmt; er kennt seine Grenzen. Er ist ein weicher, anpassungsfähiger Mensch, der um der Familie willen gern ein Herr geworden wär, ein großer Mann, aber nie herausgefunden hat, wie man das macht; zumal wenn alle drei, vier Jahre das Regime wechselt. Als Stellvertreter des Chefs der Rückwärtigen Dienste versteht er eine Menge von Logistik, hat das ganze Arsenal unter sich, kommt selber aber nicht mal an eine Bazooka heran, weil er bloß am Schreibtisch sitzt, über all den Bestands-, Verlust- und Beschaffungslisten. Ein paar der Granatwerfer, Maschinengewehre und M 3-Karabiner, die ihm als vermisst gemeldet wurden, gehören zu unserer Ausrüstung.
Ich konnte jederzeit auffliegen, im Mai 65, die Gruppe als ganzes gefährden, da blieb mir nur, in den geschlossenen Untergrund zu gehen. Aber ich wollte das nicht schweigend tun, sondern es ihm wenigstens andeuten; mit meiner Schwester verband ihn wenig, im Grunde, als Gesprächspartner, hatte er nur mich. Und wider Erwarten begriff er sofort, ich sah's ihm an, sein Gefühl schien ihm seit langem gesagt zu haben, was ich wirklich trieb, wenn ich vorgab, ein Mädchen auszuführen oder übers Wochenende mit Kommilitonen zu feiern – weit draußen vor der Stadt, wo wir unsere Ausbildung bekommen und dann selber die Neuen ausgebildet hatten. Doch er zog es vor, seine Ahnungen zu verdrängen und mich misszuverstehen.
Was denn, Marc, weg von der Uni – vorm Examen?
Bitte, besorg mir einen Pass.
Mein Gott, wohin willst du?
Ich bleibe in der Stadt, vorläufig.
Mach Schluss damit, Junge, gib es auf!
Das kann ich nicht, Vater.
Was ändert ihr? Du rennst ins Unglück, sie fassen dich!
Nein – eben deshalb geh ich ja.
Muss das sein? Das hat Folgen, auch für uns.
Mehr als Oberst kannst du doch nicht werden.
Und Mutter? Das darfst du ihr nicht antun.
Es ist Zeit für mich...
Wenn du uns verlässt, dann komm niemals wieder!
Das war sein letzter Satz gewesen, und ich wusste, es war ihm ernst.
Im Herbst, nach meinem Untertauchen, stockte der Kampf; wir traten nur noch auf der Stelle. Es mangelte uns an allem – Quartiere, Waffen, Geld, aber das war nicht der einzige Grund. Die nationale Leitung des Widerstands hatte uns als Operationsgebiet die Hauptstadt angegeben, man nannte sie "das neuralgische Zentrum des Krieges" – ein dramatisches Bild, keine Orientierung. Noch sahen wir nicht das Fehlen einer Strategie, damals vermissten wir nur die klare Führung. Es konnte doch nicht Aufgabe der Leitung sein, Verstecke anzulegen und die spärlichen Waffentransporte zu steuern, meist zaghaft und im letzten Moment. Das, so fand ich, war schon Sache der Gruppen selbst. Aber auch wir versäumten oft unsere Pflicht, lebten zu sorglos und hielten uns für den Vortrupp, sobald wir einen Schusswechsel bestanden hatten. Nirgends eine Anleitung zum Handeln, alles lief so im Trott, wir überlebten nur dank der Einfalt und Feigheit des Feindes.
Die Unzufriedenheit wuchs, und da wir sie nicht einmal artikulieren konnten, ergriff Blanca (La Importante) wieder das Wort. "Die Frage des Widerstands in diesem Land", erklärte sie uns, als stünde der revolutionäre Kleinkrieg weltweit zur Debatte, "ist nicht die des Überlebens, sondern die der Entwicklung. Ob wir nun Spitzel jagen oder Bomben legen, entscheidend ist nicht das Angriffsobjekt; das wechselt von Fall zu Fall. Es geht um unsere Ziele..."
"Ich verstehe kein Wort", warf Jorge ein. "Ein wahrer Vortrupp wird durch Taten und nicht erzählend aufgebaut. Und für Taten brauchst du allerdings ein Ziel." Jorge Délano hatte nur die Handelsschule besucht, sein Ausdruck war arm, doch wir spürten, er hatte ebenso recht wie Blanca.
"Ich spreche von den großen Zielen! Dem Weg dahin! Der entscheidende Mangel liegt doch im Fehlen einer Analyse der konkreten Situation, der Strategie des Feindes und unserer eigenen", dozierte sie weiter. "Natürlich fehlen uns Kader und noch mal Kader, aber die bilden sich nur im Kampf heraus und nicht als Theoretiker im stillen Kämmerlein."
Dagegen war überhaupt nichts zu sagen, es blieb bloß, wie meist bei ihr, viel zu allgemein. Ich starrte sie an, suchte vergebens nach den kleinen Brüsten, die sich an ihrem Hemd doch irgendwo abzeichnen mussten; sie war schlank wie ein Knabe, von dem kühlen Charme einer Seejungfrau... Wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, dass meine Kritik an ihr immer sehr bald umschlug in pures Verlangen – recht befremdlich, doch ich will mich nicht in Psychologie verlieren. Die Liebe ist hinreichend beschrieben worden, "obligatorischer Drehzapfen aller Poesie" hat Engels sie mal genannt, dem lässt sich kaum noch was hinzufügen.
Zu dieser Zeit, so im Oktober, war ich zum Chef unserer Gruppe gewählt und von der Parteiführung bestätigt worden. Ich will nicht hoffen, dass dabei die Militärtradition meiner Familie mitgespielt hat: General Valdés' schändlicher Einfall in El Salvador oder die Stellung meines Vaters; sie wurde ja weit überschätzt. Immerhin wusste man, er hatte mit mir gebrochen. Auch bin ich gar nicht sehr mutig, im Gegenteil. Zu meinen frühesten Erinnerungen gehört der große Spiegel in der Halle unseres Hauses, sie war von Blättern verschattet, ziemlich düster, und es kostete mich stets Überwindung, am Spiegel vorbeizugehen, in dem jene Gestalt – mein Ebenbild – sich zeigte, aufhuschte und mich ängstigte. Um diesen Spuk zu bannen, pflanzte ich mich schließlich vor den Spiegel und schnitt Grimassen, so schlimm, bis ich wiederum tödlich erschrak und davonlief, mit hämmerndem Herzen... Nun wisst ihr, wer euer Kampfkommandant gewesen ist.
Vermutlich wurde ich es dank des Einfalls, der uns heraushob aus Armut und Stagnation. Er kam mir in Blancas Gegenwart. Sie war ja, wie die meisten von uns, ständig darauf aus, Ideen in Leben, Theorie in Praxis umzusetzen, wo immer sich eine Chance bot. "Ich will gern sauber bleiben, nur wie?" hatte sie zu Beginn unserer Bekanntschaft einmal gefragt. "Ich will gern ganz fest glauben, nur an was? Und einen Freund will ich haben, aber wen?"
"Na, mich", stieß ich heiser heraus, versengt von ihrer Ausstrahlung. Die lag übrigens mehr im Glanz ihrer Augen, in der Frische des Gesichts und der Bewegungen als in irgendwelchen Geschlechtsmerkmalen; an ihr reizte gerade das Fehlen jeglicher Werbung, die Abwesenheit der üblichen Art von Sex. Was band sie an mich? Ich war eben schon lange dabei, für sie ein Veteran, und als man mich zum Chef machte, ließ sie gar nicht mehr von mir. Da wurde ich, wie es scheint, zum Vehikel ihres Drangs, etwas Besonderes zu sein.
"Fangio", sagte ich zu ihr, "erinnerst du dich wenigstens an den Namen?" Natürlich entsann sie sich nicht, es war ja fast acht Jahre her, dass ein Kommando des "26. Juli" das argentinische As kurz vorm Rennen um den Großen Preis von Habana aus dem Hotel entführt und anderntags mit einer höflichen Entschuldigung vor seiner Botschaft abgesetzt hatte. So was ließ die Konzernpresse sich nicht entgehen, und bald war Fidel Castro in den USA so populär, dass man dort Fidel-Puppen und Guerillero-Zubehör für Kinder auf den Markt warf, ja sogar von einem "Fidelito"-Cha-Cha-Cha Schallplatten presste.
"Na schön", sagte Blanca, die alles gleich einzuordnen wusste, "das war ein politischer Effekt. Aber wen willst du hier greifen? Die wichtigen Leute haben Leibwächter, die sind gründlich gedeckt."
"Sie müssen nicht wichtig sein – nur reich. Was wir nämlich brauchen, ist Geld. Dafür kriegst du alles: Waffen, Autos, Häuser... Und darauf sind sie nicht gefasst. Das hat Erfolg, weil es ihnen völlig neu sein wird, dass wir bloß auf Geld aus sind."
Blanca begriff und akzeptierte dies, bestand aber darauf, nicht von Geld zu reden, sondern es "die Etappe des Kampfes um die unmittelbaren Lebensinteressen des Widerstands" zu nennen. Sie erfand auch Schlagworte wie "Finanzierungsaktion" und "ökonomische Entführung", Begriffe, mit denen wir die Sache dann nach oben und unten verkauften – der Leitung wie der Basis.
Ihr Engagement war total. "Das muss die Diktatur erschüttern", rief sie in der Versammlung, "denn es zeigt ihre Unfähigkeit, die Ausbeuter zu beschützen. Und denen gibt es eine Vorstellung von unserer Bereitschaft, sie schrittweise zu enteignen. Worauf es ankommt, ist die sorgsame Auswahl der Geiseln; in Frage kommen nur Latifundistas, Vertreter der Handels- und Wuchererbourgeoisie sowie klerikale Fürsten."
"Lasst die Kirche in Ruhe", bat Micaela; sie war aus der christlichen Jugend zu uns gekommen.
"Worauf es ankommt", erklärte Jorge, "ist das Erkunden der Örtlichkeit, der täglichen Gewohnheiten der Geiseln, eben Planung, sonst ist alles gleich im Eimer!"
"Das ist doch selbstverständlich", sagte ich.
In Wirklichkeit hatten wir keine Ahnung. Geiselnahmen sind viel komplizierter als Jagd auf Spitzel oder Attentate, es gibt bestimmte Regeln wie beim Schach, wo mit der falschen Eröffnung schon alles verloren sein kann. Der Tricks wegen sahen wir uns einschlägige Krimis aus Hollywood, aus Frankreich und Italien an. Wir wurden rasch zu Kennern der zu Unterhaltungszwecken dargestellten Entführungstechnik. In seiner albernen Art schlug Gran Gato uns vor, einstweilen mit Rezensionen dieser Filme für die hauptstädtische Presse Geld zu verdienen. Er trieb auch ein Buch von Erwin Rommel auf, es hieß "Infanterie greift an" und beschrieb, gewürzt mit vielen Skizzen, das taktische Vorgehen kleiner Verbände sehr genau. Allerdings beruhte es auf den alpinen Erfahrungen Rommels im ersten Weltkrieg und bot mehr Hinweise auf Gefechtsführung in den Bergen als in der Stadt. Im Stadium der Vorbereitung studierten wir mit Nutzen Werke des Klassenfeinds, die es im Antiquariat der 8. Straße und in den Bibliotheken zahlreich gab. (Solche Lehren sind an sich wertfrei, ganz neutral. Herbert hat, als er in Fort Benning war, von US-Offizieren Vorträge über die Theorien des Preußen Clausewitz gehört.)
Das Wichtigste war selbstverständlich ein sicherer Ort zum Verbergen der Geiseln. Hier half uns der Zufall: aus dem Erbe einer Großtante Micaelas fiel ein kleines Landhaus an deren Familie. Und es gelang ihr, einen Hausmeister unserer Wahl dort hineinzusetzen – Ruperto Rojas, altes Mitglied der Partei aus fernen, besseren Tagen. Ruperto war Ofenmaurer, über fünfzig, Gran Gato nannte ihn gern "unser proletarisches Alibi". Man hatte ihn bei der 54er Treibjagd auf die Kommunisten gefasst und durch verschiedene Kerker geschleift, ihm dann überraschend angeboten, an einem "Fortbildungskursus" für Gewerkschafter in den USA teilzunehmen. Ruperto hatte abgelehnt; auch kam ihm nie die Idee, zu emigrieren. Aber er konnte nun daheim nichts mehr werden. Die Zementfabrik stellte ihn nicht wieder ein, selbst Kleinbetriebe kündigten ihm, obwohl er sich still verhielt, oft unter erbärmlichen Vorwänden. Er lag auf der Straße, bis die Polizei das Interesse an ihm verlor, und kam bei Hatvay unter, in der Brauerei... Den neuen Job übernahm er ohne Begeisterung, die Sache schmeckte ihm nicht, er fügte sich nur der Parteidisziplin.
Wir brannten darauf, das Haus zu sehen. Micaela – sie lebte, wie die meisten, noch legal bei den Eltern – fuhr uns im Auto ihrer Mutter hin, so einem französischen Blechei. Das Bauwerk stand, in Richtung El Salvador, ein Stück oberhalb der Autobahn, jener panamerikanischen Fernstraße, die von Alaska fast bis Feuerland reicht und in diesem Abschnitt traditionell Carretera Roosevelt heißt. Es lag sicherheitstechnisch günstig am Ende einer gekrümmten Allee, die von der Straße heraufführte, inmitten von Feldern, Weiden und offenen Gärten auf der Kuppe eines Hügels. Das nächste Gehöft war ein ganzes Stück weg. Auf halber Höhe ein Pinienhain, der sich kontrollieren ließ, sonst nichts in der Umgebung, das Spähern Deckung bot! Selbst geschulten Leuten fällt es schwer, solch ein Haus unauffällig zu beobachten.
"Seht doch, wie schön das ist", seufzte Renata. Sie neigte, nicht nur angesichts der Natur, zu grundloser Schwärmerei, hatte aber diesmal recht. Zu unseren Füßen breitete sich grün die Hochebene aus, in der, von Schluchten begrenzt, die Hauptstadt liegt, flach hingetupft, umgeben von einem Kranz bläulich bewaldeter Berge. Am Westhorizont schien das Land silbrig betaut, bis hin zu den violetten Kuppeln der drei Vulkane. Was mir jedoch noch weit mehr gefiel, war die Nähe der Autobahn. Der Verkehr zwischen Mexico und dem Süden zog summend unter uns dahin, ein kommerzieller und touristischer Autostrom, in den wir uns leicht einfädeln würden, um dann plötzlich in dieser Allee zu verschwinden. Es gab keinen besseren Platz.
"Wie steht's mit den Nachbarn?", fragte ich.
Ruperto zuckte die Achseln. "Bauern... Sind es gewöhnt, dass manchmal wer kommt aus der Stadt." Ich spürte körperlich seine Missbilligung, die mehr war als Unbehagen, ohne Widerspenstigkeit zu sein. Was wir da planten, war ihm allzu fremd. Am liebsten hätte er wohl wie früher mit den Bauern gesprochen – angefangen zu agitieren. Aber die Vergangenheit war tot, und natürlich wusste er das.
Das Haus war weißgetüncht, ganz hübsch, wenn auch etwas baufällig, außen bröckelte der Putz, im Inneren atmete es feuchte Kühle. Der verwilderte Garten prangte in allen Farben und Schattierungen, er verströmte betäubende Düfte, wenn man den Blütentrauben nahe kam. Das Geheimnis dieser Fruchtbarkeit lag in dem Dieselaggregat, das aus großer Tiefe Wasser zog und auch noch Strom für den Haushalt hergab. Der Vorbesitzer hatte den glücklichen Einfall gehabt, das hochgepumpte Nutzwasser in einer Art Schwimmbecken zu stauen, ehe es auf die Felder floss – wir sprangen gleich hinein und legten uns dann fröstelnd in die Sonne.
"Fantastisch", sagte Renata.
"Das Becken ist undicht", knurrte Ruperto, der immerhin begann, das Grundstück zu pflegen und zu lieben. "Man hat in der Umgebung angeblich keinen gefunden, der zementieren kann! Hinter dem Putz sind bloß Ziegel, nicht mal isoliert..." Er schüttelte den eisengrauen Kopf über soviel handwerkliches Unvermögen. Da das Reservoir auf dem höchsten Punkt lag, trat ringsum am Hang Sickerwasser zutage, ließ die Pflanzen sprießen und durchfeuchtete das Gemäuer, trug also zum Verfall des Hauses bei.
Jorge sagte: "Unser Kopiergerät wird rosten."
"Nicht, wenn man täglich lüftet..."
"Immer das Pulver trocken halten!" Gran Gato gähnte, ich sehe ihn noch am Beckenrand liegen, lässig hingestreckt, muskulös. Er war Micaelas Freund, aber fest überzeugt, er könne praktisch jede haben. Er ist kurz vor Weihnachten gefallen, als dieser Kampfabschnitt zu Ende ging – ganz sinnlos, am Schluss.
Bald war es soweit. Operative Details will ich aussparen, die sind reichlich geschildert und von den Massenmedien verbreitet worden; wir selbst hatten ja daraus gelernt. Es ist übrigens immer dasselbe: Auswahl des Ziels und Erkundung, Sammeln von Informationen, überraschender Zugriff, Abtransport ins Versteck, verbundene Augen, Bekanntgabe der Forderung und Entgegennahme des Lösegelds – stets der springende Punkt. Wichtig war auch, herauszufinden, ob die Familie des Entführten trotz unserer Warnung Kontakt zur Polizei aufnahm und wie weit sie darin ging. In dem Fall, und meistens trat er ein, hatten wir es mit Spezialisten des Kriminalamts (Erkennungsdienstler, Spurensicherer, Scharfschützen) zu tun, die wild darauf waren, sich im Augenblick des Höhepunkts an uns anzuhängen oder gleich zu schießen. Wenn die Familie ohne besonderen Einfluss war, warteten sie nicht mal die Freilassung der Geisel ab; jedenfalls gab es für uns keine Garantie. Ihr Instinkt sagte ihnen wohl, dass wir Gefangene nicht töten würden. Auch war die Geldübergabe der einzige Moment, wo sie uns im Visier hatten. Deshalb ordnete Herbert (Turcios Lima) an, mobile Deckungsgruppen zu bilden, zum Schutz der Genossen, die das Geld schließlich holten. Er führte uns mehrmals selber vor, wie man das macht.
Theoretisch wussten wir Bescheid, hatten den ersten Fall perfekt geplant, die Auswahl der Geisel war gut, die Aufklärung umfassend und genau. Doch im Augenblick der Festnahme scheiterten wir, weil unser Ziel, anstatt wie sonst allein ins Auto zu steigen, plötzlich von Geschäftsfreunden begrüßt und umringt wurde, mit ihnen essen ging und sie anschließend mit nach Hause nahm... Am nächsten Tag war unser "Timing" nicht exakt, wie Herbert es nannte, das heißt, wir kamen dreißig Sekunden zu spät. Am übernächsten flog der Herr nach Canada; aus. Es war eben gar nicht so leicht.
So begann das, was Blanca trostreich unseren Lernprozess nannte.
Die zweite Entführung war ein durchschlagender Erfolg, wir erbeuteten im Handumdrehen 25 000 Quetzal und setzten den Mann, eine Größe der Kompradoren-Bourgeoisie und Leuchte des Rotary-Clubs, unversehrt am Hippodrom im Norden der Stadt nachts ab (weil wir ihn ja südostwärts davon festgehalten hatten). Bei der dritten Aktion gab es eine Störung, mit der wir hätten rechnen sollen. Die Geisel befand sich schon zwei Tage im Landhaus – aber man muss den Leuten ja Zeit lassen, das Geld in der gewünschten Sortierung aufzutreiben –, da äußerten Micaelas Eltern den Wunsch, ihr Haus endlich einmal zu besichtigen! Gran Gato löste das Problem, indem er sich in die Garage schlich und den Ford "Impala" der Familie fahruntüchtig machte; das französische Blechei nahm sie nicht, damit kaufte man bloß ein... Immerhin waren wir gewarnt und wappneten uns vor Überraschungen von dieser Seite. Es wurde eine Pause eingelegt und den Eltern erlaubt, ihr Eigentum kennen zu lernen.
"Ging's denn gut?", fragte ich Micaela nach der Visite, die auf einen Sonntag im November fiel.
"Ich weiß nicht... Mama hat über die vielen Matratzen im Oberstock gestaunt. Ihr ist das Haus zu feucht. Und Papa hat sie vorgerechnet, dass das Grundstück weniger an Pacht einbringt als Rupertos Lohn, die Steuer und das Dieselöl zusammen. Aber ich glaub, ihm gefällt es."
"Hoffentlich nicht zu sehr."
Wir fuhren zu zweit hin, um alles wieder herzurichten für den vierten Coup, dessen Vorbereitung schon lief. Der Tag war golden und blau, Micaela an meiner Seite dunkel, klein und sprühend, sie schielte ein wenig, es stand ihr ganz gut, ihr olivfarbener Teint wurde von schwerem Haar überschattet; der Unterschied zu Blanca konnte gar nicht größer sein. Sie war weniger selbstbewusst, manchmal gehemmt; wenn sie sich beobachtet fühlte, neigte sie dazu, die Schultern hochzuziehen. Ihre Formen allerdings waren schwer zu übersehen, was Gran Gato gelegentlich veranlasste, sie eine "profilierte Persönlichkeit" zu nennen. Ich zweifle, ob er je begriff, dass sie dabei war, so etwas zu werden. Ihren wahren Wert hat er wohl nie erkannt. Blanca beging denselben Fehler mit mir, und nur, weil sie besser formulieren konnte – kein Wunder, wenn man im Fach Juristische Logik derart glänzt! Übrigens tat sie so, als mache es ihr nicht das Geringste aus, mich mit Micaela allein zu wissen. Die hohe Meinung vom Grad ihrer politischen Reife, die außer Ruperto und Jorge alle teilten, zwang sie dazu, über so steinzeitliche Regungen wie Eifersucht erhaben zu sein.
Hatte sie da nicht einen Dämpfer verdient? Wenn es ihr nämlich egal war, liebte sie mich nicht, hatte es auch nie behauptet – das wär gleichfalls unter ihrer weiblichen Würde gewesen. Ich aber mochte sie immer sehr und verschwieg es ihr nicht. Mich packte Lust, ihren Stolz etwas zu mindern. Ich hatte gerade unter Lebensgefahr das Geld für Nummer drei kassiert und wollte mich mit einem kleinen Flirt entspannen und belohnen... All das ist rein persönlich, es sei nur erwähnt, weil von diesem Tag an Micaela für mich zum Gesprächspartner wurde. Obwohl sie keine Marxistin war und auch nicht mit mir schlief, beeinflusste sie meine Schritte.
Nachdem sie mich im Oberstock entschieden und doch taktvoll, mit dem Hinweis auf Gran Gato, in die Schranken gewiesen hatte, fingen wir an, auf geistigem Felde zu streiten. "Wenn ihr Christen wirklich noch die Befreiung der Mühseligen und Beladenen im Auge habt", so ungefähr erklärte ich ihr, "und wenn auf meiner Seite das Reich der Freiheit tiefer Inhalt des revolutionären Bewusstseins bleibt, dann ist gar nicht einzusehen, warum ihr euch nicht längst mit uns Marxisten verbündet habt." Ich sprach vielleicht zu schwungvoll, Blancas Stil hatte abgefärbt, doch es kam an, Micaelas Augen leuchteten auf, womöglich, weil einer sie ernst nahm. "Es gab doch schon mal ein Bündnis zwischen linken Christen und der sozialen Revolution, in den europäischen Bauernkriegen ging das zusammen; sogar damals bei den Jesuiten in Paraguay..."
Ins Mittelalter folgte sie mir nicht, gefühlsmäßig weichen Katholiken dem oft aus – der schwarzen Ära kirchlicher Reaktion, den inquisitorischen Verbrechen. "René", sagte sie scheu (das ist mein Deckname, sie benutzte ihn auch unter vier Augen, sonst hieß ich Marc – auf Marco Antonio bin ich getauft), "René, das Christentum ist eine sehr vielschichtige Religion, sie hat große Wandlungen durchgemacht; sie ist unheimlich lebensfähig."
"Das gilt auch vom Marxismus. Der hat inzwischen das bürgerliche Denken genauso durchtränkt wie einst der christliche Geist."
"Weißt du, an eurer Wissenschaft – so nennt ihr diese Lehre ja – stimmt irgend etwas nicht. Ich jedenfalls kann mir nicht vorstellen, dass mit dem Privatbesitz der Produktionsmittel gleich auch die Selbstentfremdung des Menschen aufhört. Der Mensch findet, so fürchte ich, nicht ohne weiteres zu sich zurück, er kann sich nicht verwirklichen, bleibt außengesteuert, ob die Fabrik nun einem Monopol oder dem Staat gehört. Ja, wenn er Miteigentümer würde, dann schon eher..."
Das war natürlich alles sehr abstrakt, doch uns machte es Spaß. Nach einem dieser Gespräche, in die wir uns von nun an gern verbissen, stand plötzlich Ruperto im Türrahmen, auf seinen Stock gestützt (ihm war aus der Haftzeit ein Bein steif geblieben), und es entspann sich, als Micaela ging, etwa folgender Dialog:
Ich frage mich, Marc, was nun wieder kommt.
Was soll denn schon kommen, außer Nummer vier?
Na, irgendein ganz neues Ding. Bei euch steckt doch immer ein Weib dahinter. Mit Blanca hast du die Finanzierungsaktionen ausgeheckt; du weißt, wie ich dazu stehe... Und jetzt – mit ihr?
Sei nicht albern. Blanca! Der Plan war von mir.
Jeder macht Pläne, aber du erklärst sie nie zuerst der Gruppe, sondern 'nem Mädchen, damit sie dich bestaunt. Und wenn sie das hat, kannst du nicht mehr zurück. Die Ausführung wird zu einer Sache des Mutes, der Ehre, wegen einem Weib! Und das ist das, was mir unter anderem hier nicht passt.
Ich dachte, dass Ruperto sich gewaltig irrte. Mir warf er gockelhaftes Spreizen vor, den üblichen Männlichkeitskult, doch der saß ihm ja selber in den Knochen. In punkto Frauen war er für einen Genossen ziemlich konservativ. Na, ich verstand ihn schon, die "höheren Töchter" gingen ihm gegen den Strich, die hatte es zu seiner Zeit in der Partei ja nicht gegeben. (Damals ahnte ich nicht, was noch alles von ihm kommen, dass er mir zuletzt sogar die Führung streitig machen würde.) Wegen seines etwas plumpen Wesens hab ich ihn auf der ganzen Linie unterschätzt. Und erst später ist mir aufgegangen, dass er nicht so unrecht hatte: Blanca und Micaela haben beide gewisse Entscheidungen forciert.
Tatsächlich blieb unser Umgang mit den Mädchen immer leicht gespannt, lieferte – laut Blanca – produktiven Konfliktstoff. Das Rezept war bekannt, strikte Gleichberechtigung, die Anwendung schwierig. Sie redeten überall mit, oft geschickter als wir, nutzten aber auch ihre typischen Schwächen, um sich vor bestimmten Dingen zu drücken... Daneben gab es auch Eifersucht. Der Chef der Nachbareinheit an dem Bergsee, der zu unserer Kampfzone gehörte, hatte zwei Frauen, eine keifte ganz schön und konnte uns gefährden. Trotzdem sind die Genossinnen, wie mein Bericht zeigt, ein unersetzlicher Teil des Widerstands – ein "integraler Faktor" (La Importante).
2
Auch der vierte Coup verlief erstaunlich glatt. Dank eines Tricks, den Jorge Délano ersonnen hatte, gelangten wir auf geradezu elegante Art in den Besitz der märchenhaften Beute. Mit jener Methode, die die Filme zeigen, dirigierten wir den Überbringer des Lösegelds, ohne ihn aus dem Auge zu lassen, von einem Lokal ins andere, zuletzt ins Columbia-Haus, wo ihm ein Boy die Weisung übergab, sich gegenüber der bizarren Plastik im Erdgeschoß nahe der Wand zu postieren. Hinter ihm befand sich, von keinem beachtet, eine Stahltür zur Nottreppe, stets versperrt, doch Jorge hatte einen Nachschlüssel gefeilt. Er war es auch, der die listig geölte Tür lautlos öffnete, kaum dass der Überbringer mit dem Rücken zu ihr stand, ihm den Geldkoffer entriss und hinter der Tür, die knackend ins Schloss fiel, unauffindbar im Labyrinth des Gebäudes verschwand.
Auf der Rückseite stand ich mit laufendem Motor bereit, den prallen Wäschesack, in dem unter anderem der Koffer nun steckte, nachlässig auf unseren alten Lieferwagen zu werfen – ein klappriges Fahrzeug, in dem kein Mensch Kidnapper vermutete. Wir flitzten schon über den Paseo, als die Polizei erst anfing, den Tatort abzuriegeln. Jorge war der Held des Tages, Renata himmelte ihn an und Gran Gato verlieh ihm, etwas gönnerhaft, den Kriegsnamen Robin Hood. Wie er wieder mal seinen Humor bewies.
Dieser Triumph machte uns so leichtsinnig, dass wir beim nächsten Mal heftig geschlagen wurden. Zuvor jedoch stieg der Erfolg, vervielfacht vom Echo im Blätterwald, auch anderen zu Kopfe – mehrere Gruppen widmeten sich plötzlich wütend der Vorbereitung von Entführungen. Das Volk applaudierte verstohlen, die Legende der FAR wuchs, eine stolze Woge überspülte uns. Man sprach von den Revolutionären Streitkräften mit Achtung und Furcht, außerdem waren wir jetzt reich, so reich! Manch einem glänzten die Augen beim Zählen all der Banknoten (5-, 10- und 50-Quetzalscheine, größere nahmen wir nie), uns schmerzten die Finger, man überbot einander im Entwurf von Finanzplänen und Beschaffungslisten, im Ankauf schneller Autos, hörte sie schon summen, das Schnappen der Türen, dazwischen klingelte das Telefon, jemand schlug eine neue, hochinteressante Zielperson vor! Ja, wir erstarkten, hielten die Zukunft für gesichert und verloren gegenüber dem Zentrum, das nun weniger bemittelt war als wir, unsere Schüchternheit; man trat da schon mal selbstbewusst auf.
"Immer langsam, René", sagte mitten in diesem Boom – so lässt sich die hektische Entführungskonjunktur wohl nennen – Bernardo zu mir, der Vertreter des Zentralkomitees in den Revolutionären Streitkräften (FAR). "Auf die Dauer ist das, was ihr tut, völlig ungeeignet. Geiselnahme, Erpressung... Kein Bestandteil einer ernsthaften revolutionären Strategie! Vergesst nicht, wie Lenin dazu gestanden hat: 'Grundsätzlich haben wir den Terror nie abgelehnt und können ihn nicht ablehnen. Er ist eine Kampfhandlung, die in einem bestimmten Zeitpunkt der Schlacht, bei einem bestimmten Zustand der Truppe und unter bestimmten Bedingungen durchaus angebracht und sogar notwendig sein kann. Doch das Wesen der Sache besteht darin, dass gegenwärtig der Terror keineswegs als eine mit dem ganzen Kampfsystem eng verbundene und koordinierte Operation der kämpfenden Armee vorgeschlagen wird, sondern als selbständiges und von jeder Armee unabhängiges Mittel des Einzelangriffs. Bei dem Fehlen einer zentralen Organisation und bei der Schwäche der örtlichen Organisationen kann ja der Terror auch nichts anderes sein...'"
Bernardo zitierte dies aus dem Kopf, er hatte sich wie immer gut vorbereitet, und ich gab im stillen zu, in welcher historischen Lage Lenin dies auch geäußert haben mochte, es passte auf uns; eine gewisse Ähnlichkeit der Situation war nicht zu übersehen. Textsicher fuhr er fort: "'Wir sind weit entfernt von dem Gedanken, heldenmütigen Einzelaktionen jede Bedeutung abzusprechen, aber es ist unsere Pflicht, mit aller Energie davor zu warnen, sich am Terror zu berauschen, ihn als wichtigstes und hauptsächlichstes Kampfmittel zu betrachten...' Soweit Lenin. Also bitte, berauscht euch nicht, lasst euch nicht blenden vom sogenannten Erfolg. Es stimmt, ihr habt Geld, und die Zahl der Sympathisanten mag zunehmen, aber das sind noch keine Helfer, geschweige denn Mitkämpfer! René, ihr seid mir zu hastig, euch fehlt es an Erfahrung und Geduld."
"Uns fehlt es auch an Führung", wagte ich zu erwidern. Für mich stand fest, dass Herberts häufige Abwesenheit – bald war er in der Sierra, bald auf einem Sprung in Habana – und seine schüchterne Art ihn daran hinderten, als militärisch-politischer Leiter des ganzen Widerstands aufzutreten, und dass Bernardo trotz seiner Belesenheit auch nicht der rechte Mann dazu war. Yon Sosa aber, ein wahrhaft mitreißender Führer, hatte sich von der Partei entfernt und, zu lange umgarnt von einer Handvoll Trotzkisten, weit in die Ostprovinz zurückgezogen.
Bernardo antwortete: "Vor allem fehlt die revolutionäre Situation."
Ich schwieg, ganz anderer Meinung als er. Die revolutionäre Situation war seit den 62er Aufständen nämlich da. Die Leitung leugnete dies, sie berief sich auf ihre Erfahrung. Sie bestand ja aus sehr unterschiedlichen Menschen, tatkräftigen Männern wie Yon Sosa, die nie ein Buch lasen, und den theoretisch Starken, die wiederum nicht handelten. Uns fehlte eben eine herausragende Figur, die, wie Lenin, alle Vorzüge in sich vereinte. Nicht jedes Land bringt solche Führer hervor.
Auf dem Heimweg überdachte ich den Vorwurf mangelnder Erfahrung. Man kann ihn wohl jedem Grünschnabel machen. Wie entstand Erfahrung denn? Zu der Summe dessen, was man erlebt und verarbeitet hatte, kam ab und zu ein neues Element. Man prüfte es im Lichte der vorhandenen Erkenntnis – dabei veränderte es sich! – und fügte es in sein Weltbild ein, das so ergänzt und vielleicht auch verändert wurde. Es war nicht unbedingt ein gradliniger Prozess der Anreicherung oder des klaren Kristallisierens, manchmal glich dies eher einer chemischen Reaktion – aus dem vorhandenen Weltbild und der neuen Erfahrung konnten sprunghaft etwas qualitativ anderes werden, falls das Erlebnis schwerwiegend war.
Und das war es offenbar, was meinen Freunden jetzt passierte, wovor Bernardo uns warnen wollte: der schnelle Erfolg krempelte uns um, drohte uns in reine Aktionisten zu verwandeln, eine Handvoll Bravos, denen niemand folgte; Einzelkämpfer ohne Massenbasis. Gewiss, wir waren jetzt stark, gefürchtet und beliebt, hatten ja schon die Diktatur erschüttert, dennoch, das konnte der Weg zum Sieg nicht sein. Die schöpferische Anwendung der Lehren von Marx und Lenin – die wir so gern beschworen, ohne genau zu wissen, was das hieß –, dieses Schöpferische also schrumpfte bei uns zu technischen Einfällen wie Jorges Trick mit der Tür! Nichts gegen solche Ideen, aber zweifellos reichen sie nicht aus, den Krieg zu gewinnen.
Von nun an dämmerte mir, wir machten etwas falsch. Doch wie es besser machen, das wusste keiner zu sagen. Dies fing an, mich zu quälen: der unglaubliche Kontrast zwischen unserem großen Schwung, den schlummernden Möglichkeiten zur Entwicklung eines Volkskrieges, und der Unfähigkeit unserer Organisation, unter den Bedingungen der Diktatur die Massen zu erreichen, sie wahrhaft zu mobilisieren. Ich lief, wie Blanca nach meiner Rückkehr vom Befehlsstand der Zentralen Widerstandszone (welch klangvoller Name!) fand, herum mit "bemaltem Gesicht und verwundetem Herzen". Sie gab vor, mich nicht zu verstehen. Die subjektiven und objektiven Faktoren seien doch da, versicherte sie uns, wir müssten nur weitermachen, unsere Funktion sei einfach die einer Initialzündung. Politische Situationen könne man schaffen, das gelinge auch winzigen Minderheiten, Fidel habe es bewiesen.
Gran Gato stimmte ihr zu, Verfechter des Modells Sierra Maestra, der er war – mutig und witzig, doch oft unausstehlich. Einer von denen, die sich für den Vortrupp hielten auf Grund ihrer Bereitschaft, "als erste zu sterben"; was ihm allerdings gelang. Er prahlte mit seiner ursprünglichen Unwissenheit, um auf das hohe Bewusstsein hinzuweisen, das ihm inzwischen zugewachsen sei. Tatsächlich blieb er in den Grenzen des Klischees, das die lateinamerikanische Revolution als Fließbandprodukt ansieht, gefertigt aus Teilen wie Guerillakern, Front, zweite Front, Gebirge und Ebene, Kampf in der Stadt. Erst schießen, dann denken! Zuerst die Medizin, dann herausfinden, woran der Patient krankt.
Die fünfte Geisel, ein nicht ganz so reicher Mann namens Teddy Herrera, fiel uns am dritten Advent in die Hand. Er war recht fügsam und nannte uns glaubhaft eine Summe, die seine Leute rasch aufbringen konnten: 40 000 Dollar, er sagte Dollar, nicht Quetzal, wohl weil er als Großimporteur daran gewöhnt war, in der Währung seines Stammhauses zu denken. Die Reihe, das Geld zu holen, war an Gran Gato – Micaela begleitete ihn, damit man sie für ein Liebespaar hielt, das sie ja auch waren. Jorge und ich gaben Feuerschutz, Blanca saß am Steuer unseres Chryslers.
Gran Gato bewegte sich selbstsicher, doch muss ihm bei der telefonischen Durchsage der Treffpunkte ein Fehler unterlaufen sein. Wahrscheinlich kürzte er in seiner nonchalanten Art das Verfahren einfach ab. Dies hatte zur Folge, dass nahe dem Übergabeort ein Volkswagen (VW do Brasil) des Kriminalamts lauerte, aus dem man, als er sich mit der Beute umwandte, zu feuern begann. Wir parkten auf der anderen Straßenseite und schossen gleich zurück, der Volkswagen geriet in Brand, doch Gran Gato lag schon auf dem Pflaster. Micaela gelang es, zu fliehen, sie stand bei der Geldübergabe etwas abseits, verlor in der Aufregung zwar ihre Pistole, wurde aber, wie sich herausstellte, nicht einmal erkannt.
Aus einem zweiten VW stürzten Zivilisten, eine Funkstreife bog um die Ecke – der Versuch, Gran Gato zu bergen, hätte zu unserer Vernichtung geführt. Es glückte uns gerade noch, den Streifenwagen zu treffen; der zweite VW verfolgte uns nicht, wohl weil er im kritischen Moment bis auf den Fahrer unbesetzt war. Mit dem bitteren Gefühl, versagt zu haben, konnten wir uns retten. Als Deckungsgruppe waren wir zu schwach gewesen, das warf uns Herbert auch vor, den wir sofort alarmierten.
Wie immer, wenn es schief ging, übernahm er das Kommando, gab Befehle für den Fall, dass sie Gran Gato zum Sprechen brachten – was vor allem hieß, unser Haus zu räumen. Dann fuhr er unerschrocken zum Tatort und kam mit der Behauptung, er sei der Bruder des Verletzten, gewaltlos durch die Absperrung. Dank seiner Fähigkeit, sich zurechtzufinden, und dank des Mutes seiner Begleiter stellte er fest, dass unser Genosse gefallen war, und zwar im ersten Feuerstoß. Darauf durchbrach er die Sperrkette mit einer Handgranate, setzte einen Jeep außer Gefecht, der dicht folgte und ihm lange Schussfolgen nachschickte – aber schlecht gezielt, während er, mit seiner Kaltblütigkeit und der Ausbildung von Fort Benning, wieder einmal Sieger blieb. Auf der 5. Südavenida wechselte er den Wagen und kam zurück, um uns das Finale der Operation zu überlassen.
"Erhöht das Lösegeld um 10 000 Quetzal", riet er uns wütend. Nun fand sich auch Micaela ein, schüttelte auf alle Fragen den Kopf und weinte zwischendurch, aber so, dass es kaum wer bemerkte... So verloren wir Gran Gato, unser einziges Opfer in jenem Jahr, ferner zwei neue Autos und eine Pistole. Die Familie Herrera verlor 40 000 Quetzal, die sich der Polizeichef mit Leutnant Folgar und den drei Polizisten teilte, die unseren Mann niederschossen (auf die Polizisten entfiel je ein Tausender). Wenig später kassierten wir 50 000, und am 24. Dezember um 6 Uhr morgens ließen wir Teddy Herrera frei; man wünschte ihm fröhliche Weihnacht und ein glückliches Neues Jahr.
Während der folgenden Nächte schlief ich schlecht, nicht etwa aus Angst um meine Person. Wir hatten für den Rest des Jahres jede Aktivität eingestellt, und die Behörden vermuteten mich – wie wir durch unsere Quelle erfuhren – seit Mai im Ausland, da mir Vater einen Pass besorgt hatte; das letzte, was er für mich in der Hoffnung tat, ich möge ihn benutzen. Nach dem Erwachen im Oberstock des Landhauses, das meine Bleibe geworden war, zerbrach ich mir den Kopf darüber, wie es mit uns weitergehen sollte. Auch versuchte ich, die Träume wiederherzustellen, die mich heimgesucht hatten. Es kam mir so vor, als ließen sie sich wie schwarze Vögel auf mir nieder, sobald ich einschlief.
Ein Traum suchte mich hartnäckig heim, er spielte im Palace Hotel, einem dreistöckigen Haus aus den zwanziger Jahren – Gewiss, weil die letzte Schießerei dort stattgefunden hatte. Ich schlief stets in Gesellschaft eines Mädchens, das nie sichtbar wurde, denn es weckte mich im Finstern mit dem Schreckensruf, das Hotel müsse brennen. Fieberhaft knotete ich Bettücher aneinander und wollte mich gemeinsam mit der Begleiterin (Blanca? Micaela?) abseilen, doch im Augenblick der Rettung war sie dann verschwunden... Schweißgebadet erwachte ich.