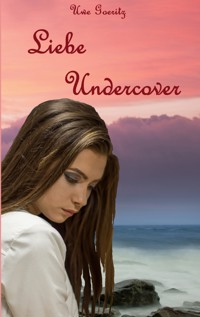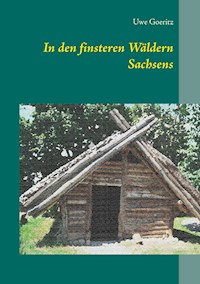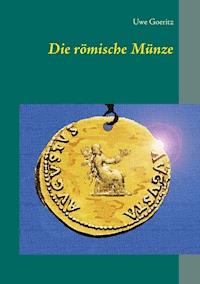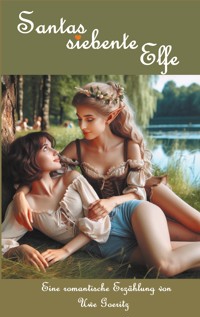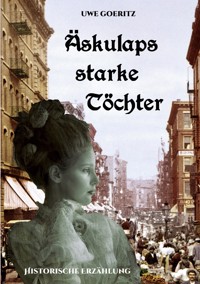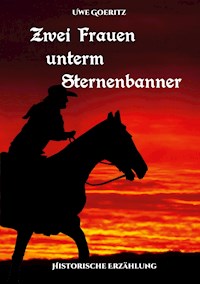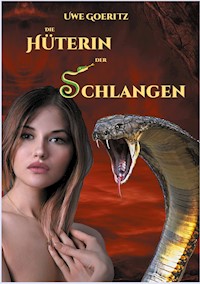
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Chroniken von Mirento
- Sprache: Deutsch
"Die Hüterin der Schlangen" Altersempfehlung: ab 16 Jahre In einer fernen Zukunft hat sich die Menschheit durch Naturkatastrophen und Kriege fast vollständig ausgelöscht. Die wenigen Überlebenden sind auf ein Leben wie im Mittelalter zurückgefallen und bevölkern nun den Kontinent Mirento, der früher einmal Europa gewesen war. Dieser Kontinent ist in fünf Reiche aufgeteilt. Das Gleichgewicht zwischen den Kräften hängt an einem seidenen Faden und wird immer wieder durch die Überfälle der Tuck oder der Ritter von Mortunda empfindlich gestört. Eine alte Sage berichtet davon, dass einst ein Kind geboren wird, das diese fünf Königreiche vereinigen wird und zu neuem Glanz führen kann, doch schon ziehen die dunklen Wolken des Kampfes abermals am Himmel auf. Wird dieses Kind noch rechtzeitig das Licht der Welt erblicken, bevor ein neuer Krieg auch noch die letzten verbliebenen Menschen auslöschen wird?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Anmerkungen
Die Hüterin der Schlangen
Schlangenschatten
Todesritt im Morgennebel
Hexenworte
Blutige Spuren
Vom Glück, ein König zu sein
Doppeltes Glück?
Der Weg des Schwertes
Mathildas Hilfe
In finsteren Wäldern
Im tiefsten Dunkel
Meister Dakora
Zum Licht hinauf
Katzenpfade
Ein Geschöpf der Finsternis
Neue Schmerzen
Brandzeichen
Feuer, Wind und Wasser
Pflicht und Schmerz
Hexenwahn
Strafe des Himmels?
Feinde überall!
Zorn zerstört Menschen
Wahl der Waffen
Natternzunge
Am Ende?
Mutterliebe
Dämon der Nacht
Königliche Pflichten
Im Netz der Spinne
Gewissensbisse
Knabentod
Im Zeichen der Schlange
Eine alte Schuld
Dämonenjäger
Auf Messers Schneide
Der Besten einer
Ein Alb
Wolfsfänge
Erntemond
Tod und Verderben
Todesangst
Grüne Pfade
Fragen über Fragen
Waldidyll
Platzwahl
Freundinnen
Blutige Rituale
Winterwind
Gemeinsam sind wir stark!
Zeit der Märchen
Gedankenspiele
Fragen ohne Antwort
Schuldgefühle
Abwendbares Schicksal?
Mädchenträume
Tag der Entscheidung
Hoffnungen und Ängste
Die wilde Horde
Der Herr der Wölfe
Gute und schlechte Taten
Aufbruch mit schwerem Herzen
Sklavenlos
Neue Wege
Auf der Jagd
Zu zweit alleine!
In den Fängen der Angst
Sinn des Lebens
Beute eines Dämonen
Im Griff der Angst
Krallen der Liebe
Fremde Tochter
Die Angst der Menschen
Glück im Unglück
Eine schwere Bürde
Mondlicht
Verfluchtes Leben?
Unvermeidbares Schicksal?
Verschlungene Pfade
Ein weißes Reittier
Abschied und Ankunft
Wandermönch
Das Mädchen und der Wolf
In glänzender Rüstung
Führungsstreit
Eine Falle?
Seelenverbindung
Drachenschwingen
Ein silberner Dolch
In tödliche Tiefen
Schlangenloch
Drei Frauen
Racheschwur
Scharlachroter Mantel
Liebe und Hass
Im Schatten einer Schlange
Anmerkungen
Sämtliche Figuren, Firmen und Ereignisse dieser Erzählung sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit echten Personen, ob lebend oder tot, ist rein zufällig und vom Autor nicht beabsichtigt.
Prolog
Die Hüterin der Schlangen
In einer fernen Zukunft hat sich die Menschheit durch Naturkatastrophen und Kriege fast vollständig ausgelöscht. Die wenigen Überlebenden sind auf ein Leben wie im Mittelalter zurückgefallen und bevölkern nun den Kontinent Mirento, der früher einmal Europa gewesen war.
Dieser Kontinent ist in fünf Reiche aufgeteilt. Im Norden, an den Ufern des Nordmeeres, befindet sich das Königreich Mortunda, dass durch seine Häfen und Eisenvorkommen zu Reichtum gekommen ist. Die Könige dieses Landes versuchen schon seit Generationen mit ihrer gewaltigen Armee die Herrschaft über den Kontinent an sich zu reißen.
Doch das Königreich Cenobia, das sich im Osten befindet, konnte diesem Wunsch bisher erfolgreich die Stirn bieten. Cenobia ist durch Gold und Silbervorkommen sowie durch seine Kohlelagerstätten wirtschaftlich bedeutend und ohne diese Kohle nutzt Mortunda das Eisen rein gar nichts.
Im Süden, in den Bergen, die früher einmal die Alpen waren, lebt das Reitervolk der Tuck. Raue Gesellen und wilde Barbaren, die nur von Raub leben können, da ihr karges Land keinerlei Ressourcen zum Leben bietet.
Im Westen befinden sich dichte Wälder, die das Land des Königreiches Waldonien bilden.
Im Zentrum, in der flachen Ebene, durch die sich der Fluss Tassaros zum Nordmeer schlängelt, liegen die Felder von Wiesenland. Die fruchtbare Ebene dieses Fürstentums ernährt mit ihrem Überfluss alle Menschen des Kontinents. Freiwillig und unfreiwillig.
Das Gleichgewicht zwischen den Kräften hängt an einem seidenen Faden und wird immer wieder durch die Überfälle der Tuck oder der Ritter von Mortunda empfindlich gestört.
Eine alte Sage berichtet davon, dass einst ein Kind geboren wird, das diese fünf Königreiche vereinigen wird und zu neuem Glanz führen kann, doch schon ziehen die dunklen Wolken des Kampfes abermals am Himmel auf.
Wird dieses Kind noch rechtzeitig das Licht der Welt erblicken, bevor ein neuer Krieg auch noch die letzten verbliebenen Menschen auslöschen wird?
1. Kapitel
Schlangenschatten
Der zuckende Feuerschein der Fackeln in dem Raum ließ Schatten an den Wänden tanzen, die nur zu bedrohlich wirkten. Züngelnden Schlangen gleich zogen sie über die Mauer, die nicht mal durch einen der bunten Teppiche bedeckt war, die den Thronsaal der schwarzen Burg so prunkvoll schmückten.
Dies war der Raum der Königin von Mortunda und doch schien es mehr einem Gefängnis zu gleichen, als einem Zimmer, in dem die Herrscherin dieses Königreiches wohnen sollte.
Die junge Königin Theodoria stand an der Wiege, stützte sich mit einer Hand auf das Holz und strich dem Kind über die Wange.
Die Amme hatte den Säugling gerade fest in ein Tuch eingepackt und Theodoria hatte sich nach der gerade erst überstandenen schmerzhaften Geburt aus dem Bett hierher gequält. Das Baby schrie nicht. Mit wachen Augen blickte das Kind sie aus der Wiege an.
Eigentlich hätte Theodoria froh sein müssen, dass das Kind offensichtlich gesund war, doch ein Zweifel blieb in ihr zurück.
Es war eine unerklärliche Angst in ihr.
Schon ein paar Tage lang hatte sie diese dunkle Ahnung gehabt, dass sich etwas Bedrohliches über ihrem Kopf zusammenbraute. Nur zu deutlich hatte sie die Schlangen in den Schatten erkannt, die um die Wiege herumschlichen.
Schon als kleines Kind hatte Theodoria Vorahnungen gehabt. Meist waren diese dann auch eingetroffen und so befürchtete sie, dass auch diese eintreffen würden.
Wenn sie kräftiger gewesen wäre, dann wäre sie nun mit dem Kind von dieser Burg geflohen, aber in ihrer derzeitigen Verfassung hatte sie sich selbst für die drei Schritte irgendwo abstützen müssen.
So war es ihr unmöglich, auch nur an eine Flucht zu denken, doch ihr Kind musste in Sicherheit gebracht werden!
Theodoria wusste selbstverständlich nicht, ob diese Gefahr real oder nur eine Einbildung war. Aber sie wollte es nicht darauf ankommen lassen!
Das Ziehen in ihrem Herzen war mehr als deutlich.
Sie musste handeln, und zwar jetzt!
Vor einem Augenblick war die Amme aus dem Raum gegangen, um dem König, Theodorias Mann, die frohe Kunde von der erfolgreichen Geburt zu überbringen.
Konnte der König das Kind beschützen? Nein! Nach dem, wie er sich in den letzten Tagen benommen hatte, zweifelte Theodoria an ihm. Und der karge Raum verstärkte da nur noch ihre Angst vor ihrem Ehemann.
Sein Blick hatte sie am Tage zuvor genauso erschaudern lassen, wie die Schatten der Schlangen, die nun abermals um ihre Krippe zogen.
Sicherlich würde es nur noch wenige Augenblicke dauern, bis der König in den Raum kommen würde und genau davor hatte sie Angst.
Theodoria holte sich in Gedanken erneut das Bild des Mannes vor sich. Sein Blick war finster und unheilschwanger gewesen.
Sie wusste: Das Kind musste verschwinden oder es würde den kommenden Tag nicht überleben.
Tränen rollten über die Wangen der Mutter, die mit dieser furchtbaren Entscheidung kämpfte, dann richtete sie sich auf und dachte an ihre treue Zofe, die hoffentlich vor dem Zimmer im Gang wartete.
„Barbara!“, rief sie und fast sofort öffnete sich die schwere Holztür.
Die Magd betrat den Raum, machte einen Knicks und sagte: „Hoheit, sie wünschen?“
„Komm her und stelle keine Fragen. Es eilt!“, wies Theodoria die Magd an.
Mit schnellen Schritten trat die Zofe zur Wiege.
„Kann ich dir vertrauen?“, fragte die Königin.
„Wie euch selbst, meine Königin!“, antwortete die Zofe mit einer Verbeugung.
„Gut. Höre genau zu“, begann Theodoria und wehrte mit der Hand eine der Schattenschlangen von der Wiege ab. Draußen setzte gerade die Morgendämmerung ein. „Nimm mein Kind an dich und bringe es aus der Burg in Sicherheit. Gehe zu Ritter Siegmar. Ihm kannst du vertrauen und er wird euch beschützen. Und nun eile dich!“, befahl sie und griff nach dem Kind in der Wiege.
Sie drückte es der Zofe in den Arm und strich ein letztes Mal über das Köpfchen des Säuglings. Dann nickte sie und wiederholte: „Eile dich!“
Von draußen waren schon Schritte zu hören und sie zeigte zu einer Nebentür, die über ein anderes Gemach zum Gang hinaus führte.
Barbara verbeugte sich und lief los, so schnell es ihr der lange Rock ermöglichte.
Kaum hatte die Zofe den Raum verlassen, trat die Amme ein, verbeugte sich und sagte: „Euer Mann wird gleich kommen!“
Mühsam wankte die Königin zurück zum Bett, wo sie sich erschöpft niedersetzte.
Nur einige Augenblicke später betrat ihr Mann durch die Tür den Raum, sah sie nur kurz an und ging zu der Wiege hinüber.
Nach einem Blick in das leere Kinderbett fuhr er herum und brüllte: „Wo ist das Kind?“
Erschrocken wich die Amme zurück, bis die Wand ihren Weg stoppte.
Der König brüllte nun noch viel lauter: „Mein Kind! Wo ist es?“
Theodoria sah den Hass in seinen Augen. Doch der kam nicht, weil das Kind nicht da war, sondern weil es offensichtlich seinem Zugriff entzogen war.
Die dunklen Ahnungen hatten sich bewahrheitet!
„Na schön! Ich werde es suchen lassen!“, sagte er laut und brüllte dann nach seinen Wachen.
Der Hauptmann erschien in voller Rüstung wenig später in dem Zimmer.
„Durchsucht die Burg, lasst keinen Winkel aus und bringt mir mein Kind!“, schrie der König den Mann an und dann setzte er etwas hinzu, was der Königin das Blut in den Adern gefrieren ließ. Er sagte: „Tod oder Lebendig!“
Sie zuckte zurück und auch der Kommandant der Wache schien vor dieser Anweisung erschrocken zu sein.
„Los jetzt!“, brüllte der König und klappernd verließ der Hauptmann den Raum.
Ein Lärm setzte auf dem Gang ein. Vermutlich suchten nun hundert bewaffnete Männer alle Räume der Burg ab.
Offensichtlich hatte sie ihr ungutes Gefühl nicht getäuscht. Langsam kam ihr Mann auf sie zu. Es waren Schritte, die auch eine schleichende Raubkatze nicht anders setzen würde. Mit jedem Schritt wuchs ihre Angst, dass er ihr etwas antun würde.
Dann stand er direkt vor ihr und sagte leise: „Ich werde mein Kind finden. Das verspreche ich dir!“
Neuerdings sah sie das zornige Funkeln in seinen Augen, das nicht vom Fackelschein stammen konnte. Danach lief er laut fluchend hinaus und Theodoria blickte zur Amme, die kreidebleich an der Wand lehnte.
„Hilf mir, mich zu säubern“, forderte sie die Amme auf, die dadurch aus ihrer Starre gelöst wurde.
Schnell kam die Frau auf sie zu und brachte Wasser und Tücher mit. Theodorias Blick zog es zum Fenster hinaus und sie schaute in das junge Sonnenlicht des Tages.
„Hoffentlich schafft es Barbara!“, war ihr einziger Gedanke, an den sie sich nun klammerte.
Die Zofe musste es einfach geschafft haben.
Der Lärm in den Räumen war unüberhörbar.
Zwei Wachen kamen in ihre Kammer und suchten jeden Winkel in dem Zimmer ab, während die Königin erschöpft in dem Bett lag.
Was hatte das alles zu bedeuten?
Warum wollte der Vater sein Kind töten?
Vor dem Fenster hörte sie nun Rufe im Burghof und wenig später waren auch Hufgeräusche zu hören. Waren das die Verfolgten? Oder schon die Verfolger?
Die Schatten der Schlangen verschwanden im Sonnenlicht und sie hoffte, dass alles gut wurde!
Zu Barbara musste sie nun vollstes Vertrauen haben. Es ging gar nicht anders und die kampferprobte Zofe war in dieser Burg auch fast die Einzige gewesen, die ihr zugetan war.
Erschöpft fiel Theodoria auf das Lager zurück und die Entkräftung schloss ihr die Augen.
Eine letzte Bitte um die Rettung ihres Kindes flog zum Himmel hinauf. Würde diese gehört werden? Ein unschuldiges kleines Kind. Warum sollte es sterben, wenn es doch gerade erst zu leben begonnen hatte?
2. Kapitel
Todesritt im Morgennebel
Barbara hatte die Angst in den Augen der Königin gesehen und nur deshalb hatte sie diesem seltsamen Vorschlag überhaupt zugestimmt. Sie kannte die Herrin schon viele Jahre und sie waren zusammen aufgewachsen.
Die jetzige Königin und sie, Barbara die Zofe, hatten früher zusammen am Hofe von König Maximilian von Cenobia gelebt und gemeinsam waren sie bei der Hochzeit zum Hofe dieses Königs gewechselt.
Schon damals hatte Barbara diese dunkle Burg gehasst und wenn sie nicht durch ihren Treueschwur für immer an Königin Theodoria gebunden wäre, dann hätte sie damals sofort die Flucht angetreten.
Mehr als ein Jahr lebte sie nun hier und nun stand sie auf der Treppe dieser schwarzen Burg. Das Kind ihrer Herrin fest an ihre Brust gepresst. Langsam stieg sie hinab zum Erdgeschoss und betrat ihre Kammer. Eine Kerkerzelle wäre sicher komfortabler ausgestattet, aber sie war ja nur eine Magd.
Schnell hatte sie das Kind auf ihr Bett gelegt, das Kurzschwert aus dem Versteck an sich genommen und es mit dem Gürtel um ihre Hüften befestigt.
Nur mit dieser Waffe fühlte sie sich komplett und vorbereitet.
Ein letztes Mal prüfte sie den Sitz der Waffe, dann nahm sie das schlafende Kind und wickelte es in ein großes Tuch.
In den Gängen über sich hörte sie Schritte und sie rannte auf den Burghof hinaus.
Wo konnte sie den Ritter treffen?
Unstet flog ihr Blick umher. Barbara suchte die markante und hochgewachsene Gestalt des älteren Kämpfers. Schließlich bemerkte sie eine Bewegung vom Stall her und drückte sich schnell in die Dunkelheit einer Häuserecke. Zu ihrer beider Glück verhielt sich das Kind ruhig. Mit einem schreienden Säugling wäre dieses Versteckspiel völlig unsinnig gewesen.
Eine Gestalt trat auf den Burghof und Barbara erkannte in ihr den gesuchten Ritter, der schon vollständig gerüstet war. Nur den Helm trug er noch in der Hand. Das Mondlicht spiegelte sich auf der Rüstung.
Mit schnellen Schritten lief sie auf ihn zu und umklammerte dabei das Kind mit der einen Hand und den Schwertgriff mit der anderen.
„Wir müssen fort?“, fragte der Mann sie und Barbara bestätigte dies mit einem Nicken. „Waldemar! Es geht los!“, rief der Ritter nach hinten und aus der Dunkelheit löste sich eine weitere Gestalt, die drei gesattelte Pferde hinter sich herzog.
Barbara erkannte den treuen Knappen des Ritters, dem sie nun zur Begrüßung zunickte. Sie befestigte sich das Kind mit dem Tuch vor der Brust und warf einen letzten Blick zurück.
Waldemar hielt ihr eines der Pferde hin, auf das sie sich schwang. Neben ihr saßen die beiden Männer auf.
Der Hufschlag war seltsam gedämpft auf dem steinernen Boden. Offensichtlich hatte der Knappe die Hufe mit Tüchern umwickelt.
Im Schritt näherten sich die drei Reittiere dem Burgtor, das mit den ersten Sonnenstrahlen geöffnet werden würde.
Gleichzeitig mit dem sich öffnenden Tor und der sich herabsenkenden Zugbrücke vernahm sie vom Palas her Geschrei und Lärm.
„Wir müssen!“, erklärte der Ritter und trieb seine Sporen in die Flanken seines Streitrosses. Der schwere Rappe machte einen Satz und flog auf das Tor zu.
Die Wachen sprangen vor Schreck zur Seite.
„Jetzt du!“, trieb Waldemar sie an. Breitbeinig auf dem Rücken des Pferdes sitzend und mit einem Arm das Kind an sich pressend, drückte sie die Hacken in die Seite ihrer Schimmelstute.
Auch ihr Reittier flog fast zum Tor hinaus. Die Hufe schienen kaum den Boden zu berühren. Unmittelbar hinter sich hörte sie Waldemars Pferd vor Anstrengung schnaufen.
Vor der Burg schlug der Ritter nicht den Weg zur Stadt und dem Hafen ein, sondern er ritt in Richtung des freien Wiesenlandes.
Der Ritter legte ein beachtliches Tempo vor und Barbaras Pferd hatte alle Mühe, dem schweren Schlachtross zu folgen.
Wenig später hatte die Stute schon Schaum vor dem Maul, der vom Wind auf Barbaras Kleidung geweht wurde. Lange konnten die Tiere dieses Tempo nicht durchhalten!
Endlich zügelte der führende Ritter seinen Hengst.
Offensichtlich hielt er den Vorsprung nun für Ausreichend.
Im leichten Galopp liefen die drei Pferde nebeneinander durch den Morgennebel über die Ebene.
„Was ist eigentlich geschehen?“, fragte Barbara den Ritter, der neben ihr die Zügel in der linken Hand führte, während er mit der ihr zugewandten Hand seinen Schild nach vorn zog.
„Es gibt eine alte Prophezeiung, das dieses Kind das Königreich zerstören wird!“, erklärte er und blickte auf den Säugling, den Barbara immer noch fest gegen ihre Brust presste.
„Und warum hat uns keiner gewarnt?“, fragte sie entsetzt. Dann setzte sie hinzu: „Und warum helft ihr mir?“
Noch ehe der Mann ihr antworten konnte, zischte ein Pfeil an Barbaras Ohr vorbei. Das nächste befiederte Geschoss schlug in den Schild, den der Ritter schnell hinter sie gehalten hatte.
Barbara war kampferprobt und machte sich daher so klein, wie nur irgend möglich, da die Schutzfläche des Schildes nur begrenzt war.
Immer mehr Pfeile trafen diesen Schild oder den Rückenpanzer des Ritters. Dann kippte Waldemar mit einem Schrei getroffen neben ihr von seinem Pferd.
Schneller trieb sie ihr Pferd an, doch es war abzusehen, wann die Verfolger so nah waren, dass ihre Pfeile den Panzer des Mannes durchschlagen würden und dann waren auch sie und das Kind dem Tode geweiht.
Mit einem Mal rief der Ritter: „Flieh! Ich halte sie auf!”
Blitzschnell riss Siegmar sein Pferd herum, ritt den Feinden entgegen und nahm damit aber auch ihren Schutz mit.
Ein Pfeil streifte ihren Oberschenkel und sie schrie vor Schmerzen auf. Wenig später hörte sie hinter sich Gebrüll und das Schlagen von Schwertern auf Schilde.
Barbara spürte wie ihr das Blut am Bein herunterlief, aber sie konnte keine Hand lösen. Mit Erschrecken stellte sie fest, dass sie auf einen breiten Fluss zu ritt, der sich durch den Morgennebel glitzernd bemerkbar machte, aber sie durfte auch nicht stoppen oder ausweichen, denn dann würden die Verfolger sie einholen.
Vielleicht konnte ihre Stute einfach durch das Gewässer schwimmen!
Mit jedem Schritt kam das glänzende Band des Tassaros näher, doch bevor sie es erreichen konnte, hörte sie erneut die donnernden Hufe der Verfolger hinter sich.
Allerdings schossen sie keine Pfeile mehr auf sie. Vielleicht hatten sie ihre Munition schon verbraucht oder wollten das Kind lebend haben!
„Komm schon, Sturmwind!“, trieb sie ihre Schimmelstute an. Fast flehte sie darum, dass das Pferd sich beeilte.
Dann trat die Stute in ein Loch und überschlug sich. Barbara flog im hohen Bogen vom Rücken des Tieres und landete am Rande des Gewässers.
Noch immer gab das Kind keinen einzigen Ton von sich, obwohl es wach war.
Taumelnd humpelte Barbara in den Fluss.
Das Gewässer war breit. Konnte sie es mit ihrer Verletzung durchschwimmen? Wie stark war die Strömung? Sie wusste es nicht. Ohne diese Not wäre sie nun vor der Gefahr zurückgeschreckt, doch sie hatte der Königin versprochen, das Kind in Sicherheit zu bringen. Und das war nur in Cenobia möglich. Am, anderen Ufer dieses Flusses lag das Königreich! Dieser Strom war der Grenzfluss!
Sie setzte ihren Fuß in das Wasser, da traf sie ein Pfeil in den Rücken. Die Wucht des Geschosses zwang sie in die Knie. Barbara schrie auf und blickte sich über die Schulter um.
Neben ihr befand sich eine kleine Schilfinsel, auf die sie das Kind versteckt ablegte. Nach einem Stoß von ihr erfasste der Strom die Insel und trug sie davon.
Gegen die Schmerzen zwang sich Barbara vorwärts. Die Reiter erreichten den Fluss und ein weiterer Pfeil traf sie, diesmal in die Schulter.
Der erneute Treffer streckte sie nieder und sie fiel in die Strömung des Flusses. Schnell riss der Strom sie mit und drückte sie auf den Grund des Gewässers hinab.
3. Kapitel
Hexenworte
Xander stand auf der Spitze des Turmes seiner Burg, der den höchsten Punkt seines Reiches darstellte, und blickte auf all das hinab, was ihm sein Vater vor Jahren überlassen hatte. Das Königreich Mortunda war das mächtigste der fünf Reiche.
Sein Blick wanderte zu dem gewaltigen Hafen hinunter und dieser war der größte des ganzen Kontinents. Handel und reiche Silbervorkommen hatten den Wohlstand gemehrt und mit dem Eisen aus den Erzminen konnte er Rüstungen herstellen lassen.
Eine gewaltige Armee unterstand ihm.
Gut gerüstet und jederzeit bereit, irgendwo zuzuschlagen, wenn er es nur wollte.
König Xander war mächtig und er hatte Einfluss. Trotzdem war da etwas in ihm, was ihn ständig zum Nachdenken brachte.
Direkt unter seinen Füßen, im Zimmer in der obersten Etage des Turmes, wohnte eine alte Hexe, die schon seinem Vater und dessen Vater gedient hatte. Niemand wusste, wie alt sie wirklich war und sie war eigentlich schon immer hier gewesen. Vielleicht schon, bevor die schwarze Burg hier errichtet worden war.
Und genau diese Hexe oder besser die Worte dieser Hexe hatten ihn zum Nachdenken gebracht.
Vor ein paar Wochen hatte sie ihm gesagt, dass das Kind, das seine Frau in der Nacht zur Welt gebracht hatte, sein Geschlecht auslöschen und das Königreich zerstören würde.
Diese Prophezeiung war uralt, aber dass es dieses Kind war, das ihn vernichten würde, das hatte er erst durch sie erfahren.
Und das konnte er natürlich nicht zulassen!
Daher musste er sein erstgeborenes Kind den Schlangen opfern! Nach der Aussage der Hexe waren alle weiteren Kinder von dem Fluch nicht betroffen. Mehr noch, die weiteren Kinder, die er mit Theodoria haben würde, die würden das Königreich erhalten und auch nur diese.
Sonst hätte er die Königin samt ihres ungeborenen Kindes schon längst in der Schlangengrube versenkt und sich nach einer anderen Frau umgesehen.
Aber der Frau durfte nach dieser Prophezeiung nichts geschehen.
Daraus war eine komplizierte Lage entstanden: Er musste ihr das Kind entreißen, durfte ihr aber nichts tun!
Mit der Flucht der Zofe, die auch noch das Kind mitgenommen hatte, war es nur noch umständlicher geworden. Nur einen Augenblick hatte die Amme das Zimmer verlassen, obwohl er es ihr strengstens verboten hatte.
Nun lag die Amme am Fuße des Turmes direkt unter ihm. Dieses nutzlose Weib hatte sich selbst für ihr Vergehen gerichtet.
Sein Blick glitt über die Ebene und Xander suchte seine Reiter. Wie weit konnten die Flüchtlinge gekommen sein? Sicherlich nicht allzu weit. Das Land war flach und überschaubar.
Erst in den Wäldern von Waldonien hätten sie verschwinden können und da lag der Fluss davor. Ohne Boot war er praktisch unüberwindbar und die wenigen Brücken waren durch sein Heer gut gesichert.
Er schlug mit der Faust auf die Brüstung des Turmes und stieg über die Treppe eine Etage nach unten.
Xander schob die Tür auf und betrat den Raum der Hexe. Eine düsterere und stinkende Kammer war das hier. Über einem Feuer brodelte eine Flüssigkeit in einem Topf und der Dampf davon konnte sicher auch Farbe von den Wänden fressen.
Beißender Gestank schlug ihm aus diesem Kessel entgegen. „Wie hältst du das hier nur aus?“, fragte er die alte Frau, die hinter einem Vorhang auftauchte.
„Da gewöhnt man sich im Laufe der Jahre daran!“, krächzte sie und es war unverkennbar, dass die Dämpfe für diese Stimme gesorgt hatten.
„Sie sind geflohen!“, stellte er fest.
„Sie sind bereits gefasst!“, antwortete ihm die Hexe schnell, dann drehte sie sich zu einem metallenen Spiegel um und sah hinein.
Xander warf einen Blick über ihre Schulter darauf, konnte aber nichts darin erkennen.
„Wirklich?“, fragte er nach.
Die Hexe nickte, legte den Spiegel zur Seite und sagte: „Drei sind tot, einer lebt.“
„Siehst du das Kind?“, fragte er nach,
„Es treibt leblos im Fluss!“, entgegnete die zahnlose Alte.
„War das wirklich nötig?“, wandte Xander ein.
Die Alte nickte heftig, zog ein dickes Buch nach vorn und klappte es auf. Die Schrift darin war kaum noch zu entziffern. Es mochte wohl seit Jahrhunderten im Gebrauch sein und die Seiten waren vergilbt.
„Wie kannst du auf diesen Seiten überhaupt etwas erkennen?“, stellte er fest und blätterte darin herum.
„Ich kann es eben!“, erklärte die Alte triumphierend und schlug das Buch wieder zu. Eine Wolke aus Staub erhob sich in dem Raum und Xander musste husten.
„Solltest du mich belügen, dann warten die Schlange auf dich!“, sagte er drohend, doch wie sollte er wissen, ob sie ihn belog oder die Wahrheit sagte?
Offensichtlich wusste das auch die Hexe, denn sie grinste ihm frech ins Gesicht. Wenn er sie nicht vielleicht noch einmal brauen würde, so würde sie schon jetzt mit den Schlangen Bekanntschaft schließen können.
„Na gut“, begann er und blickte sich um. Fragend, als ob er etwas suchte, ging sein Blick durch den ganzen Raum. Was wollte er noch hier? War den jetzt nicht alles geklärt? Das Kind tot, die Zofe auch. Die Amme erst recht und der letzte der Verschwörer auf dem Weg zurück, um seine gerechte Strafe zu bekommen.
Alles in bester Ordnung, nur dass er dafür sein Kind opfern musste.
„Hast du nicht irgendeinen Trunk, damit meine Frau schnell abermals schwanger wird?“, fragte er nach.
„Für dich oder für sie?“, entgegnete die Hexe frech.
Schon alleine für diese Antwort hätte er ihre eine Natter an den Hals legen sollen. „Für sie natürlich oder zweifelst du an meiner Manneskraft?“, fragte er drohend.
Die Hexe erkannte ihren Fehler und wich langsam zur Wand zurück, aber sie konnte ihm ja nicht entkommen. Alsdann nahm sie eine Karaffe in die Hand und sagte: „Gib deiner Frau jeden Abend vor dem Schlafen gehen davon zehn Tropfen in den Wein und sie wird in einem viertel Jahr erneut schwanger sein.“
„Einfach nur so?“, fragte er und nahm die grünliche Flasche entgegen.
„Auch du musst deinen Teil dazu tun!“, setzte die Hexe fort. „Und nun geh!“, forderte ihn die alte Frau auf.
Xander war froh, aus dem Gestank zu entkommen und noch froher war er, dass nicht er dieses Gebräu trinken musste.
Schnell stieg er zu seinem Zimmer hinab, verwahrte die Flasche und trat auf den Gang. Am anderen Ende befand sich das Zimmer seiner Frau. Er nahm sich zwei Wachen und machte sich auf den Weg zu ihr.
Die Worte der Hexe gingen ihm durch den Kopf, aber er würde diese Tropfen erst einmal an einer Magd ausprobieren. Schließlich wollte er nicht riskieren, dass seine Frau daran starb. Das würde nur sein Königreich gefährden.
„Schick mir heute Abend die Elisa auf mein Zimmer“, sagte er im Vorbeigehen zu einer der Küchenmägde, die sich gerade tief vor ihm verbeugte.
4. Kapitel
Blutige Spuren
Ein Lärm im Burghof weckte Theodoria aus dem Schlaf. Die Sonne schien ihr direkt in ihr Gesicht, es musste also noch vor dem Mittag sein. Sie versuchte sich aufzurichten, aber die Schmerzen der gerade erst durchgestandenen Geburt waren noch viel zu groß.
Stöhnend ließ sie sich wieder auf ihr Lager zurückfallen. Leise rief sie: „Barbara!“, aber die Zofe kam nicht in den Raum, so wie sie es eigentlich erwartet hatte. Dann fiel Theodoria ein, dass sie die Magd mit dem Kind am Morgen fortgeschickt hatte.
Wer konnte ihr noch helfen? Die Amme vielleicht? Wie hieß sie noch einmal? Sie konnte sich nicht mehr an den Namen der Frau erinnern und einfach nur so um Hilfe zu rufen, das wollte sie nicht. Daher zog sie sich am Bettgestell in eine sitzende Position und versuchte die Beine aus dem Bett zu schieben.
Schon immer war sie eine starke Frau gewesen, doch im Moment überforderte sie sogar diese simple Bewegung. Theodoria hätte heulen können, aber diese Blöße wollte sie sich nicht geben.
Schnaufend saß sie wenig später auf der Bettkante und war mit dem Ergebnis ihrer Bemühungen nicht wirklich zufrieden.
Natürlich war es eine schwere Geburt gewesen. Stundenlang hatte sie sich von Wehe zu Wehe gequält. Eine Nacht des Schmerzes, der sie fast zu zerreißen drohte. Mehr als einmal hatte sie schon aufgegeben und nur die Amme hatte ihr durch diese schweren Stunden geholfen.
Niemand schien sich hier um sie kümmern zu wollen. Ihr Blick fiel auf die leere Wiege neben dem Bett. Hoffentlich hatte es Barbara geschafft, das Kind in Sicherheit zu bringen.
Mit einem Ruck zog sich Theodoria vom Bett und kam auf die Beine. Schwankend und sich am Bett festhalten stand sie zwischen Bett und Fenster und traute sich nicht, den stützenden Balken loszulassen.
Doch der Lärm vor dem Fenster wurde immer lauter und sie musste wissen, was da gerade geschah. Die Neugier trieb sie durch den Raum.
Zuerst zur Wand und dort entlang zum Fenster, auf dessen Fensterbank sie sich stützte und nach unten blickte.
Im Hof lag eine Frau unterhalb des Turmes und eine Blutlache breitete sich vor ihr aus. Es war nicht weit von ihrem Fenster bis zu der Leiche und an der Kleidung erkannte Theodoria, dass es die Amme war.
Nur sie hatte solch einen auffälligen Rock getragen und die ganze letzte Zeit immer davon erzählt, dass sie dieses bunte Stück Stoff von ihrer Mutter bekommen hatte.
Theodoria schlug sich vor Schreck die Hand vor den Mund, um nicht zu schreien. War die Amme vom Turm gesprungen? Aber warum? Wegen des Kindes, auf das sie nicht aufgepasst hatte? Oder war die Frau deswegen vielleicht vom höchsten Punkt der Burg in den Tod gestoßen worden?
Theodoria kannte den Jähzorn ihres Mannes, wenn etwas nicht nach seinem Willen geschah.
Noch etwas stellte sie mit Erschrecken fest: Diese Frau, deren Leiche jetzt am Turmfuß lag, hatte als einzige gewusst, ob das Kind ein Junge oder ein Mädchen war.
Im Moment der Geburt war der Schmerz so überwältigend gewesen, dass Theodoria es nicht gehört hatte und danach war das Kind in dem Tuch eingepackt gewesen.
Mit ihrem Tod hatte die Amme auch dieses Wissen mit in die Dunkelheit gerissen.
Die Tür des Raumes öffnete sich hinter ihr und ihr Mann betrat den Raum. Seine Augenbrauen waren so zusammengezogen, dass sie sich in der Mitte, über der Nase, berührten. Das verhieß nichts Gutes.
Sie kannte ihren Mann Xander und schon mehr als einmal hatte er sie geschlagen oder bedroht und so zuckte sie unter seinem Blick zusammen.
„Sage mir, wo du mein Kind hingebracht hast?“, schrie er sie an.
Zum Glück wusste sie nicht, wohin sich Ritter Siegmar gewandt hatte.
Knallend flog die Tür ins Schloss und der Mann kam bedrohlich auf sie zu. Mit jedem Schritt verstärkte sich abermals die Angst in ihr.
Als er nur noch einen Schritt vor ihr stand und schon die Hand zum Schlage erhoben hatte, klopfte es und ein Bote trat in den Raum. Nach einer Verbeugung sagte er: „Mein König. Wir haben sie!“
Mit einer erneuten Verneigung ging der Mann und Xander erklärte: „Du siehst, dein Plan ist nicht aufgegangen!“ Er ließ die Hand sinken und eilte aus dem Raum.
Ihr Herz krampfte sich bei dieser Nachricht zusammen. Die Magd hatte es nicht geschafft, den Häschern zu entkommen. Theodoria musste sich am Rand des Fensters festhalten, sonst wäre sie in den Raum gefallen, denn ihre Beine begannen zu zittern.
Erneut hörte sie Lärm aus dem Hof und drehte sich dorthin um.
Im Burghof, unterhalb ihres Fensters, zogen ein paar berittene Kämpfer einen Mann an einem Strick hinter sich her und sie erkannte in ihm den Ritter Siegmar, aber er war alleine.
Unter ihr blieben die Reiter stehen und Siegmar brach in die Knie. Einer der Kämpfer eilte zu ihrem Mann, der auf den Hof getreten war. Xander blickte zu ihr herauf und der König trat wieder in den Palas ein.
Nun erwartete Theodoria sein erneutes Erscheinen in ihrer Kammer, denn er würde ihr sicher vom Tode des Kindes berichten wollen. Diese Genugtuung wollte er sich wohl kaum entgehen lassen.
Theodoria kämpfte mit den Tränen und versuchte, ihre aufgewühlte Seele unter Kontrolle zu bekommen.
Ihr Kind war tot!
Gerade erst geboren hatte es schon den Tod gefunden!
Das Herz einer jeden Mutter würde daran zerbrechen, doch sie durfte keine Schwäche zeigen!
Was hatte sich ihr Vater, König Maximilian von Cenobia, nur dabei gedacht, sie hier in dieses Land zu diesem Mann zu geben? Offensichtlich hatte er damit bezwecken wollen, dass der seit Jahrzehnten tobende Krieg zwischen seinem Königreich und dem Königreich Mortunda, dessen König Xander war, beendet werden sollte.
Doch dieser Frieden war nun mit dem Tode ihres Kindes erkauft worden!
Noch blieb ihr die Hoffnung, dass es ihre Magd Barbara vielleicht doch geschafft hatte. Theodoria hatte sie ja unten nicht gesehen, doch mit jedem Augenblick schrumpfte dieses Vertrauen.
Hatten die Schlangen recht gehabt?
Nun wollte sie eigentlich nur noch Gewissheit haben.
Sie lauschte nach draußen auf die Geräusche vor der Tür. Waren da nicht Schritte zu hören? Die Tür öffnete sich erneut und diesmal betrat ihr Mann lächelnd den Raum. Aber es war ein seltsames Lächeln, das auf seinem Gesicht lag.
Genüsslich sagte er: „Der Knappe ist Tod. Deine Zofe und das Kind sind im Fluss ertrunken und was mit dem Ritter geschieht, das wirst du gleich mit deinen eigenen Augen sehen. Lass es dir eine Warnung sein!“
Mit Gewalt zog er sie hinter sich her. Aus dem Raum heraus, durch den Gang bis zu der Empore, von der aus man den ganzen Hof überblicken konnte.
Auf das Geländer gestützt blickte sie hinab zu Siegmar, der direkt unter ihr stand. Es waren nur ein paar Schritte zwischen ihnen und sie sah die Entschlossenheit in seinem Gesicht. Er nickte ihr zu, aber sie konnte nichts mehr für ihren Vertrauten tun.
Der Tod ihres Kindes hatte ihr Herz umklammert. Noch nicht einmal eine Träne hatte sie im Moment.
Sie wandte ihren Blick zur Seite, wo zwei Frauen gerade die tote Amme vom Hof schleiften. Die blutige Spur, die sie dabei hinterließen, sah wie eine große Schlange aus. Solch eine Schlange, wie sie auch im Wappen des Landes zu finden war und wie sie auch auf der Fahne abgebildet war, die direkt vor ihr im Wind flatterte.
„Fangt an!“, schrie Xander nach unten.
Zwei Männer begannen Siegmar die Rüstung vom Leib zu reißen. Stück für Stück fiel das Eisen zu seinen Füßen, bis er nur noch im langen, weißen Unterhemd und mit nackten Füßen im Burghof stand.
„Schau hin!“, sagte Xander drohend.
Er hielt ihren Kopf fest, wodurch sie ihren Blick nicht mehr abwenden konnte. Dann machte er ein Handzeichen und die beiden Männer zogen, den fast nackten Ritter hinter sich her zur gegenüberliegenden Burgmauer, vor der die Schlangengrube mit einem Gitter verschlossen war.
Das Gitter wurde nach oben gezogen und Siegmar hinuntergestoßen. Seine gellenden Schreie aus der dunklen Tiefe bohrten sich in ihre Ohren.
„Du bist die Nächste, wenn du nicht machst, was ich dir sage!“, erklärte Xander, ließ sie los und ging.
Theodoria brach auf der Empore zusammen und Dunkelheit umnachtete sie.
5. Kapitel
Vom Glück, ein König zu sein
Er blickte in die Dunkelheit hinaus, die nur spärlich von den Fackeln durchbrochen wurde. Unten im Burghof hatte jemand eine Feuerschale aufgestellt, die mit ihrem rötlichen Licht den Platz in ein diffuses Hell und Dunkel tauchte. Xander lehnte sich auf das Fensterbrett und schaute zum Tor hinüber. Dort patrouillierten gerade die Wachen.
Von da aus ging sein Blick in die Ferne, wo das silberne Band des Flusses im Mondlicht gerade noch so zu erahnen war. Des Flusses, der sein Kind getötet hatte und ihm damit zuvor gekommen war. Tat es ihm Leid? Eigentlich war es ja sein Fleisch und Blut gewesen, aber zum Schutze seines Königreiches mussten eben Opfer gebracht werden.
Der kühle Nachtwind drückte in den Raum herein und Xander stand nur im Unterhemd vor dem Bett. Über die Schulter hinweg warf er einen Blick zu der Frau, die in seinem Bett lag. Der Schein der Fackeln beleuchtete ihr schlafendes Gesicht.
Es hatte schon sein Gutes, wenn man König war. Ein Fingerzeig hatte genügt und die dralle Magd war in sein Bett gehüpft.
Zwei Gründe hatte er dafür gehabt, zum Ersten wollte er sehen, ob das Mittel der Hexe nicht zu gefährlich für seine Frau war, und zum zweiten hatten ihn die Monate der Abstinenz schwer zugesetzt. Er musste wieder in „Übung“ kommen.
Eine Weile würde er Elisa noch unter der Decke liegen lassen, bevor er sie erneut wecken würde, um zu prüfen, ob sie noch lebte und für einen zweiten Ansturm, denn der erste war viel zu schnell vorbei gewesen.
Elisa war eigentlich ganz hübsch und mit dem Mittel konnte sie ebenfalls von ihm schwanger werden. Wenn daraus ein Sohn entstand, so konnte er wenigstens auf diesen zurückgreifen, falls die Königin nur noch Mädchen zur Welt bringen würde. Und wenn es ein Problem mit der Magd oder ihrem Nachwuchs gab, dann war immer noch der Weg in die Schlangengrube für sie frei.
Xander drehte den Kopf und sah zu dem Gitter, das die Grube im Hof versperrte.
Tausende giftige Nattern warteten darunter auf ihre Opfer. Jeden Tag wurden sie mit Ratten gefüttert, die extra dafür im Keller der Burg gezüchtet wurden. Schon immer wurden bei ihnen Verbrecher, Verräter und andere unerwünschte Personen auf diese Art und Weise zu Tode gebracht.
Langsam ging er vom Fenster zurück zum Bett und beobachtete die Magd, wie deren Brust sich unter der Decke langsam hob und senkte.
Das Mittel schien also ungefährlich zu sein, aber hatte es auch die erwünschte Wirkung? Da musste er einfach auf das Mittel vertrauen. Wenn es jedoch nicht funktionierte, dann würde die Hexe schon sehen, wo sie landete.
Nun musste Xander an Ritter Siegmar denken, der ihr vorausgegangen war. Eigentlich war es schade gewesen, denn der Mann war ein hervorragender Kämpfer gewesen, aber eben auch ein Verschwörer. Und Strafe musste nun mal sein!
Hoffentlich hatte Theodoria den Wink verstanden.
Zum Glück wusste sie nicht, das ihr kaum etwas passieren konnte. Das Schicksal seines Königreiches war, nach der Prophezeiung, unlösbar mit ihrem Schicksal verknüpft. Nur er und die Hexe hatten davon Kenntnis und es würde auch so bleiben, weil niemand außer ihm den Weg in den Turm wagte. Zu viele Schauergeschichten rankten sich um diese uralte Hexe.
Ab dem nächsten Morgen würde er dann dafür sorgen, dass Theodoria nicht auf dumme Ideen kam. Die beiden Posten vor ihrer Tür hatten nicht viel gebracht, denn die Zofe hatte dennoch einfach so und unerkannt die Burg verlassen können.
Ihm würde sicher etwas dazu einfallen!
Sein Blick ruhte auf der nackten Schulter der Schläferin in seinem Bett. Langsam zog er ihr die Decke vom Leib und betrachtete ihren nackten Körper. Sie hatte sich zuerst geziert, auch das Unterkleid abzulegen, aber ein dezenter Hinweis auf die Grube hatte ihren Widerstand schnell gebrochen.
Macht war doch schon etwas Schönes, wenn man sie zu nutzen wusste.
Seine Augen tasteten ihren Körper ab. Sie war zwar drall, aber trotzdem wohlgestaltet. Bisher hatte das nur ihre Kleidung vermuten lassen, nun sah er sie unverhüllt und war mit seiner Wahl zufrieden.
Elisa hatte die Rundungen an den richtigen Stellen und noch dazu ein hübsches Gesicht. Xander mochte ja Frauen, an denen etwas dran war. Da hatte er bei seiner Königin nicht so richtig was in der Hand, aber die Frau war ja nicht zum Vergnügen da. Diese Magd hier schon.
Runde, pralle Brüste, ein flacher Bauch und ein Dreieck aus braunen, gekringelten Locken über ihrer Scham. Lüstern fuhr er sich mit der Zunge über seine Lippen.
Seiner Frau würde er ab dem nächsten Abend die Tropfen geben und sie noch ein paar Tage in Ruhe lassen, damit sie sich von der Geburt erholen konnte. Ein oder zwei Wochen der Schonung mussten reichen. Mehr gewährte er ihr nicht!
Danach würde er täglich bei ihr und der Magd sein.
Die eine für die Pflicht, die andere für den Spaß!
Sein Blick wanderte an der Magd aufwärts und er merkte, dass ihn dieser Anblick erneut erregte.
Die Erholungspause war vorbei.
Grob fasste er ihr an die Schulter und rüttelte die Magd wach. „Komm schon, weiter geht es! Schlafen kannst du in deinem eigenen Bett!“, fuhr er sie an, zog sich das Unterhemd über den Kopf und sah, dass er noch einen Augenblick warten musste.
Daher begann er die Frau in die richtige Position zu ziehen. Er schob ihr die Schenkel auseinander, ließ sich auf sie fallen und rammte sich in ihren Leib.
Ihr spitzer Schrei war für ihn Genugtuung und dass es, bei den offenen Fenstern, jeder in der Burg hören konnte, das spornte ihn nur noch mehr an.
Sein Schnaufen vermischte sich mit ihren Klagelauten.
Es war schon ein Glück, König zu sein.
Stoß um Stoß trieb er sich immer weiter in sie, bis es kein Halten mehr gab. Xander bäumte sich auf und schoss seinen Samen in ihren Leib. Die Magd seufzte dabei erleichtert.
„Warte! So leicht kommst du mir nicht davon!“, dachte er und hielt sie im Bett, als sie sich entfernen wollte.
„Bleib! Ich brauche deine Dienste gleich noch ein weiteres Mal!“, erklärte er und ihr entsetztes Gesicht war mehr als ein Dank für ihn.
„Mein König, ihr seid ja unersättlich“, stellte sie fest.
Xander hörte darin allerdings ihre Bewunderung heraus, für das, was er sich da vorgenommen hatte.
„Ich habe ja auch ein paar Monate aufzuholen“, begann er und sagte weiter: „Stell dich vor das Bett in den Fackelschein.“
Schnell kam sie seinem Willen nach.
„Ab jetzt wirst du jeden Abend zu mir kommen!“, legte er fest und beobachtete die tänzelnden Bewegungen der Magd.
Sie drehte sich vor ihm und Xander bemerkte schon bald, dass er abermals für sie bereit war.
„Und nun komm her!“, befahl er.
6. Kapitel
Doppeltes Glück?
Mit einer schnellen Handbewegung schob sich Sandra die widerspenstige Haarsträhne hinters Ohr. Noch war diese störrische Strähne zu kurz für den Zopf und Abschneiden wollte sie diese auch nicht. Sandra schob ihren Bauch vor sich her und es war nicht mehr lange hin, bis das Kind endlich auf diese Welt kommen würde.
Auf den Stock gestützt, blickte sie zu der Kuhherde hinüber, die vor ihr auf der Weide graste. Eigentlich war das die Aufgabe ihres Mannes, doch der Fürst hatte alle Kämpfer von Wiesenland in seine Burg beordert. Dass er die Dörfer dadurch schutzlos zurückließ, das riskierte er damit einfach.
Mit der Abwesenheit der Männer hatten sich die Frauen bewaffnet, doch um ihren Bauch ging der Waffengürtel schon lange nicht mehr zu. Aus diesem Grund hatte sie das lange Schwert vor sich in den Boden gerammt.
Ob sie allerdings überhaupt in der Lage wäre, es zu benutzen, das stand in den Sternen und wenn sie auf den Rücken fiel, dann würde sie aus eigener Kraft wohl kaum wieder auf die Füße kommen.
Sandra war zweiundzwanzig und erwartete ihr erstes Kind. Eigentlich war das schon viel zu spät, denn die Frauen heirateten meist mit achtzehn und die anderen Frauen in ihrem Alter hatten schon vier Kinder, falls alle überlebten.
In den letzten Jahren war das Wetter ausgezeichnet. Die warmen Sommer brachten gute Ernte und sattes Vieh. Allerdings lockte das auch neidische Nachbarn an.
Und daher war das Schwert nötig!
Sandra legte sich die Hand an die Stirn und beschattete so ihre Augen. Ihr Blick ging nach Süden, denn von dort kam die größte Gefahr. Dort lebten die räuberischen Reiterhorden der Tuck! Eine tödliche Bedrohung für die friedlichen Bauern von Wiesenland.
Aber alles war ruhig. Keine Staubfahne war am Horizont zu sehen. Es war ein flaches Land und man hätte es erspähen können, wenn die Tuck kamen oder die Männer aus der Burg des Fürsten wieder aufbrachen, auch wenn das ein halber Tagesritt war.
Unweit ihrer kleinen Siedlung schlängelte sich der Tassaros durch die weite Ebene. Der breite Strom sorge dafür, dass das Flachland fruchtbar blieb. Er verzweigte sich in viele kleine Bäche, so wie derjenige, der nicht weit vor ihr als Tränke für die Kühe diente.
Und es gab eine Menge Tiere in ihrem Dorf. Kühe, Schafe, Ziegen, Schweine, Gänse und sie hatten auch drei Pferde. Für die Feldarbeit nahmen sie allerdings die Ochsen, denn die Pferde waren viel zu zierlich und nur zum schnellen Reiten geeignet.
Sie nahmen sie für Botenritte zum Fürsten oder zu anderen Siedlungen, die weit über die Ebene verstreut lagen. Schwere Arbeit leisteten die Pferde nicht.
Da es nur drei waren, konnten auch nur drei Männer zum Fürsten reiten und ihr Mann war einer davon. Die anderen mussten mit einem der Karren fahren. Ihr Mann war der Stammesführer, auch wenn er noch ziemlich jung war.
Irgendwie erfüllte sie das mit Stolz, andererseits hätte sie gerade jetzt ihren Mann gern in der Nähe gehabt. Zwar war das Kinderkriegen schon immer Frauensache und die alte Emilia, als erfahrene Hebamme, würde ihr dabei helfen.
Allerdings war die Frau mehr als siebzig Jahre alt und an manchen Tagen blind wie ein Maulwurf. An guten Tagen ging es und Sandra betete jeden Morgen zur großen Göttin, dass Emilia einen guten Tag hatte, wenn die Geburt begann.
Ein leichtes Ziehen lief durch ihren Bauch und Sandra schaute sich nach der Siedlung um. Es waren vierhundert Schritte bis zu ihrer Hütte und etwas riet ihr, sich jetzt auf den Weg zu machen, wenn sie ihr Kind nicht alleine auf dem Feld zwischen den Kühen bekommen wollte.
Sandra warf noch einen letzten Blick nach Norden, wo sich ihr Mann jetzt befand und gab eine stumme Bitte ab, dass er sich beeilen sollte, dann lief sie auf ihren Stock gestützt los.
Nach zweihundert mühsamen Schritten zuckte eine schmerzhafte Wehe durch ihren Bauch.
Hundert Schritte später lief es ihr feucht am Bein herab und nun kamen die Wehen aller zwei Schritte.
Langsam senkte sich die Dämmerung auf die Siedlung herab.
Als sie endlich die Hüttentür erreicht hatte, stand Emilia dort und sagte vorwurfsvoll: „Kindchen! Wo bleibst du denn?“
Wenn sie die Hebamme nicht noch gebraucht hätte, so hätte jetzt ihr Hirtenstab seinen Tanz auf dem Rücken der alten Frau vollführt.
Endlich konnte Sandra auf die alte Frau gestützt die Hütte betreten. Emilia lehnte sie an die hintere Hüttenwand und begann das Herdfeuer zu schüren. Während es rings um sie hell wurde, presste sich Sandra vor Schmerzen gegen die Wand der Hütte.
„Schrei deinen Schmerz heraus“, riet ihr die alte Frau, die wohl schon hunderte Kinder, einschließlich Sandra und ihren Mann, auf diese Welt gebracht hatte.
Sandra brüllte die Wand der Hütte an und es schien wirklich zu helfen, auch wenn sie nun schon etwas verzweifelt darüber war, dass sie hier nur an der Wand lehnte, während die alte Frau Wasser heiß machte. Doch der Hirtenstab stand an der anderen Hüttenwand. Unerreichbar fern!
Ein neuer Schmerzensschrei, der die Hütte zum Beben brachte, folgte und auf einmal stand ihr Mann in der Hüttentür, so als hätte sie ihn damit gerufen.
Er trug ein Bündel in der Hand und sagte: „Schau mal Sandra, das habe ich gefunden. Es trieb auf einer Schilfinsel im Fluss!“
Es sah wie ein Kind aus, aber in ihrem derzeitigen Zustand hätte es auch ein Löwe sein können, es hätte sie nicht interessiert.
Emilia wandte sich nun vom Wasser dem Kind zu. „Es ist ja ganz nass!“, sagte die alte Frau, als sie es berührte.
Verzweiflung und Wut stiegen in Sandra hoch. Was war mit ihr?
„Kümmert sich hier mal jemand um mich!“, brüllte sie zwischen zwei Wehen heraus, dann musste sie abermals vor Schmerzen wimmern.
„Hilf ihr! Ich werde das Kind trocken machen und windeln!“, sagte Emilia zu dem Mann, der danach zu Sandra eilte. Aber mehr als ihre Hand halten und sie trösten konnte er im Moment nicht.
Die Natur hatte begonnen, die Kontrolle zu übernehmen und da waren sie alle drei hilflos.
„Es dauert so lange, wie es eben dauert!“, ließ sich die alte Hebamme vernehmen, die nun das Kind abgelegt hatte und sich endlich ihr zuwandte.
Emilia schob ihr das Kleid hoch und betastete Sandras Bauch. „Nicht mehr lange, dann hast du es geschafft“, erklärte sie, während Sandras Beine vor Anstrengung zu zittern begannen.
Die Stellung war nicht sonderlich bequem. Sandra stand mit gespreizten Beinen an die Wand gelehnt.
„Und jetzt presse dich gegen den Schmerz!“, rief die Alte und kniete sich vor Sandra auf den Boden.
Es schien etwas in Sandras Bauch in Bewegung zu kommen. Mit einer unmenschlichen Kraftanstrengung presste sie das Kind schreiend nach draußen, während Emilia es unter ihr auffing.
Dann rutschte Sandra an der Hüttenwand herab und es wurde dunkel um sie herum.
Sie erwachte wenige Zeit später, als jemand ihr Gesicht streichelte. Sie lag in ihrem Bett und ihr Mann kniete neben ihr. Sie blickte zur Seite und sah das Kind. Oder besser, zwei Kinder, gleich eingepackt nebeneinander in der Wiege liegen.
„Und welches ist nun meines?“, fragte sie.
„Das Linke!“, sagte Emilia.
„Nein! Das Rechte!“, setzte ihr der Mann entgegen.
Sandra sah etwas verzweifelt zwischen der alten Frau und ihrem Mann hin und her. Dann sagte sie: „Dann sind es eben nun beides meine Kinder!“
Ihr Kopf fiel auf das Lager zurück und erschöpft schlief sie wieder ein.
7. Kapitel
Der Weg des Schwertes
Etwas strich über ihr Gesicht und alles war dunkel um sie herum, bis Barbara begriff, dass sie noch die Augen geschlossen hatte. Mühsam öffnete sie die Lider und erblickte eine niedrige Zimmerdecke über sich. Eigentlich hatte sie erwartet, für ihr Versagen in der Hölle zu schmoren, doch offensichtlich war sie noch am Leben.
Der stechende Schmerz in ihrem Rücken sprach zumindest dafür, denn Tote hatten vermutlich keine Schmerzen mehr.
Eine alte Frau beugte sich über sie.
„Da bist du ja wieder Kindchen“, sagte die Alte mit einer sanften Stimme.
„Wo bin ich hier?“, fragte Barbara mit brüchiger Stimme.
„In der Burg von König Maximilian“, antwortete die Frau.
Barbara wollte sich von dem Lager erheben, um ihm Bericht zu erstatten, doch es gelang ihr nicht. Ihr sonst so starker Körper versagte seinen Dienst und die schwache alte Frau konnte Barbara ohne Probleme zurück in das Bett drücken.
„Bitte! Ich muss mit dem König reden. Es ist wichtig!“, flüsterte sie, dann wurde es wieder schwarz um sie herum.
Erneut spürte sie diese streichelnde Bewegung an ihrer Stirn. Wie durch einen Nebel hindurch konnte sie abermals die alte Frau über sich sehen. Leise Gespräche wurden in dem Raum geführt, doch sie konnte nichts davon verstehen.
Ihr ganzer Körper schien in Flammen zu stehen und offensichtlich hatte sie starkes Fieber. Die Schmerzen schienen abgeklungen zu sein, aber sie fühlte sich matt und erschöpft.
„Bitte! König Maximilian…“, flüsterte Barbara und in ihrem Blickwinkel tauchte die Königin auf.
„Was ist mit meiner Tochter?“, fragte die Königin laut.
Barbara musste die Augen schließen und eine Welle des Schmerzes rollte über ihren Körper, der ihr die Tränen aus den Augen drückte.
Mit geschlossenen Augen begann sie zu erzählen. Von der Flucht und dem Kind. Abermals strich ihr jemand über das Gesicht und sie bemerkte, dass es die Königin war.
Überraschend sanft sagte die Herrin: „Du kannst nichts dafür. Vielleicht hat mein Enkel überlebt, aber es war Theodorias Entscheidung. Du hast alles getan, was in deiner Macht stand.“
„Es war mein Fehler. Ich sollte das Kind hierher zu euch bringen. In Sicherheit vor den Schergen von König Xander. Doch ich habe versagt. Das werde ich mir niemals verzeihen!“, entgegnete Barbara.
„Du musst dich schonen“, begann wiederum die alte Frau. Danach schob sie die Königin zur Seite und wischte mit dem Lappen über Barbaras Stirn.
„Bitte lass mich sterben. Ich bin es nicht wert, dass du mein Leben rettest“, sagte Barbara schwach.
„Das kommt gar nicht infrage“, erklärte nun die Königin und setzte fort: „Du hattest zwei Pfeile im Rücken und bist fast ertrunken. Was hättest du noch tun können?“
„Meine Pflicht war es, das Kind zu retten oder zu sterben. Beides habe ich nicht vermocht“, entgegnete Barbara bitter und drehte ihr Gesicht fort, damit die Königin ihre Tränen nicht sehen konnte.
Es wurde leise um sie herum, dann fiel ein weißer Schleier vor ihre Augen. Wie in einer Trance sah sie das Kind im Fluss treiben.
Vielleicht lebte es noch und dann würde sie es eines Tages mit ihrem Leben beschützen, doch dazu musste sie noch viel lernen. Eine leise Stimme war in ihrem Kopf, die jetzt genau das von ihr forderte.
Zwei lange Wochen später konnte sich Barbara wieder im Bett aufsetzen. Die dicken Verbände wurden gelöst und die alte Frau strich ihr eine kühlende Salbe auf die Schulter, die Barbara immer noch nicht richtig bewegen konnte. Dabei sagte die alte Frau: „Du hattest großes Glück. Der eine Pfeil hat dein Herz nur um Fingerbreite verfehlt.“
Barbara schnaubte laut: „Er hätte mich töten sollen für mein Versagen. Ich hätte die Königin niemals verlassen dürfen.“
„Du hast doch aber nur ihren Wunsch ausgeführt. Oder?“, setzte die Alte dagegen.
„Es war kein Wunsch, es war ein Befehl. Ich habe die Angst um das Kind in ihren Augen gesehen. Und ich konnte es nicht retten“, beendete Barbara die Rede und versuchte die Schulter zu bewegen, aber das gelang ihr nicht richtig.
„Du brauchst noch Schonung!“, erklärte die Alte und versuchte Barbara abermals in das Bett zurück zu drücken.
„Ich war viel zu lange untätig!“, erklärte Barbara und wehrte den Versuch ab.
Schwankend erhob sie sich aus dem Bett.
„Was willst du tun?“, fragte die alte Frau erschrocken.
„So werde ich nie wieder meiner Herrin unter die Augen treten können. Aber ich muss stark sein, wenn sie nach mir ruft. Ich gehe in die Berge, zu dem alten Schwertmeister Dakora. Er wird mich trainieren, damit ich beim nächsten Mal nicht erneut so kläglich versage.“
„Kindchen. Nimm dir Zeit“, widersprach die alte Frau kopfschüttelnd.
„Ich hatte genug Zeit zum Weinen. Nun ist es Zeit, den Kampf vorzubereiten. Gib mir deinen Dolch!“, antwortete Barbara starrsinnig und versuchte die Waffe aus dem Gürtel der alten Frau zu ziehen, doch der Arm griff ins Leere, weil die Schulter schmerzte und die Alte seltsam schnell war.
„Ich kann dich so nicht gehen lassen. Ich werde dich begleiten müssen, wenn du nicht auf mich hörst und noch ein paar Wochen das Bett hütest!“
„Ein paar Wochen noch? Bist du verrückt?“, rief Barbara erzürnt und setzte hinzu: „Wenn du mich begleiten willst, dann mache dich bereit. Wir brechen unverzüglich auf!“
Barbara erhob sich schwankend und saß einen Augenblick später erst mal wieder im Bett, weil ihre Beine zu sehr zitterten.
„Wir brauchen etwas zu Essen und Waffen. Und ich benötige einen Stock, auf den ich mich stützen kann. Kannst du uns das alles besorgen?“, fragte Barbara, nun schon etwas sanfter.
Sogleich eilte die Alte aus dem Raum und war wenig später zurück. Sie hatte ein großes Schwert in der Hand, das reich verziert war.
„Wo hast du das denn her?“, fragte Barbara, als sie die prächtige Waffe aus der Scheide zog.
„Die Königin gibt es dir für deine Verdienste“, erklärte sie.
Barbara küsste die Klinge und sagte: „Ich werde diese Waffe in Ehren halten und jederzeit für meine Königin einsetzten, wenn sie nach mir ruft!“
Dann stemmte sie sich vom Bett hoch, griff zu dem Wanderstock und befestigte sich das Schwert so auf dem Rücken, dass sie es mit dem gesunden, linken Arm ziehen konnte.
„Wir gehen jetzt den Weg des Schwertes“, erklärte Barbara und humpelte, auf die Alte gestützt, aus der Burg hinaus.
Miteinander machten sie sich auf den Weg in das Gebirge, um dort nach dem alten Meister zu suchen.
8. Kapitel
Mathildas Hilfe
Zwei Kinder waren eigentlich eines zu viel! Sandra hatte gerade für eines davon Milch und nun hatte sie zwei hungrige und fast ständig schreiende Kinder zu versorgen. Ein Mädchen und einen Jungen. Sie sahen sich ähnlich, als wären sie Zwillinge und Sandra wusste nicht, welches davon wirklich ihres war.
Wie nicht anders zu befürchten gewesen war, war Emilia an jenem Tag blind wie ein Maulwurf gewesen. Sie konnte nicht mehr sagen, ob das aus dem Fluss gerettete das Mädchen oder der Junge gewesen war und genauso wenig hatte ihr Mann aufgepasst, ob sie einen Jungen entbunden hatte.
Sie selbst war ja im Moment der Geburt bewusstlos geworden. Damit würde sie die beiden Kinder also wie Zwillinge aufziehen und Sandra liebte sie auch beide. Nur das Milchproblem musste gelöst werden.
Dummerweise war sie aber im Moment die einzige Frau in der Siedlung mit einem kleinen Kind. Zwei weitere Frauen waren schwanger und es würde noch einige Tage oder Wochen dauern, bis diese dann eventuell helfen konnten. Doch die hätten ja dann auch ihre Kinder.
Nach nur einer Woche war Sandra mit ihren Nerven völlig am Ende und zusätzlich machte sie sich darüber Sorgen, dass eines der Kinder vielleicht verhungern könnte.
Als nur noch ein Gebet an die große Göttin helfen konnte, steckte die Ziege Mathilda ihren Kopf durch die Tür und meckerte sie an.
„Ich habe jetzt keine Zeit, dich zu melken!“, begann Sandra die Ziege anzufahren und setzte fort: „Geh doch zu jemand anderem!“
Doch die Ziege blieb und zeigte mit dem Kopf zu ihren Zitzen. „Ach lass mich doch in Ruhe, du dumme Ziege!“, schrie Sandra das Tier in ihrer Verzweiflung an, doch Mathilda ließ sich nichts anmerken.
Auf einmal fiel es Sandra blitzartig ein: „Ziege … Zitzen … Milch … schreiende Kinder!“
Mit einem Sprung war sie bei dem Tier und begann die Ziege zu melken.
Wenig später hatte sie einen kleinen Eimer mit Milch, aber immer noch zwei hungrige Kinder, die noch nicht aus dem Becher trinken konnten. Was nun?
Emilia sah zur Hütte herein. „Warum schreien deine Kinder so?“, fragte die alte Frau und schon alleine dafür hätte Sandra die alte Frau durch das Dorf jagen können, doch sie zwang sich zu Ruhe.
Sandra drehte sich um zu ihr um und fragte: „Ich habe hier die Ziegenmilch. Wie bekomme ich die in meine Kinder hinein?“
Die alte Frau kratzte sich am Kopf und überlegte, dann antwortete sie: „Mit einem Trinkschlauch und einem Kuhhorn vorn darauf!“
„Ein Kuhhorn?“, fragte Sandra und sah sich schon suchend in der Hütte um. Einen Trinkschlauch besaß sie, aber die Öffnung davon war viel zu groß. Ein Kuhhorn mit einer abgesägten Spitze schien ihr eine perfekte Wahl, aber im Moment gab es kein Kuhhorn in der Hütte.
Nachdenklich blickte sich Sandra weiter um, bis Mathilda ihr ihre Hörner in den Hintern rammte.
„Aua!“, schrie Sandra und fuhr wütend herum. Während sie sich das schmerzende Hinterteil rieb, reifte ein verwegener Plan in ihrem Kopf heran.
Warum sollte sie ein Kuhhorn nehmen, wenn Mathilda zwei Hörner hatte! Nun hieß es, die Ziege bei den Hörnern zu packen!
Doch Mathilda war schnell. Hatte sie zuvor die ganze Zeit den Kopf in der Hütte gehabt, so schien sie nun Sandras Plan zu erahnen.
Es entbrannte eine wilde Jagd um die Hütte. Die Ziege vornweg und Sandra mit dem gezogenen Messer in der Hand hinter ihr her!
Das Tier war schnell, aber Sandra war in ihrer Not zu allem entschlossen.
Fünf Runden brauchte sie, um die Ziege einzuholen. Dann hatte sie eines der Hörner in der Hand, aber das störrische Tier wehrte sich. Augenscheinlich wollte sie keine der Spitzen einbüßen.
Die beiden schreienden Kinder in der Hütte trieben Sandra aber dazu, Mathilda mit aller Entschlossenheit festzuhalten. Das bockige Tier versuchte weiterhin zu entkommen, doch mit einem kurzen Hieb trennte Sandra ein etwa daumenlanges Stück des Hornes ab, das sie gerade in der Hand hatte.
Die Ziege machte einen Satz und verschwand.
„Danke Mathilda!“, rief Sandra ihr noch hinterher und bedankte sich damit für die eher unfreiwillige Spende des Tieres.
Sandra suchte das abgeschlagene Stück und fand es wenig später im hohen Gras neben der Hütte. Augenblicke später hatte sie das Hornstück, nun ausgehöhlt und mit einer Öffnung an beiden Seiten, an seinen neuen Platz auf dem Trinkschlauch befestigt.
Damit konnte Sandra den Kindern auch von der Ziegenmilch etwas abgeben. Zuerst begann sie bei dem Mädchen, weil das am lautesten schrie.
Gierig trank Zondala, wie sie die kleine genannt hatte, die Milch aus dem Schlauch, auch wenn es für sie ungewohnt war. Schließlich lief die Milch ja aus dem Schlauch, ohne das Zondala saugen musste.
Es dauerte eine Weile, bis Sandra begriffen hatte, wie sie das Kind damit füttern konnte. Dann war Claudius, ihr Sohn, an der Reihe. Da er sich aber dermaßen ungeschickt anstellte, gab sie ihm wieder die Brust und damit war die Ziegenmilch nun hauptsächlich für die Tochter vorgesehen.
Auch Mathilda hatte sich wieder beruhigt und blickte meckernd zur Hütte herein. Die zwei ungleich langen Hörner schienen sie nicht zu stören, auch wenn es seltsam aussah.
„Ich danke dir“, sagte Sandra leise zu dem Tier und die Ziege schien ihr zuzunicken.
Von nun an würden sie sich die Ernährung der beiden Kinder teilen müssen. Trotzdem ging das nicht gleichzeitig. Sie konnte ja nicht ein Kind an der Brust halten und dem zweiten den Schlauch in den Mund schieben. Das gestaltete sich etwas schwierig, aber Sandra versuchte es dennoch.
Plötzlich sprang die Ziege in die Hütte und ging zur Wiege, in der Zondala lag. Noch bevor Sandra das Tier verscheuchen konnte, stellte sie Mathilda über die Wiege. Die Höhe war fast perfekt, wodurch Zondala an die Zitze der Ziege herankam.
Als wäre es das normalste der Welt, begann das Mädchen zu trinken und Mathilda ließ das zu, als wäre es eines ihrer Zicklein.
Liebevoll strich Sandra dem Tier über den Kopf.
So etwas hatte sie noch nirgendwo gehört, aber für Zondala und Mathilda war es offensichtlich völlig in Ordnung und daher konnte sie sich nun ausgiebig um ihren Sohn kümmern, der schmatzend an ihre Brust lag.
Eine friedliche Stimmung legte sich über die Hütte und die hektische Jagd war schon lange vorbei und vergessen.
9. Kapitel
In finsteren Wäldern
S