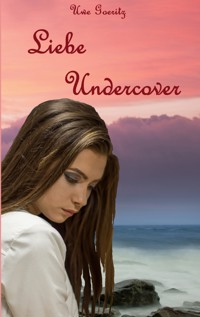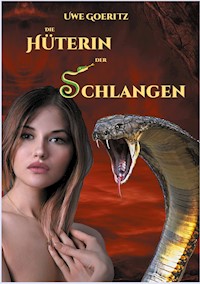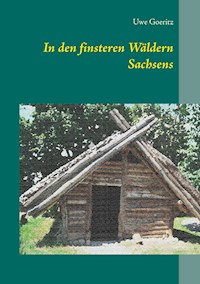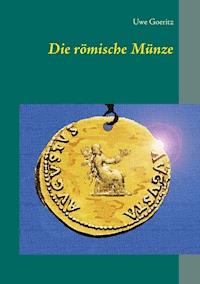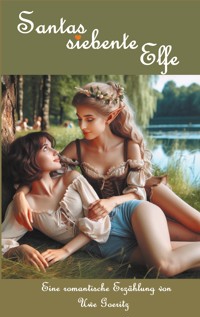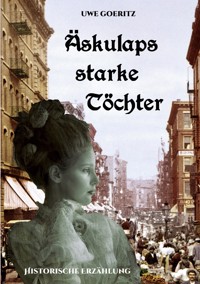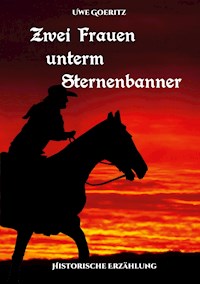Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Der Schmied des Königs" Altersfreigabe: ab 16 Jahren Nach dem Zerfall des Frankenreiches im Jahre 843 in drei Teile trat mit König Heinrich im Jahre 918 ein Sachse die Herrschaft über das ostfränkische Reich an. Dieses Teilreich war allerdings mehr ein loser Verband von vielen zum Teil miteinander zerstrittener Stammesverbände. Ab dem Jahre 900 nutzte das Reitervolk der Ungarn die Schwächen der drei Teilreiche gnadenlos aus. Immer wieder fielen die feindlichen Krieger plündernd und brandschatzend in das Land der Sachsen an deren östlichem Rande ein. Gegen diese blitzschnellen Angriffe schien kaum eine militärisch erfolgreiche Gegenwehr möglich zu sein, denn genauso plötzlich wie sie kamen, verschwanden die Angreifer auch wieder. Diese heimtückischen Angriffe wurden zunehmend zu einer ernsten Probe der Herrschaft des Königs. Diese Geschichte handelt von einem Jungen, der das heimatliche Dorf verlässt, um genau in dieser Zeit in der Fremde das Handwerk des Schmiedes zu erlernen. Hin- und hergerissen zwischen dem alten Glauben an die Götter und dem Christentum versucht er, seinen Platz in dieser Welt zu finden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Der Schmied des Königs
Ein Höllenschlund
Zwei ungleiche Freunde
Gesellenjahre
Ein Stadtleben
Auf der Suche
Viel zu lernen
Ein langer Weg
Ein neuer Freund
Geheimes Wissen
In der Glut der Erde
Besondere Steine
Ein Auftrag des Königs
Auf der Flucht
Greta
Gefährliche Beschwörungen
Unerwartete Hilfestellung
Genau richtig
Die gekaufte Braut
Hexenwerk und Kirchensegen
Auf zum König!
Im richtigen Moment
Zum Sieg geführt
Ein königliches Privileg
Im Dunkel der Nacht
Zeitliche Einordnung der Handlung:
Der Schmied des Königs
N ach dem Zerfall des Frankenreiches im Jahre 843 in drei Teile trat mit König Heinrich im Jahre 918 ein Sachse die Herrschaft über das ostfränkische Reich an. Dieses Teilreich war allerdings mehr ein loser Verband von vielen zum Teil miteinander zerstrittener Stammesverbände.
Ab dem Jahre 900 nutzte das Reitervolk der Ungarn die Schwächen der drei Teilreiche gnadenlos aus. Immer wieder fielen die feindlichen Krieger plündernd und brandschatzend in das Land der Sachsen an deren östlichem Rande ein.
Gegen diese blitzschnellen Angriffe schien kaum eine militärisch erfolgreiche Gegenwehr möglich zu sein, denn genauso plötzlich wie sie kamen, verschwanden die Angreifer auch wieder.
Diese heimtückischen Überfälle wurden zunehmend zu einer ernsten Probe der Herrschaft des Königs.
Diese Erzählung handelt von einem Jungen, der das heimatliche Dorf verlässt, um genau in dieser Zeit in der Fremde das Handwerk des Schmiedes zu erlernen. Hin- und hergerissen zwischen dem alten Glauben an die Götter und dem Christentum versucht er, seinen Platz in dieser Welt zu finden.
Die handelnden Figuren sind zu großen Teilen frei erfunden, aber die historischen Bezüge sind durch archäologische Ausgrabungen, Dokumente, Sagen und Überlieferungen belegt.
1. Kapitel
Ein Höllenschlund
D ie beiden Jungen liefen auf den Wald zu. Sie waren gute Freunde und noch keine zehn Jahre alt. Noch nie waren sie alleine in den Wald gelaufen und eigentlich hätten sie gar nicht hier sein dürfen, denn sie hatten es ihren Müttern versprochen.
Heute zum Sonntag, nachdem sie im Gottesdienst gewesen waren, sollten sie in der Nähe des Tores bleiben, das den hölzernen Wall unterbrach, aber der Wald lockte sie viel mehr.
Die beiden ließen die Hütten hinter sich und gingen das kleine Stück Freifläche hinüber, das sich vor dem Palisadenwall erstreckte.
Am Waldrand angelangt drehten sie sich noch einmal um und schauten auf die kleine Siedlung zurück. Zehn Hütten und genauso viele Ställe gab es. Eine Schänke und eine kleine Kirche, deren Glockenturm nur mannshoch über dem Dach aufragte und doch der höchste Punkt des Dorfes war. Keiner war ihnen gefolgt und so verschwanden sie schnell in dem Waldstück, das sich rings um das Dorf erstreckte.
Sie waren schon eine ganze Weile durch das Unterholz geschlichen und jedes Mal, wenn sie eine der Hecken durchquerten, mussten sie einen Teil ihrer Kleidung zurücklassen. Mal ein Stück Hose und mal ein Stück vom Ärmel. Wie sie das hinterher ihren Müttern erklären wollten, hatten sie sich noch nicht überlegt, aber wie immer würde ihnen da sicher auch heute etwas als Ausrede einfallen.
Und plötzlich standen sie vor einer fast senkrecht nach oben führenden Felswand und schauten sich nach beiden Seiten um. Gab es da einen Weg darum herum?
„Nach links“, sagte einer von ihnen, zeigte dabei aber nach rechts.
Er hatte da so seine Schwierigkeiten, aber beide folgten der gezeigten Richtung.
Am Fuße des Berges entlang bewegten sie sich vorwärts.
Unheimlich und düster war es hier, aber das schien den beiden zu gefallen. So würden sie noch viel mutiger vor ihren Freunden dastehen, wenn sie von ihrem neuen Abenteuer erzählen würden.
Der Junge, der voranging, stützte sich gegen die Wand des Felsens, als er einen Stein übersteigen wollte, und stutzte. Da war ein Zittern in seiner Hand und er blieb stehen. Etwas pochte rhythmisch in seiner Hand. Schließlich legte er sein Ohr an den Felsen und hörte ein leises Brummen.
Auch der zweite Junge hörte es und daraufhin schlichen sie vorsichtiger weiter.
Alle paar Schritte lauschten sie an der Wand und das Geräusch schien immer lauter zu werden.
Sämtliche Vögel waren verstummt und gerade schoben sie sich gegenseitig vorwärts, denn keiner wollte als Feigling dastehen und so hatten sie sich selbst gefangen.
Schritt für Schritt schoben sie sich durch den immer dunkler werdenden Wald und erreichten einen Stolleneingang, aus dem das pochende Geräusch zu kommen schien.
„Sollen wir da rein? Wir haben keine Fackel?“, fragte der eine Junge und hoffte anscheinend, dass der andere einlenkte und zurückging, doch dieser schob sich ohne einen Laut, vorsichtig auf Zehenspitzen, weiter durch den Gang.
Der zweite Junge musste sich jetzt notgedrungen anschließen, auch wenn die Angst schon viel zu tief in seinen Knochen steckte.
Am anderen Ende des Stollens war ein Licht zu sehen und vielleicht waren es ja Bergleute, die hier nach Schätzen gruben.
Der Stollen öffnete sich zu einer größeren Höhle und der vordere Junge blieb stehen. Noch im Stollen drehte er seinen Kopf zur Seite und blieb wie versteinert stehen. Jeder Blutstropfen war aus seinem Gesicht verschwunden, aber das konnte man in der Dunkelheit nicht sehen.
Der zweite Junge trat an seine Seite und erstarrte neben ihm.
„Der Teufel!“, flüsterte er erschrocken.
Eine mit Ruß beschmierte Gestalt stand an einem Feuer und hielt einen gewaltigen Hammer in der Hand. Mit einem Dröhnen hieb diese Gestalt auf etwas ein, dass die Funken nur so davon stoben.
Die Augen des Wesens glühten und mit einem Mal zischte es ganz laut.
Die beiden Jungs rannten aus dem Stollen zurück in den Wald und völlig außer Atem blieben sie nach ein paar hundert Schritten im Dickicht liegen.
„Was war denn das?“, fragte der eine.
„Das war der Teufel!“, entgegnete der andere.
„Davon dürfen wir niemanden etwas erzählen!“, bemerkte er weiter und drehte sich zur Höhle um, die aber jetzt schon nicht mehr zu sehen war.
Der andere Junge blickte an sich herab und sagte: „Ich habe mir in die Hose gemacht.“
So schnell sie konnten liefen sie zur Stadt zurück und sie erzählen niemandem von ihrer Begegnung, denn sonst würde sie sicher der Teufel holen.
Wolfram stand an seinem Amboss und wischte sich über die Stirn. War da nicht gerade eine Bewegung auf der anderen Seite der Höhle gewesen? Oder hatten die zuckenden Feuer ihn wieder einmal genarrt?
Er wusste es nicht.
Immer weiter bearbeitete er das Stück Eisen. Die Muskeln seiner Oberarme waren so stark, wie Baumstämme und jeder Schlag mit dem Hammer auf den Amboss hallte in der Höhle nach, aber er musste hier arbeiten.
Die Kraft dieses magischen Platzes sollte in seine Arbeit einfließen und hier hatte er auch noch den Werkstoff direkt hinter sich.
Seit mehr als einer Woche befand er sich hier in diesem Stollen und das ohne etwas zu essen.
Schon bald würde er den letzten Schlag setzen und ein neues unbezwingbares Schwert würde fertig sein.
Er sprach während der ganzen Arbeit mit dem Metall und es schien ihm zu antworten. Immer wieder hielt er die Zange mit dem glühenden Stück Eisen hoch und betrachtete es von allen Seiten.
Jeder Schlag seines Hammers musste sitzen.
Ein Fehler konnte die Arbeit einer ganzen Woche ruinieren und so arbeitete er konzentriert weiter.
Später würde er sicher ein paar Tage hier schlafen und dann wieder zurückkehren, um seine Arbeit abzuliefern.
Er war noch nie in dieser Gegend gewesen und eigentlich hatte der Platz ihn gefunden. Nur hier an dieser Stelle konnte er die Waffe schmieden. Keine zwei Schritte rechts oder links, sondern genau hier musste der Amboss stehen.
Wie im Traum war er hierher gelaufen und schließlich hatte er vor der Höhle gestanden.
Wieder einmal tauchte er das Schwert in das Wasser und sah den, durch das Schmiedefeuer, rötlich verfärbten Dampfschwaden nach.
Die Form hatte das Schwert fast erreicht, nur noch ein paar Schläge, dann war es vollbracht.
Schließlich fiel ihm das Schwert aus der Hand, landete im Wasserbad und er kippte rückwärts um.
Wie ein Stein schlug er auf den Höhlenboden auf und schloss seine Augen.
Das Feuer würde ausbrennen und wenn er wieder erwachen würde, dann wäre das Schwert fertig, nur schleifen und polieren musste er es noch, aber das würde er in seiner Werkstatt machen.
Glutrote Geister tanzten durch seinen Kopf und durch seinen Traum.
2. Kapitel
Zwei ungleiche Freunde
S iegbert saß vor der elterlichen Hütte und hörte die Schweine nebenan satt grunzen. Vor einigen Augenblicken erst hatte er sie gefüttert und jetzt saß er hier auf dem umgestülpten Futtereimer und dachte darüber nach.
Sollte das sein Leben sein? Schweinebauer wie sein Vater und dessen Vater zuvor? Einzig deshalb, weil er der älteste war? Er hatte noch drei Brüder, die aber alle jünger waren, als er selbst.
Vor wenigen Tagen hatte er seinen sechzehnten Sommer begonnen und er spürte tief in sich diesen Drang, von hier zu verschwinden. Bloß wie? Und wohin?
Auf dem Weg zwischen den Hütten ritten ein paar Männer vorbei und einer davon stoppte sein Pferd direkt vor ihm.
Er schaute auf und sah Karl auf dessen Rappen vor sich stehen. Karl war der Sohn des Ritters auf der Burg unmittelbar oberhalb des Dorfes und sie hatten sich schon vor Jahren angefreundet. Lange würde das aber sicher nicht mehr halten, denn in ein paar Jahren würden sie Herr und Knecht sein.
Im Moment waren sie beide zwei gleich alte Jungs und Freunde, aber wie lange noch? Wenn Siegbert hier blieb, so konnte er die Tage bis dahin schon zählen. Noch zwei Jahre, höchstens drei.
Karl sprang von seinem Pferd und versank mit seinen Stiefeln sofort eine gute Handbreit im Schlamm des Weges.
Siegbert erhob sich und trat auf den Freund zu. Schuhe hatte er nicht und der Schlamm war ihm völlig egal. Sie begrüßten sich mit einem Handschlag und gingen den Weg entlang. Das Pferd trottete ihnen hinterher, ohne dass Karl es führen musste.
Wie gebannt schaute Siegbert dabei auf das Schwert an der Seite seines Freundes, das dieser heute zum ersten Mal trug. Diese Waffe war sicher mehr als fünfmal so lang, wie sein eigenes Messer, und das war schon das längste Messer gewesen, was Siegbert finden konnte.
Gern würde er das Schwert einmal in die Hand nehmen, aber das war nichts für Bauernhände und wenn es einer der Männer von der Burg sehen würde, dass er eine Waffe in den Händen hielt, so würde es ihm, und sicher auch seinem Freund Karl, schlecht ergehen.
Aber ihn interessierte nicht so sehr die Waffe, sondern die Art und Weise, wie sie hergestellt wurde.
Immer dann, wenn der Schmied in ihrem Dorf bei seiner Tätigkeit war, konnte er nicht umhin, ihn dabei beobachten zu müssen. Die Arbeit des Schmiedes hatte ihn von klein auf angezogen. Wie der Mann mit ein paar Hammerschlägen eine krumme Sense wieder in Form brachte, war einfach nur sehenswert und fast wie Zauberei.
Wie war wohl erst die Arbeit an solch einem Schwert? Sicher noch viel faszinierender. Vielleicht sollte er eine Anstellung bei einem Schmied suchen? Nur wo?
Er begann zu überlegen und schließlich zeigte er auf das Schwert und fragte seinen Freund danach.
Karl blieb stehen und zog das Schwert heraus.
„Es ist ein Ulfberht. Eine besondere und kostbare Waffe“, begann Karl und dabei hielt er das Schwert über seinen Kopf, wodurch sich die Sonne darin spiegeln konnte.
Ein seltsam verdrehtes Muster war in die Klinge eingearbeitet und im Lichte der Sonne sah es aus, als ob die Waffe lebte und sich der Geist des Schwertes darin auf und ab bewegte.
„Es kostet mehr, als alle Dörfer meines Vaters in einem halben Jahr Abgaben zu uns bringen!“, gab Karl noch zu verstehen.
Jetzt erst konnte Siegbert den Wert des Schwertes richtig ermessen. Solch eine Waffe wollte er machen. Nur wo?
„Weißt du, wo sie gefertigt wurde?“, fragte er daher seinen Freund, doch der schüttelte nur den Kopf und steckte die Waffe wieder weg.
Damit hatte Siegbert einen Entschluss gefasst, doch plötzlich hörte er den Vater nach ihm rufen.
Schnell lief er zurück und kassierte für sein Trödeln eine Schelle.
Er hielt sich die schmerzende Wange und machte sich schleunigst wieder an die Arbeit, doch damit war sein Entschluss noch viel fester gefasst worden.
Während Siegbert im Stall bei den Kühen arbeitete, ging Karl, nun das Pferd am Zügel führend, den kleinen Hügel hinauf, wo der Turm über den Holzpfählen gut zu sehen war.
Das Bauwerk nannte sich Burg, aber eigentlich war es nur die von hölzernen Palisaden umgebene Hügelspitze oberhalb des Dorfes. Auch hier gab es nur Holzhütten, Scheunen und Ställe, denn es sollte ein Fluchtpunkt für die umliegenden Dörfer sein, wenn die Ungarn mal wieder nach Sachsen einfielen, wie sie es schon oft in den letzten Jahren gemacht hatten.
Hinter Karl wurde das Tor geschlossen, auch wenn es noch nicht dunkel war, aber man wollte den Schwachpunkt der Befestigung nicht unnötig zu lange ungeschützt lassen.
Neben dem Tor, auf der Plattform des hölzernen Turmes, stand sein Vater und stützte sich auf die Brüstung des nach innen offenen Bauwerkes.
Er sah zu Karl hinunter und wendete sich danach wieder der Umgebung zu.
Rupert konnte von diesem Platz aus alle zehn Dörfer sehen, die zu seinem Bereich gehörten und deren Bauern dafür sorgten, dass sie hier oben einigermaßen gut leben konnte. Zumindest besser als die Landbevölkerung, die ihm vollkommen gehörte.
Hier hatte er zwar eine Schutzaufgabe, gleichzeitig mussten die Bauern für ihn sorgen. Früher, als sein Großvater noch hier lebte, waren sie noch alle gleich gewesen, doch jetzt hatte er vom König dieses Lehen erhalten und damit auch das Leben der Menschen zu seinen Füßen.
Bei allem, was die Bauern machen wollten, mussten sie daher jetzt ihn fragen. Egal ob sie heiraten oder fortziehen wollten, Rupert hatte das Recht zu entscheiden und er ließ niemanden aus seinem Bereich heraus, denn jeder Bauer, jede Bäuerin vermehrte seine Macht.
Auch Recht sprechen lag nun in seinen Händen und jeden Sonntag, nach dem Gottesdienst kamen die Menschen zu ihm und er musste entscheiden. Das machte er meist nach Gefühl oder danach, wer ihm mehr Macht versprechen konnte. So manches Schlachttier wechselte gelegentlich den Besitzer, um den Richter in ihm milde oder wohlgesonnen zu stimmen und er fand das gar nicht mal so schlecht.
Mit jeder Ernte stieg sein Einfluss und sicher würde er bald vom König noch ein paar Dörfer erhalten, weil sein Nachbar beim Herrscher in Ungnade gefallen war.
Er musste nur noch dafür sorgen, dass der König sein Geschenk, eine kostbare Halskette, erhielt. Dieses Geschenk war bestimmt gut angelegt und würde sein Ansehen bei König Heinrich1 noch weiter stärken.
Rupert kletterte auf der Leiter den Turm hinab und ging über den Platz zu seiner Hütte hinüber. Schon bald würde er hier ein Haus aus Stein bauen können, aber zuvor war erst einmal die Vergrößerung seines Lehens wichtiger.
Er setzte sich an den Tisch und nach einem kurzen Dankgebet wurden die Speisen aufgetragen.
Rupert und Karl saßen zusammen mit den Knechten an der Tafel und ließen sich von den Frauen bedienen.
Während des Mahls teilte er als Herr die Arbeiten des nächsten Tages ein und erkundigte sich nach den erfüllten Aufgaben des Tages.
Sieglinde, Karls Mutter und damit Ruperts Frau, leitete aus der Küche heraus die Mägde an, an der Tafel war sie nur geduldet, wenn ihr Mann ihr Aufgaben erteilen wollte.
Wohlwollend ließ er seinen Blick über die kleine Schar schweifen. Seine Gefolgschaft!
In seiner Burg lebten dreißig Menschen, von denen er fünfzehn Männer zur Verteidigung hatte. Die anderen waren Frauen und Kinder.
Nach dem Essen blieben die Männer im Schein des Feuers zusammen und leerten so manchen Becher Bier, bevor sie schließlich berauscht in ihre Betten fielen.
1 Heinrich I. (* um 876 - 2. Juli 936), König des Ostfränkischen Reiches ab 918
3. Kapitel
Gesellenjahre
M itten in der Nacht hatte sich Siegbert davon geschlichen. Nur das Nötigste hatte er in einem kleinen Beutel verstaut. Am Waldrand hatte er sich noch ein letztes Mal umgedreht und auf das im Mondlicht still daliegende Dorf zurückgeschaut, bevor er seiner Kindheit für immer den Rücken kehrte.
Er ging durch den Wald abseits der Wege, denn wenn Karls Vater ihn erwischen würde, so war ihm der Schandpfahl sicher und er würde für immer in dem Dorf bleiben müssen.
Ritter Rupert ließ schon keine Alten von hier fort, was würde er erst machen, wenn ein junger, kräftiger Mann sich ohne seine Erlaubnis entfernt hatte.
Noch wusste er nicht, wohin er sich wenden sollte, aber erst einmal musste er weit weg.
Siegbert lief in Richtung der aufgehenden Sonne und versuchte den Tag über diese Richtung zu halten, auch wenn das im dichten Wald, weitab der Wege, nicht ganz so einfach war.
Am meisten hatte er davor Angst, im Kreis zu gehen und plötzlich wieder vor seinem Dorf zu stehen.
Am Abend kletterte er auf einen Baum, um dort oben sicher zu schlafen.
Zumindest hatte er das Gefühl dort oben geschützter zu sein und da es gerade Anfang des Sommers war, war es im Wald nicht so kalt und er fand überall Beeren und Wurzeln, die er essen konnte.
Tagelang blieb er auch weiterhin abseits der Wege, denn einerseits hatte er ja sowieso kein Geld, um irgendwo einzukehren und andererseits dachte er immer noch, dass Rupert hinter ihm her war, aber jetzt hielt er sich nur so weit entfernt im Wald, dass er die Wege und Straßen noch sehen konnte, so hatte er immer noch die richtige Richtung.
Das hoffte er zumindest.
Eines Abends sah er von seinem Platz auf dem Baum aus, wie ein Wagen auf einer Straße in der Nähe entlang fuhr und dann direkt unter seinem Baum stehen blieb. Die Männer saßen dann ab und schlugen ihr Nachtlager auf.
Von oben hörte er zu, wie sie sich unterhielten.
Sie redeten von einer Stadt, in die sie reisen wollten und die nicht weit entfernt im Osten liegen sollte. Dabei erzählten die Männer so laut, dass Siegbert jedes Wort verstehen konnte.
Das war es doch! Es war ein Zeichen für ihn.
Dorthin wollte er ziehen, denn in einer Stadt waren alle frei, so hatte er es gehört.
Genau wusste er es nicht, aber was hatte er schon zu verlieren?
Er klammerte sich an seinen Ast und versuchte dabei kein Geräusch zu machen.
Schließlich schliefen die Männer unter ihm am Feuer ein und er stieg geräuschlos den Stamm hinab.
Genauso leise schlich er ein paar hundert Schritte in den Wald, wo er sich versteckte und in die Dunkelheit lauschte, ob er gehört worden war.
Aber alles blieb ruhig.