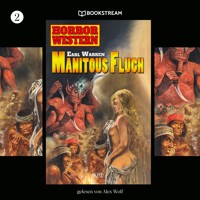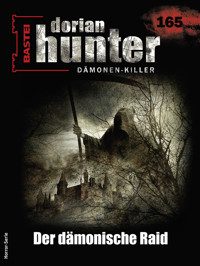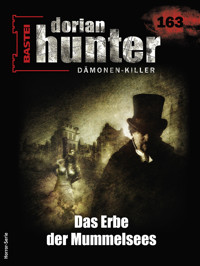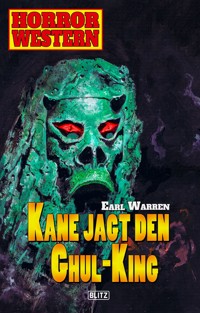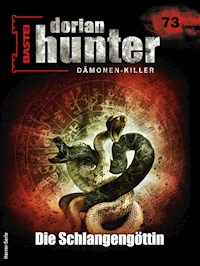
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Dorian Hunter - Horror-Serie
- Sprache: Deutsch
Ich, Michele da Mosto, war der Unglücklichste aller Sterblichen. Durch meine Schuld hatte sich meine Geliebte den Mächten des Bösen und der Finsternis ausgeliefert und war zu einer Dämonin geworden.
Ich sah übers Meer, hing trüben Gedanken nach - und erschrak, als jemand mir auf die Schulter schlug. Marino war es, mein Bruder, der Kapitän der Galeasse.
»Michele, alter Trübsalbläser, komm mit an den Bug! Vor uns liegt eine Insel. Wir werden sie anlaufen, um unsere Trinkwasservorräte zu ergänzen und ein paar Stücke Wild zu schießen.«
Ich folgte ihm. Weder Marino noch ich ahnten, welches Grauen uns auf der Insel erwartete ...
Dorian weiß jetzt, warum Hekate ihn so hasst. Er selbst hat sie damals als Michele da Mosto verraten und im Stich gelassen - und er erinnert sich auch daran, wie Hekate ihren Racheschwur bei ihrer nächsten Begegnung mit Michele erfüllt hat ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Was bisher geschah
DIE SCHLANGENKÖNIGIN
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
mystery-press
Vorschau
Impressum
Der ehemalige Reporter Dorian Hunter hat sein Leben dem Kampf gegen die Schwarze Familie der Dämonen gewidmet, seit seine Frau Lilian durch eine Begegnung mit ihnen den Verstand verlor. Seine Gegner leben als ehrbare Bürger über den gesamten Erdball verteilt. Nur vereinzelt gelingt es dem »Dämonenkiller«, ihnen die Maske herunterzureißen. Unterstützung in seinem Kampf erhält er zunächst durch den englischen Secret Service, der auf Hunters Wirken hin die Inquisitionsabteilung gründete.
Bald kommt Dorian seiner eigentlichen Bestimmung auf die Spur: In einem früheren Leben schloss er als Baron Nicolas de Conde einen Pakt mit dem Teufel, der ihm die Unsterblichkeit sicherte. Um für seine Sünden zu büßen, verfasste de Conde den »Hexenhammer« – jenes Buch, das im 16. Jahrhundert zur Grundlage für die Hexenverfolgung wurde. Doch der Inquisition fielen meist Unschuldige zum Opfer; die Dämonen blieben ungeschoren. Als de Conde selbst der Ketzerei angeklagt und verbrannt wurde, ging seine Seele in den nächsten Körper über. So ging es fort bis in die Gegenwart. Dorian Hunter begreift, dass es seine Aufgabe ist, de Condes Verfehlungen zu sühnen und die Dämonen zu vernichten.
In der Folge beginnt Dorian die Dämonen auf eigene Faust zu jagen. Als die Erfolge ausbleiben, gerät Trevor Sullivan, der Leiter der Inquisitionsabteilung, unter Druck. Die Abteilung wird aufgelöst, und Sullivan gründet im Keller der Jugendstilvilla die Agentur Mystery Press, die Nachrichten über dämonische Aktivitäten aus aller Welt sammelt. Hunter bleibt nur sein engstes Umfeld: die junge Hexe Coco Zamis, die selbst ein Mitglied der Schwarzen Familie war, bis sie wegen ihrer Liebe zu Dorian den Großteil ihrer magischen Fähigkeiten verlor; weiterhin der Hermaphrodit Phillip, dessen hellseherische Fähigkeiten ihn zu einem lebenden Orakel machen, sowie ein Ex-Mitarbeiter des Secret Service namens Donald Chapman, der bei einer dämonischen Attacke auf Zwergengröße geschrumpft wurde.
Trotz der Rückschläge gelingt es Dorian, Asmodi, das Oberhaupt der Schwarzen Familie, zu vernichten. Doch mit Olivaro steht schon ein Nachfolger bereit, der die schwangere Coco Zamis zur Rückkehr in die Schwarze Familie zwingt. Es gelingt Dorian, Coco zu retten. Nach einer Flucht um den halben Erdball bringt sie ihr Kind in London zur Welt, und Olivaro muss den Thron räumen.
Coco versteckt das Neugeborene an einem Ort, den sie selbst vor Dorian geheimhält. Ihre Vorsicht ist berechtigt, da bald eine neue, »alte« Gegnerin auftaucht, die Dorian in seinem Leben als Georg Rudolf Speyer abgöttisch geliebt hat: Hekate lockt den Dämonenkiller in ein Reich außerhalb der Realität, wo er ihren Aufstieg zum Oberhaupt der Schwarzen Familie erlebt. Hekates Wandlung bleibt Dorian rätselhaft – bis er sich erinnert, wie er sie durch ein furchtbares Missverständnis in seinem vierten Leben als Michele da Mosto dem Verderben preisgab. Hekate schwor Rache – und nun ist plötzlich der Puppenmann Don Chapman verschwunden ...
DIE SCHLANGENKÖNIGIN
von Earl Warren
Vergangenheit
Ich war der Unglücklichste aller Sterblichen. Nicht nur, dass ich mir eine Liebe verscherzt hatte, die sogar den Tod überdauerte; durch meine Schuld hatte sich meine Geliebte den Mächten des Bösen und der Finsternis ausgeliefert und war zu einer Dämonin geworden.
Ich sah übers Meer und hing trüben Gedanken nach. An jenem Augusttag des Jahres 1556 glaubte ich, nie wieder lachen zu können. War ich auch erst sechzehn Jahre alt, so hatte ich doch schon Liebe und Leid, Hass und Mord, Not und Tod im Übermaß erfahren. Und das nicht nur in einem Leben.
Die Sonne brannte heiß herab. Ihr grelles Licht wurde vom Meer reflektiert, das still und glatt dalag wie ein Siegel. Ich atmete den Geruch des Salzwassers, Teers und den Schweiß der zweihundert Galeassen-Sklaven ein, ohne ihn wirklich wahrzunehmen. Auch das Knarren der sechzig Ruder, das monotone Trommeln des Taktgebers und die Zurufe der Aufseher drangen nur schwach in mein Bewusstsein vor.
1. Kapitel
Da stand ich nun, Michele da Mosto, Sohn einer angesehenen und reichen Familie aus Venedig, und dachte an meinen Kummer und meine Verzweiflung.
Ich erschrak, als jemand mir auf die Schulter schlug. Marino war es, mein Bruder, der Kapitän der Galeasse.
»Michele, alter Trübsalbläser, komm mit an den Bug! Vor uns liegt eine Insel. Wir werden sie anlaufen, um unsere Trinkwasservorräte zu ergänzen und ein paar Stücke Wild zu schießen. Diese verdammte Flaute lässt uns einfach nicht vorankommen! Wir könnten längst in Kandia sein.«
Kandia, das war jene Insel, die auch Kreta genannt wurde. Seit dem vierten Kreuzzug stand sie unter venezianischer Herrschaft. Ich folgte Marino. Sein Gesicht war gebräunt; sogar die Narbe, die von seinem linken Auge bis zum Kinn reichte, passte zu ihm. Sie ließ ihn noch kühner und männlicher erscheinen. Während ich hinter ihm herlief, hasste ich meinen Bruder fast. Auch er hatte erfahren, dass es Schrecken gab, die noch schlimmer waren als der Tod; aber ihn vermochte das nicht zu erschüttern. Er schlief nachts ruhig und fest, so glaubte ich zumindest.
Unsere Galeasse war vierzig Meter lang und besaß drei Masten. Die Segel waren jetzt gerefft, denn es wehte kein Lüftchen. Es gab zwei Ruderdecks; je drei Rudersklaven bedienten eines der schweren Ruder. Die Luken der Ruderdecks waren geöffnet. Stickige Luft und Schweißdunst strömten daraus hervor. An der Luv- und Leeseite der Galeasse standen je fünfzehn Geschütze.
Marino blieb am Bug stehen, die Hand auf eine Kanone gestützt. Ich trat neben ihn und sah nun auch fern am Horizont die Insel. Sie war ein dunkler Streifen.
»Was für eine Insel ist das?«, fragte ich Marino.
Er hob die Schultern. »Irgendein namenloses Eiland. Auf der Karte ist es nicht eingezeichnet.« Marino winkte einen Maat herbei. »Die Rudersklaven sollen wissen, dass sie bald eine Verschnaufpause bekommen. Wir werden über Nacht vor der Insel ankern.«
Der braungebrannte Maat mit dem goldenen Ring im linken Ohr nickte und entfernte sich.
Marino und ich sahen der Insel entgegen. Das Eiland vor uns rückte näher. Schon konnte man die Umrisse erkennen, den Berg im Innern mit der üppigen, grünen Vegetation. Marino lief auf die Brücke zurück, um die Kommandos zu geben. Ich blieb am Bug stehen, mein Herz begann immer stärker zu pochen. Ich hatte plötzlich Angst und den Wunsch, dass wir diese Insel nicht anlaufen sollten. Sie erschien mir gefährlich. Aber ich schüttelte diese Ängste schnell ab und sagte mir, dass meine Nerven bei den überstandenen Aufregungen gelitten hatten; übermäßig gut war meine physische und psychische Konstitution ohnehin nie gewesen.
Die Gentile Bellini glitt in eine geschützte Bucht. Ich konnte den Geruch der Insel riechen. Es war ein ganz eigenartiger Duft nach Dschungel und Moschus. Marino gab Kommandos, und Matrosen ließen ein Beiboot aufs Wasser hinab. Ich drehte mich um und schaute zu meinem Bruder hinüber. Wie ein Scherenschnitt hob sich Marino mit seinem schwarzen Hemd, den dunklen Locken und dem breiten Kopf gegen den hellen Himmel ab. Ein paar Tierstimmen und Vogelrufe hallten von der Insel herüber.
Die Ruder waren jetzt eingezogen. Ich hörte das Aufseufzen der Galeassen-Sklaven, die sich über die Ruhepause freuten und sich auf den Ruderbänken bequem hinsetzten, soweit ihre Ketten es zuließen. Sechs Matrosen kletterten über die Jakobsleiter ins Beiboot hinab. Sie trugen Arkebusen und Armbrüste für die Jagd. Jeder hatte einen Säbel oder ein Entermesser an der Seite. Wasserfässer wurden mit Stricken hinabgelassen.
»Was ist, Michele?«, rief Marino mir zu. »Du machst Augen, als hättest du eine Meerjungfrau gesehen!«
Die rauen Matrosen lachten. Sie mochten Marino, der ihnen immer ein guter Kapitän gewesen war. Er war ein echter da Mosto, ein kühner Abenteurer und Seefahrer. Ich hätte meinen rechten Arm hergegeben, um so sein zu können wie er. Aber ich war nur Michele, der hustende, blasse Schwächling, das schwarze Schaf der Familie. Ich hatte einmal gehört, wie mein Vater Lorenzo bei einem Gelage im Scherz gesagt hatte, meine Mutter müsste fremdgegangen sein; einen Sohn wie mich habe er nicht zeugen können. Doch jetzt war nicht die Zeit, daran zu denken.
Ich stieg noch vor Marino in das Beiboot hinab. Mein Bruder sprang nach, und die Matrosen legten ab. Der Baske war unter den Matrosen. Er blinzelte mir zu. Er war einer der wenigen an Bord, die mich gut leiden mochten. Der Baske war ein Hüne, älter schon, mit angegrautem Haar und einem groben, wie aus Holz geschnitzten Gesicht. Er hieß Pablo, und unter seiner rauen Schale war er eine Seele von einem Menschen.
»Bringt uns einen saftigen Rehbraten mit, Kapitän!«, riefen uns ein paar auf dem Schiff zurückbleibende Matrosen nach.
Marino stieß die geballte Rechte in die Luft, zum Zeichen, dass er verstanden hatte. Bald knirschte der Kiel unseres Bootes über den Sandstrand. Marino sprang als Erster ans Ufer, die Arkebuse in der Hand.
»Los, Leute!«, rief er. »Wer zuerst einen Bach findet und das erste Stück Wild erlegt, bekommt eine Extraration Schnaps.«
Das ließen die Matrosen sich nicht zweimal sagen. Im Nu war das Boot auf den Strand gezogen, alles ausgeladen, und wir marschierten in den kühlen Schatten des Waldes. Pinien und Oleandersträucher wuchsen hier, auch Laubbäume. Das Unterholz war dicht verfilzt, und es gab Blüten in verwirrender Pracht und Fülle. Sie strömten Düfte aus, die den Sinn umnebelten. Der Baske blieb stehen.
»Das gefällt mir nicht«, sagte er. »Hier ist es zu schön und paradiesisch. Wenn sich nun hinter dieser Schönheit etwas verbirgt?«
»Was sollte sich hier wohl verbergen?«, fragte Marino. »Die Sirenen des Odysseus? Oder spanische Schergen, die den Preis kassieren wollen, der in deinem Heimatland auf deinen Kopf steht?«
Die anderen Matrosen lachten. Pablo brummte nur. Er hatte einen feinen Instinkt. Auch ich fühlte mich unbehaglich, aber ich versuchte, dieses Gefühl zu unterdrücken. Ich gab mich munter und ausgelassen wie mein Bruder und die fünf Matrosen. Sie waren froh, einmal festen Boden unter den Füßen zu haben, stießen Jauchzer aus und machten sich immer wieder auf besonders schöne oder intensiv duftende Blüten aufmerksam.
»Wir werden diese Insel die Blumeninsel nennen«, sagte Marino. »Das ist wirklich ein Paradies.«
»Kein Paradies ohne Schlange«, sagte Pablo. Er lauschte ständig angespannt, und er war es auch, der das Murmeln des Baches als Erster hörte. Er machte uns darauf aufmerksam. Wir folgten weiter dem Wildpfad, der durchs dichte Unterholz führte, durch Büsche und Rankengewächse. Schließlich gerieten wir auf eine Lichtung am Ufer eines Baches, der tief und klar war.
»Hier werde ich ein Bad nehmen!«, rief Marino.
Pablo hob eine Hand. »Horcht!«
Wir lauschten und vernahmen ein Rascheln im Unterholz und ein Zischen, das von allen Seiten zu kommen schien. Eng zusammengeschart warteten wir ab.
»So etwas habe ich noch nie gehört«, sagte Marino. »Was kann das nur sein?«
Die Matrosen hatten die Wasserfässer am Bachufer abgestellt.
»Das hört sich fast an wie ein ganzes Heer von Schlangen«, meinte einer der Matrosen, ein Schwarzbart mit pockennarbigem Gesicht.
Da quollen sie auch schon aus dem Unterholz hervor. Schuppige Leiber ringelten sich züngelnd aus dem Dickicht und umringten uns. Das mit prächtigen Blüten übersäte Unterholz spie plötzlich Hunderte, ja Tausende von Schlangen aus.
Wohin man sah, erblickte man Schlangen, große und kleine, alle möglichen Arten und Gattungen. Sie umringten uns, richteten sich züngelnd auf, griffen uns aber nicht an.
Marino hatte seit jeher eine Abscheu vor Schlangen gehabt. Er riss einem Matrosen die Arkebuse aus der Hand und entzündete die Lunte. Der Schuss krachte, Pulverdampf stieg auf, und das schwere Geschoss fuhr in die Schlangenschar. Im nächsten Moment hatte Marino den Degen gezogen.
»Tötet die Schlangenbrut!«, schrie er. »Los, bringt sie um!« Er war in diesem Augenblick nicht Herr seiner Sinne. Für ihn war es ein Albtraum, auf der idyllischen Lichtung von Schlangen umringt zu sein. Er schlug mit der blanken Klinge um sich und hatte im Nu eine Bresche in die schuppige Phalanx geschlagen.
Die Matrosen erwachten aus ihrer Erstarrung. Sie hieben mit Säbeln und Entermessern drein, zerstampften Schlangenleiber mit den Arkebusenkolben und unter den Sandalen. Auch ich schlug mit dem Degen zu.
Mein Bruder Marino war für mich eine Art Halbgott. Was er tat, musste richtig sein.
Marino und ich trugen als Einzige hohe Stiefel. Ich hörte einen Matrosen schreien, der von einer nur drei Finger langen Schlange in die Wade gebissen worden war. Schaum vor dem Mund, stürzte er zu Boden und wand sich in Krämpfen.
Ich köpfte eine Schlange, die so dick wie ein kräftiger Männerarm und fünf Meter lang war. Der kopflose Körper zuckte konvulsivisch und peitschte mit dem Schwanz. Überall zuckten und wanden sich geköpfte oder zerteilte und zerstampfte Schlangenkörper. Dann wich die eklige Brut ins Unterholz zurück. Dutzende sterbende und verwundete Schlangen blieben auf der Strecke; und alle bewegten sich noch.
Marino wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Der Brut haben wir es aber gegeben.« Seine Stimme bebte. »Wir füllen die Wasserfässer, dann folgen wir dem Bach zum Strand.«
Da sprach eine Frauenstimme zu uns. Sie klang schrill, und wir konnten nicht feststellen, woher sie kam. Wir hätten auch nicht genau sagen können, in welcher Sprache sie redete. Trotzdem verstand sie jeder.
»Ihr Elenden!«, rief die Frau. »Warum mordet ihr meine Kinder? Diese Insel habe ich ihnen gegeben.«
Wir sahen uns um, aber wir erblickten nur die Vögel, die von unserem Geschrei aufgeschreckt, über der Lichtung kreisten.
»Du dort mit dem schwarzen Hemd«, fuhr die Frauenstimme fort, »du bist der Anführer und schuld an dem Gemetzel unter meinen Lieblingen! Ich verfluche dich! Deine Strafe soll furchtbar sein. Eine Schlange, die schon keine Schlange mehr ist, soll dich nach langen Qualen töten.«
Marino schauderte. Er nahm die Arkebuse eines seiner Matrosen und spähte umher.
»Wer bist du?«, fragte er. »Komm heraus aus deinem Versteck, dass ich dich sehen kann, Schlangenkönigin!«
»Auch ihr anderen werdet euerem Schicksal nicht entgehen!«, rief die Frauenstimme weiter. »Auf sie, meine Kinder! Tötet sie, tötet!«
Es krachte im Unterholz. Ein riesiger Schlangenkopf schoss hervor, schuppig, in allen Farben des Regenbogens schillernd. Eine fast schenkeldicke, gespaltene Zunge züngelte, und lidlose Augen starrten uns an. Wir alle schrien auf. Die Schlange schob sich weiter vor, und jetzt sahen wir, welch gewaltige Ausmaße sie hatte. Sie konnte ein Pferd hinunterwürgen, wenn sie ihre Kiefer ausrenkte. Die giftigen Dolchzähne waren fast armlang.
»Verdammtes Biest!«, brüllte Marino. Seine Arkebuse krachte. Mein Bruder war ein todsicherer Schütze, aber entweder verfehlte er die Riesenschlange mit der regenbogenfarbenen Haut, oder die Kugel vermochte ihr nichts anzuhaben.
Der Schuss riss uns aus unserer Erstarrung. Schreiend liefen wir in verschiedenen Richtungen davon. Ich rannte mit dem Basken am Bachufer entlang. Überall tauchten zischende Schlangen auf. Wir mussten uns den Weg durch diese Höllenbrut freikämpfen. Selbst aus dem Wasser kamen Schlangen, und sie schnellten sich von den Ästen der Bäume.
Eine ringelte sich um meinen Hals und biss mir in die Wange. Außer mir vor Ekel riss ich sie weg und schleuderte sie fort. Zum Glück war sie nicht giftig gewesen. Wir hörten die Schreie der Matrosen, die andere Wege eingeschlagen hatten, und die meines Bruders. Wie ich mit dem Basken den Strand erreichte, weiß ich nicht. Wir keuchten. An den Strand folgten uns die Schlangen nicht. Die Riesenschlange war nicht mehr zu sehen. Ob sie einen von unseren Kameraden verschlungen hatte, wussten wir nicht.
»Ich glaube nicht, dass wir einen von ihnen lebend wiedersehen«, sagte Pablo, der Baske.
Mit vereinten Kräften schoben wir das Beiboot zum Wasser. Da kam ein Stöhnen vom Waldrand her. Marino, mein Bruder, taumelte aus dem Wald, ohne Degen, mit irrem Blick und zerzaustem Haar. Er fiel vor mir und Pablo auf die Knie und reckte flehend die Hände empor.
»Marino!«, schrie ich. »Was ist?«
»Erbarmen!«, stöhnte er. »Große Schlange, ich will nur noch dafür leben, meinen an deinen Kindern begangenen Frevel zu sühnen. Ich will dein Sklave sein, große Schlange!«
Auf der Galeasse hatte man die Schüsse gehört und bemerkt, dass etwas nicht in Ordnung war. Ein zweites Beiboot war unterwegs zum Strand. Pablo und ich hoben den wimmernden Marino auf und schleppten ihn ins Boot.
»Glaubst du, die Riesenschlange hat mit der Frauenstimme gesprochen?«, fragte ich Pablo.
Er hob nur die Schultern. Sein Blick suchte den Waldrand ab, aber keine Schlange, weder groß noch klein, tauchte auf. Von den Matrosen kam auch keiner mehr. Wir erklärten dem Zweiten Offizier, der das nun ankommende Beiboot steuerte, kurz, was vorgefallen war.
Nach etwa einer Viertelstunde ruderten wir zur Galeasse zurück. Marino stöhnte ein paarmal, aber als er sein Schiff betrat, fing er sich wieder. Er schaute zur Schlangeninsel hinüber, und ein Zittern durchlief seinen ganzen Körper. Sein Gesicht verzerrte sich, als hätte er unmenschliche Schmerzen.
»Wir legen ab«, sagte er. »Wir fahren ohne weiteren Aufenthalt direkt nach Kandia.«
»Kapitän«, sagte der Erste Offizier, »bei dieser Flaute ist das unmöglich. Es geht über die Kräfte der Ruderer. Das Trinkwasser und die Nahrungsmittelvorräte reichen nicht.«
»Das wird sich herausstellen. Keine Widerrede, Giacomo, sonst lasse ich dich in Ketten legen!«
Giacomo, der Erste Offizier, nahm Haltung an. »Wie du wünschst, Kapitän Marino da Mosto.«
Marino suchte seine Kajüte auf, und schon kurze Zeit später stand er wieder auf der Brücke. Sein Gesicht war aschfahl.