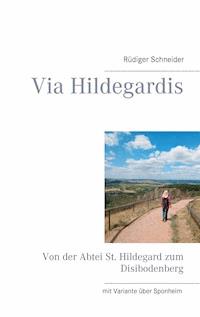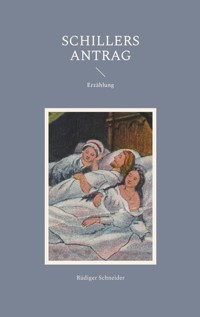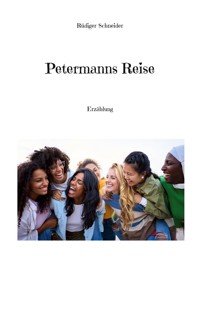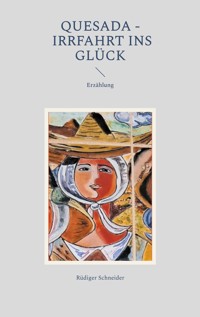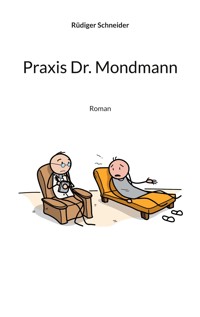Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In einem Bochumer Gymnasium wird die Sportlehrerin Doris Lenzen per Dynamit ins Jenseits befördert. Im Verdacht stehen Chemielehrer Winter, der von der Kollegin erpresst wurde, und sein begabtester Schüler, der mit ihr in dauerndem Streit stand. Winter ermittelt auf eigene Faust und gerät in Lebensgefahr. Ein Thriller im Schulmilieu. Mit satirischen Spitzen gegen das Bildungsunwesen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ähnlichkeiten mit Handlung und Personen sind rein zufällig!
Vorbemerkung
Eigentlich wollte ich keine Krimis mehr schreiben. Die 2016 erschienene Kriminalnovelle ‚Die neuen Räuber‘ hat eher mit Schiller zu tun und die jüngst als Hörspiel veröffentlichte ‚Maronenfalle‘ diente dem literarischen Spaß. Wenn mit ‚Dynamit‘ nun doch noch etwas im Krimi-Genre erscheint, so handelt es sich um ein Manuskript, das aus Trotz in die Schublade gewandert war. Ein Ruhrgebiets-Verlag hatte sich damals gewünscht, einen Krimi zu bekommen, der im Schul-Milieu spielt. Die Lektorinnen fanden das Manuskript wunderbar, wollten es als Buch auch veröffentlichen, baten mich jedoch, die im Roman vorkommende Sportlehrerin Lenzen glimpflicher davonkommen zu lassen. „Lassen Sie sie wenigstens auf der Intensivstation wieder genesen!“ Nein, funktionierte aus Sicht des Autors nicht. Im echten Leben hätte ich ihr das natürlich von Herzen gewünscht. Aber im Roman herrschen andere Gesetze. So fristete die Geschichte für fast ein Jahrzehnt ein unbemerktes Schattendasein. Bis ich sie beim Aufräumen der Festplatte wiederfand und dachte: „Warum sollen nicht auch andere ihren Spaß dran haben?“ So sei sie also mit Verspätung und ohne die damals gewünschte Veränderung in die Welt geschickt.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
1
Doris Lenzen war ein Biest. Sie hatte etwas herausgefunden, was niemand wissen durfte und erpresste mich damit. Ich hatte ein Dokument gefälscht, durfte eigentlich nicht dort arbeiten, wo ich jetzt schon seit zehn Jahren war: an einem ehrwürdigen Bochumer Gymnasium, das den Namen eines berühmten Naturwissenschaftlers trägt. Ich will den tatsächlichen Namen hier nicht angeben, nenne es jetzt einfach Werner-Heisenberg-Gymnasium, abgekürzt WHG. Am WHG unterrichtete ich Chemie und Physik.
Doris Lenzen stellte mich im Chemielabor der Schule zur Rede. Es war in einer großen Pause kurz vor den Weihnachtsferien. Sie kam unverblümt zur Sache.
„Herr Winter, Sie werden Ihre Bewerbung zum Oberstudienrat zurückziehen.“
Ich sah sie mit großen Augen an, drehte mir eine Zigarette trotz Rauchverbots.
„So, warum?“
„Köln 1989. Da sind Sie durch das Chemieexamen gefallen. Das Zeugnis haben Sie später gefälscht und sich damit für den Schuldienst beworben.“
Ich war verblüfft, hatte mir die Zigarette noch nicht angezündet, fragte spontan: „Woher wissen Sie das denn?“
Ich hätte auch entgegnen können: „Wie kommen Sie bloß auf diese Unterstellung?“ Aber Doris Lenzen war so selbstsicher und mit der Jahreszahl so präzise, dass es mir in diesem Moment einfach den Verstand verschlagen hatte. Außerdem, in der Sache hatte sie Recht. Es stimmte. Auch wenn man mir mildernde Umstände zubilligen mochte. Der Professor, ein langbärtiger Bayer, war mit dem Titel meiner Examensarbeit nicht einverstanden gewesen, verweigerte die Annahme. Es handelte sich nur um ein Wort. Ich bestand auf ‚Umweltvergiftung’. Er bevorzugte den Ausdruck ‚Umweltverschmutzung’. Es ging um Quecksilberverbindungen im Rhein. Ich blieb bei ‚Vergiftung’ und war damit durchgefallen. Später erfuhr ich, dass er als gut bezahlter Berater für einen Chemiekonzern am Rhein tätig war und solch ein Wort nicht dulden durfte.
„Woher wissen Sie das denn?“ fragte ich also Doris Lenzen.
Sie zog die Augenbrauen hoch, lächelte.
„Zufall. Ich habe auch in Köln studiert, ein paar Jahre nach Ihnen. Meine Examensarbeit habe ich in der Druckerei Fassmann binden lassen. Der Name sagt Ihnen was?“
Allerdings sagte er mir etwas. Herbert Fassmann war ein Freund von mir. Der Vater hatte eine Druckerei. Hier hatten wir die Sache mit dem gefälschten Zeugnis ausgeheckt und durchgeführt. Den Stempel haben wir durchgepaust und die Unterschrift des bayrischen Professors hineingesetzt.
Ich zündete mir die Zigarette an, nahm einen ersten Zug, nickte. „Ja, sagt mir etwas. Sie kennen also Herbert Fassmann?“
„Wir haben ein ganzes Jahr zusammengelebt.“
Ich schüttelte den Kopf. Nicht, weil ich etwas leugnen wollte. Ich wunderte mich über die Tücke des Schicksals. Sie hätte tausend Freunde in Köln haben können. Warum ausgerechnet den? Ich selbst hatte ihn aus den Augen verloren. Es war mir auch unangenehm gewesen, einen Mitwisser zu haben.
„Er hat Ihnen also davon erzählt?“
„Männer können keine Geheimnisse für sich behalten.“
„Sie haben die Geschichte nachgeprüft?“
„Selbstverständlich. Im Archiv der Universität gibt es keine Examensarbeit von Ihnen.“
Ich rauchte im Labor. Auf diese Übertretung, deren Zeugin sie war, kam es jetzt nicht mehr an.
„Und jetzt?“ fragte ich.
„Nichts. Sie können hier ruhig weiterarbeiten. Aber als Studienrat.“
Mehr sagte sie nicht. Sie ging.
Für mich waren die Ferien gelaufen. Ich zerbrach mir den Kopf. Was jetzt? Mit dieser Belastung weiter unterrichten? Auf einem Pulverfass sitzen? Von der Gnade der Kollegin Lenzen abhängig sein? Den Job kündigen? Umsatteln? Aber was macht man mit 52 Jahren?
Nach dem Studium hatte ich mich nicht direkt für den Schuldienst beworben, erst einmal ein paar Jahre verstreichen lassen, war Binnenschiffer zwischen Rotterdam und Basel gewesen, genau gesagt Hilfsmatrose. Mein Schifferdienstbuch hatte ich noch mit all den Einträgen. Da war nichts gefälscht. Jeder Stempel stimmte. Sollte ich wieder für einen Hungerlohn zurück auf den Rhein?
Ich schlief schlecht in den Weihnachtsferien. Trost bei einer Frau fand ich auch nicht. Irmgard war vor einer Woche ausgezogen. Ich hatte es nicht fertiggebracht, auf die Dauer einige Unarten abzustellen. Wenn immer möglich, ging ich angezogen ins Bett, zog nur die Schuhe aus. Die Kaffeemaschine stand auf der Nachtkonsole, war auf halb acht programmiert, diente mit ihrem Gurgeln und Rauschen zugleich als Wecker. Mit einer Tasse Kaffee und einer Zigarette begann ich den jungen Tag in der Horizontalen. Danach reichte die Zeit gerade noch, um die Schuhe anzuziehen, nach der Schultasche zu greifen und in die Schule zu eilen.
Irmgard träumte dagegen von einer Beziehungskultur mit ausgiebigem Frühstück und einer angeregten Unterhaltung. Sicher, am Anfang kam das manchmal vor. Aber dann hatte ich bald mehr Spaß an der Bildzeitung, vor allem sonntags, wenn die Fußballberichte drinstanden. Wir zankten und wir liebten uns, bis sie es nicht mehr aushielt.
„Max“, sagte sie eines Morgens zu mir, „einen Arsch wie dich finde ich an jeder Ecke. Deine Kulturlosigkeit muss ich mir nicht mehr antun. Wenn man mit dir wenigstens anständig über unsere Beziehung reden könnte! Aber auch da verhältst du dich wie ein Neandertaler, der schweigend am Feuer sitzt.“
Recht hatte sie. Beziehungsdiskussionen waren mir verhasst. Vor allem, wenn sie sich in die Länge zogen wie eine Wagner-Oper.
Ich half ihr beim Umzug. Irmgard war selbstständig, hatte in Essen eine eigene Werbeagentur, richtete sich zunächst einmal in einem ihrer Büroräume ein. Sie würde ihn sowieso kaum verlassen können. Es war das Kulturhauptstadtjahr 2010. Irmgard war in die Organisation der Events eingebunden. A40, größte Partymeile der Welt, das fliegende Rathaus, Folkwang Atoll, Land for free, Medienkunst Gasometer, Twins. Eine Vorübung für solche Ereignisse hatte sie schon erfolgreich abgeschlossen. ‘Paradoxien des Öffentlichen’. Liegestühle am Autobahnkreuz Duisburg-Kaiserberg. Die Anwohner durften mit weißer Farbe ihren Lieblingsort auf das Tuch schreiben.
„Was würdest du denn draufschreiben?“ hatte sie mich gefragt.
„Irmgard“, hatte ich geantwortet.
Viel nahm sie nicht mit aus unserer Wohnung. Ein paar Koffer und Kartons mit ihren besten Kleidungsstücken, ein paar Bücher, CDs. Ich überließ ihr großzügig den Fernseher und die Stereoanlage. Mit nur zwei Fahrten, wir machten sie gemeinsam in ihrem schwarzen Peugeot, war alles nach Essen geschafft.
„Den Rest hol ich später“, meinte sie. Aber dieser Rest war so groß, dass ich überall in der Wohnung auf ihre Spuren stieß. Auch der Duft ihres Parfüms, Chanel No 5, schwebte noch lange durch die Räume. Da war es also dahingegangen, mein schlankes, hoch gewachsenes, rothaariges Glück. Klar würde sie an jeder Ecke einen Arsch wie mich finden können. Irmgard war attraktiv, vier Jahre jünger als ich. Ihr stand die ganze Skala männlicher Bewerber offen. Vom vitalen Zwanziger bis hin zum vertrottelten Sechziger.
Beruflich war ich engagierter als bei der Pflege unserer Beziehung. Ich betreute die Chemiesammlung, bastelte in den großen Ferien den Stundenplan, hatte, um nicht nur Chemie zu unterrichten, ein Physikexamen an der Bochumer Uni hinzugelegt, dieses Mal eins mit echtem Zeugnis. Ich bereitete stets sorgfältig den Unterricht vor, machte ihn mit Experimenten spannend, wo immer es ging. Es kam mir auf die Freude an, auf das Staunen über die verblüffenden Verwandlungen in der Welt der Stoffe. Ich projizierte Experimente auf die Leinwand, koppelte ihren Verlauf mit Musik. Zum Beispiel bei der ‚tanzenden Elektrolyse’, wenn an den Elektroden die Gase sprudelten und sich in der Flüssigkeit rote Schleier bildeten. Ich scheute mich auch nicht davor, Goethes chemische Experimente auszugraben, mit Tee, Rotwein, geheimnisvollen Kristallen und lichtmalenden Substanzen. Was die Richtlinien betraf, stand ich mit einem Bein im Abseits. Zeitdruck und vorgeschriebene Paukerei verhinderten Spaß und Muße. Der Schraubstock einer Dressur von oben zog sich immer enger, ließ Orwells Welt und die von Huxley näher rücken. Mit dem Dezernenten, einem Dr. Karlemann, der für die Genehmigung der Abituraufgabe im Fach Chemie zuständig war, stand ich auf Kriegsfuß. Ich hatte Goethes chemische Experimente als Thema ausgesucht, den Erwartungshorizont begründet mit tieferen Einsichten in das Wesen der Natur und bekam es verweigert. Mit gewichtigen Schritten kam vor den Weihnachtsferien in einer der großen Pausen die Direktorin ins Lehrerzimmer, wo ich mich gerade und ausnahmsweise aufhielt, steuerte auf mich zu, reichte mir einen braunen Umschlag und sagte mit tadelndem Blick:
„Abgelehnt. Da sind die Weihnachtsferien wohl hinüber. Sie müssen eine neue Aufgabe formulieren. Der Erwartungshorizont ist auch zu mager. ‚Goethe ist tot‘, hat Dr. Karlemann gesagt.“
Da die Karnevalssaison schon begonnen hatte, lief ich in ein Kaufhaus, kaufte eine Narrenkappe, erwarb im Internet auch eine Karte für eine Sitzung im Kölner Gürzenich und schickte beides dem Dezernenten. Mit der Bemerkung: „Sie haben recht. Goethe ist tot. Aber die Narren leben noch.“
Ob er sich gefreut hat, weiß ich nicht. Es kam keine Reaktion. Das ist jetzt zwei Jahre her. Aber was hätte Karlemann auch machen können? Ich hatte mich dankbar gezeigt für den Hinweis, dass Goethe tot war, und mit der Einladung in den Gürzenich sollte er sehen, dass ich nicht der einzige Narr auf der Welt war.
Meine Chancen, zum Oberstudienrat befördert zu werden, standen allerdings gut, sehr gut sogar, auch wenn insgeheim noch die Formel vom ‚Stock und Rock’ galt. Das heißt: Frauen und Behinderte wurden bevorzugt. Diese Formel war infam. Sie degradierte alle. Doris Lenzen hatte sich auch beworben. Sie spürte oder sie wusste sogar, dass ich ein ernsthafter Konkurrent war. Ich selbst wusste das auch. Denn ausgerechnet mit dem Dezernenten, der für die Beförderungen zuständig war, verstand ich mich gut. Als die Stelle zum Oberstudienrat ausgeschrieben wurde, hatte er die Schule besucht, eine Tasse Kaffee mit mir getrunken und gemeint:
„Herr Winter, Sie bewerben sich doch bitte. Im Vertrauen gesagt: Ich kann diese matriarchalische Entscheidungskultur nicht mehr mit ansehen. Wir haben bald ja nur noch Frauen in den Schulen herumlaufen. Unsere Jungs, ich meine die Schüler, wissen nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Sie sind wenigstens noch ein Kerl. Sie rauchen, verachten nicht ein gutes Tröpfchen, spielen Fußball und machen zudem noch guten Unterricht. Also, ich erwarte, dass Ihr Name dabei ist.“
Das war ein Freifahrtschein. Zwar ist es mir im Prinzip egal, ob ich Studienrat oder Oberstudienrat bin, wobei Oberstudienrat fast so wie Oberkellner klingt, aber es gab mehr Geld. Das konnte ich bei meiner chronischen finanziellen Knappheit gut gebrauchen. Ich bewarb mich also um die Beförderung, auch wenn mir die damit verbundenen Unterrichtsbesuche lästig sein würden.
2
Mein Verhältnis zu Doris Lenzen war stets kühl und distanziert gewesen. Sie war eine schlanke, drahtige Blondine Mitte der Dreißiger, hatte die Fächer Deutsch und Sport, agierte in jedem Gremium, mischte sich überall ein, so dass es selbst ihre weiblichen Kolleginnen schon nervte. Keine Konferenz, ohne dass sich Lenzen zwanzigmal zu Wort gemeldet hätte. Wenn alle nach einem langen Nachmittag den Feierabend herbeiwünschten, kam sie garantiert mit ein paar weiteren Vorschlägen zum Tagesordnungspunkt ‚Verschiedenes’.
Die geschätzte Kollegin Lenzen rechnete sich zu den besseren Bochumer Kreisen. Sie war verheiratet mit einem Rechtsanwalt, der eine gut gehende Kanzlei betrieb und sehr vermögend war. So konnte sie sich in Sprockhövel ein eigenes Pferd leisten, spielte Golf und Tennis. Auch das Kulturelle kam nicht zu kurz. Wie so manche Gattin eines reichen Mannes malte sie und hatte ihre eigene kleine Galerie. Da gab es jedes Jahr eine Vernissage. Natürlich waren es Lenzens eigene Bilder. Das ganze Kollegium erhielt eine Einladung. Die meisten kamen auch. Ich nur einmal, dann nie wieder. Ich konnte mit ihrer abstrakten Acrylpinselei nichts anfangen.
In einer Hinsicht aber muss ich der Kollegin ein Kompliment machen. Sie kleidete sich sehr geschmackvoll und elegant, trug Kostüme von Hilfiger und Chanel, hätte sich damit auch in der Chefetage der Deutschen Bank bewegen können.
Bei den Schülern war sie als zickig verschrien, manche hatten auch Angst vor ihr, weil sie gnadenlos sägte, wo es etwas zu sägen gab. Meist traf es im Fach Deutsch die Jungs, die ihrer Meinung nach phantasielos und faul waren. „Wer sich nur für Fußball und Autos interessiert“, sagte sie einmal zu mir, „kann mit ‚Wilhelm Tell’ nichts anfangen.“
Für Autos aber interessierte sie sich auch. Jedenfalls sah es so aus. Sie fuhr ein Käfer-Cabrio, edel herausgeputzt und mit Chrom versehen. Es war ein älteres, generalüberholtes Modell, bei dem sich allerdings der Deckel des Benzintanks nicht abschließen ließ. Ein Schüler, mit dem sie auf Kriegsfuß stand, hatte ihr einmal Zucker in den Tank geschüttet. Das hatte der Motor übelgenommen. Nach dem Vorfall hatte sie mir ein paar giftige Blicke zugeworfen, aber nichts gesagt. Gedacht hat sie bestimmt: „Den Tipp mit dem Zucker kann er doch nur von seinem Chemielehrer haben.“
Und jetzt hatte mich ausgerechnet Doris Lenzen in der Hand. In den Weihnachtsferien kam ich zu dem Ergebnis, meine Bewerbung zurückzuziehen. Es ging nicht anders. Ich musste erst einmal Zeit gewinnen. Sollte meinetwegen die Matriarchalisierung der Schule voranschreiten. Ich brauchte den Job und das Geld, das damit verbunden war. Als alternder Binnenschiffer war ich unbrauchbar.
Zum ersten Mal in meinem Leben studierte ich das Strafgesetzbuch und fand den Paragraphen 267. „Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte Urkunde herstellt, eine echte Urkunde verfälscht oder eine unechte oder verfälschte Urkunde gebraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren.“
Freiheitsstrafe oder Geldstrafe? Auf jeden Fall trübe Aussichten.
Am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien zog ich meine Bewerbung zurück. Es war Mittwoch, der 6. Januar 2010.
3
Am Tag danach hatte ich in der zweiten Stunde die Jahrgangsstufe Neun in Chemie. Ich zeigte im Hörsaal einen Film über Astatin. Das ist ein höllisches Element, gehört zur Gruppe der Halogene. Wir haben es nicht in der Schule, dürfen es nicht haben. Schon bei der Berührung mit Luft entzündet es sich. Daher also der Film. Der ist ungefährlich. Ich selbst hatte ihn schon ein paar Mal gesehen, zog mich ins Labor zurück, drehte mir eine Zigarette, trank eine Tasse Kaffee. Etwa zwanzig Minuten war ich allein, bis kurz vor Ende der Stunde. Ich schaltete Beamer und Laptop aus, entließ die Schüler, als es zur großen Pause klingelte. Ich ging wieder ins Labor, wo ich die Pausen meistens verbrachte. Im Lehrerzimmer war es mir zu laut, zu hektisch. Außerdem hatten sie das Raucherzimmer abgeschafft. Es war ungemütlich. Ein Geschnatter und Stimmengewirr lag dort in dem großen Raum, das Telefon klingelte andauernd, die Direktorin wuselte herum, wobei in den Gesprächen mit ihr nicht immer etwas Gutes herauskam. Zudem wollte ich an diesem Tag den triumphierenden Blick der Kollegin Lenzen vermeiden. Sie wusste bestimmt schon, dass ich klein beigegeben hatte.
Die Pause war erst ein paar Minuten alt, da durchschlug eine heftige Detonation die Luft. Die Scheiben klirrten, zitterten. Das Schulgebäude schien für einen Moment zu wanken. Danach herrschte eine seltsame Stille. Ich drehte mir eine weitere Zigarette, trank Kaffee, überlegte, ob ich nach oben ins Lehrerzimmer gehen sollte. Vielleicht wusste man da mehr über diese Detonation, die in unmittelbarer Nähe der Schule gewesen sein musste. Zunächst aber rauchte ich die Zigarette, trank den Kaffee. Gerade als ich mich anschickte, das Labor zu verlassen, ertönte im Lautsprecher, mit dem jeder Raum der Schule ausgestattet ist, die Durchsage: „Die Orchesterprobe wird vorverlegt.“ Das war das verabredete Zeichen für einen Amoklauf. Kaum war die letzte Silbe verklungen, da näherten sich auch schon Martinshörner. Durch die Fenster des Labors konnte ich nur in einen kleinen Innenhof blicken, den man in einen japanischen Garten verwandelt hatte. Er war menschenleer. Niemand durfte sich dort aufhalten. Nur am letzten Schultag wurden dort Tische und Bänke aufgestellt. Dann feierten die Lehrer den Abschluss des Schuljahres.
Ich blieb im Labor. Rund um die Schule würde jetzt die Hölle los sein, und was drinnen im Gebäude passierte, davon hatte ich natürlich keine Ahnung. Möglich, dass ein Verrückter oder eine Verrückte mit Handgranaten durch die Gänge lief. Die Labortür brauchte ich nicht abzuschließen. Die ließ sich von außen nur mit einem Spezialschlüssel öffnen. Die nächste Chemiestunde hätte ich in einer Zehn. Von denen würde niemand erscheinen. Der Unterricht war für diesen Tag gelaufen. Ich versuchte im Sekretariat anzurufen, aber das war nicht möglich. Der Apparat war besetzt. Erst nach einer Stunde gelang es mir durchzukommen. Die Sekretärin war am Telefon. Ich meldete mich mit Namen, gab an, im Chemielabor zu sein, fragte:
„Was ist los?“
„Ach, Herr Winter“, antwortete sie. „Die Umkleidekabine in der Turnhalle ist in die Luft geflogen. Frau Lenzen ist tot.“
Ich schwieg einen Moment, glaubte, ich hätte mich verhört. „Frau Lenzen?“ fragte ich zurück.
„Ja.“
„Und? Wie ist das passiert?“
„Das wissen wir noch nicht. Zwei Kommissare sind hier, befragen Ihre Kollegen. Sie kommen am besten auch nach oben.“
4
Vier Stunden vergingen, dann war ich mit der Befragung an der Reihe. Von den vierzig Kollegen und Kolleginnen hatten sich einige dem kommissarischen Interview entzogen, waren entweder im ersten Schock nach Hause geeilt oder hatten schlicht nicht damit gerechnet, dass eine umgehende Befragung durch die Polizei notwendig war. Die beiden Kommissare saßen im Elternsprechzimmer, gingen alphabetisch vor. Ich war der Letzte. Sie sahen nur kurz auf, als ich den Raum betrat. „Bitte nehmen Sie Platz“, murmelte der eine. „Mein Name ist Lessenich. Neben mir, das ist mein Kollege Bärdorf.“
Ich hatte ein mulmiges Gefühl. Erstens wegen meines Faches Chemie. Zweitens wegen der Erpressung von Doris Lenzen. Ich konnte nur hoffen, dass niemand davon wusste. Es war mir sonnenklar, dass ich ein überzeugendes Motiv hatte, die Kollegin zum Schweigen zu bringen. Wer von den beiden ist der Gefährlichere, überlegte ich kurz. Lessenich wirkte ruhig, abwartend, reserviert. Er war groß, schlank, mochte knapp fünfzig sein. Sein Kollege war jünger, kleiner, rundlicher, schien auf den ersten Blick eher ein jovialer gemütlicher Typ zu sein. Das aber mochte täuschen. Auf jeden Fall hatte er eine Tasse Kaffee vor sich stehen, kaute an einem Butterbrot, hatte einen Gesichtsausdruck, der zu besagen schien: „Ist alles halb so schlimm. So was haben wir täglich.“
„Herr Winter“, begann Lessenich. „Sie unterrichten Chemie und Physik?“
Ich nickte. Der Kommissar hatte eine Liste vor sich liegen. Da waren alle Kollegen und Kolleginnen mit ihren Fächern aufgeführt. Bevor er weiter fragen konnte, wollte ich natürlich wissen, was überhaupt passiert war.
„Das wissen wir auch noch nicht genau“, antwortete Lessenich. „Nach den ersten Erkenntnissen der Spurensicherung scheint auf Ihre Kollegin Lenzen ein Attentat verübt worden zu sein.“
„Mit Sprengstoff?“
„Ja. Nach dem ersten Eindruck der Spurensicherung aller Wahrscheinlichkeit nach Dynamit. Oder etwas Ähnliches. Auf jeden Fall etwas mit Stickstoff. Die nitrose Belastung der Luft war ziemlich hoch. Werde ich Ihnen als Chemiker ja nicht erklären müssen. Ihre Kollegin hatte keine Chance. Herr Winter, wie gut kannten Sie Frau Lenzen?“
„Nur beruflich“, antwortete ich. „Das Übliche. Wir sahen uns nur in der Schule. Von den Fächern her haben wir nichts miteinander zu tun.“
„Sie war als Kollegin beliebt?“
„Weiß ich nicht. Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht.“
„Hatte Frau Lenzen Feinde?“ fragte er sehr direkt. „Im Kollegium, bei Schülern?“
„Ist mir nicht bekannt.“
Bärdorf kaute nicht mehr an seinem Butterbrot. Er hatte ein Notizbuch vor sich liegen, schrieb etwas auf. Er grinste mich plötzlich an, fragte: „Herr Winter, wo waren Sie in der zweiten Schulstunde? Sie hatten Unterricht oder eine Freistunde?“
„Unterricht. In der Neun. Chemie.“
Bärdorf schrieb. Lessenich nickte, sah auf die Liste. „Das war’s fürs erste, Herr Winter. Wie ich sehe, sind Sie der letzte im Alphabet. Sie brauchen uns also niemanden mehr zu schicken.“
5
Für mich war der Tag gelaufen. Schwarze Wolken zogen am Horizont herauf. Es war nur eine Frage der Zeit, dann wussten die beiden Kommissare, dass ich den Hörsaal während des Unterrichts verlassen hatte. Das Labor hatte zwei Türen. Eine zum Hörsaal hin, die andere auf den Schulflur. Ich hatte kein Alibi, keinen Zeugen, dass ich mich nur im Labor aufgehalten hatte. Zur Turnhalle waren es zweihundert Meter. Ich hätte jede Zeit der Welt gehabt, mich dorthin zu begeben und der Kollegin Lenzen Dynamit in die Umkleidekabine zu legen. Eine Fernzündung über Funk wäre für mich als Physiker kein Problem gewesen. Der Stundenplan von Doris Lenzen war bekannt. Ich konnte wissen, dass sie in der zweiten Stunde Sport hatte. Kurz vor Ende der zweiten Stunde würde sie den Unterricht beenden, die Schüler zum Umkleiden schicken, selbst in ihre Kabine gehen. Um halb zehn klingelte es zur großen Pause. Wenn man um halb zehn das Dynamit zündete, wäre der Anschlag mit größter Wahrscheinlichkeit erfolgreich gewesen. Ich musste damit rechnen, dass aus der ersten harmlosen Befragung ein unerbittliches Verhör werden würde. Die Kommissare würden mich auch fragen, warum ich meine Bewerbung zurückgezogen hatte. Solch ein Schritt war ungewöhnlich. Hier nähmen sie garantiert Witterung auf. Ungewiss war auch, ob Doris Lenzen das Geheimnis für sich behalten hatte. Der Gedanke war naheliegend, dass sie sich sagte: „Vorsicht! Der Winter hat jetzt einen guten Grund dich auszuschalten. Weihe lieber jemanden ein oder hinterlege eine Nachricht. Für den Fall des Falles.“
So mochte es sein. Absurd war der Gedanke nicht. Dann saß ich in der Falle, hatte es nicht mehr nur mit dem Paragraphen 267 wegen Urkundenfälschung zu tun, sondern mit Mord. Ich hatte noch nicht einmal die Aussicht, wieder Binnenschiffer beziehungsweise Hilfsmatrose zu werden, sondern würde den Rest meines Lebens hinter Gittern verbringen. Mein Motiv war überzeugend, meine Qualifikation für den Anschlag auch. Dynamit herzustellen, ist nicht schwer. Man braucht nur konzentrierte Schwefel- und Salpetersäure, weiter Glyzerin. Nitroglyzerin entsteht, man absorbiert es mit Kieselgur. Fertig ist das Dynamit. Jeder Schüler, der ein bisschen aufgepasst hat und mit dem Internet vertraut ist, kann sich den Stoff zu Hause zusammenbasteln.
Es ging mir schlecht. Ich verfluchte die leichtsinnige Tat von 1989, die ich immer, weil ich mich im Recht fühlte, für eine Bagatelle gehalten hatte. Ich hätte ja nur den Ausdruck ‚Umweltverschmutzung’ statt ‚Umweltvergiftung’ einsetzen müssen. Aber ich war störrisch gewesen, hatte meine Prinzipien. Bis zum Examen hatte ich die Zwischenprüfung und alle Scheine mit einer guten Note gemacht. Am Bestehen des Examens hätte es gar keinen Zweifel gegeben. Jetzt aber hatte sich die angebliche Bagatelle zu einer Katastrophe ausgeweitet.