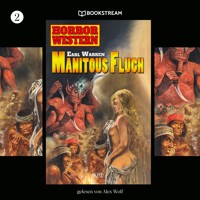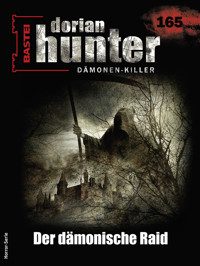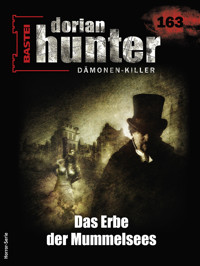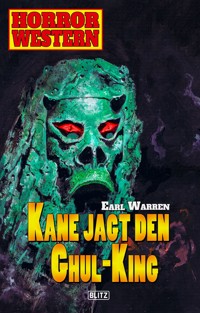1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gespenster-Krimi
- Sprache: Deutsch
Das lebende Porträt
von Earl Warren
Massimo Bunavo betrachtete das Gemälde, das sein letztes sein sollte. Die Augen des hageren, ausgezehrten Mannes mit den roten Fieberflecken auf den Wangen funkelten irr und dämonisch. Ein abstoßendes Lächeln zuckte über sein Gesicht mit dem grauen Knebelbart.
"Dieses Bild übereigne ich der Adelsfamilie De Simone", rief er. "Es soll mein Vermächtnis sein, mein Fluch, der aus dem Jenseits auf diese Elenden niederfährt. Furchtbar sollen die De Simones die Schuld büßen, die sie auf sich geladen haben."
Das Bildnis war schlechthin vollendet, ein makabres Kunstwerk, wie vielleicht noch nie eines auf der Erde geschaffen worden war. Eine Atmosphäre des Grauens, der sich niemand entziehen konnte, ging von dem Bild aus ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Das lebende Porträt
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati/BLITZ-Verlag
Datenkonvertierung eBook: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-8507-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Das lebende Porträt
von Earl Warren
Massimo Bunavo betrachtete das Gemälde, das sein letztes sein sollte. Die Augen des hageren, ausgezehrten Mannes mit den roten Fieberflecken auf den Wangen funkelten irr und dämonisch. Ein abstoßendes Lächeln zuckte über sein Gesicht mit dem grauen Knebelbart.
»Dieses Bild übereigne ich der Adelsfamilie De Simone«, rief er. »Es soll mein Vermächtnis sein, mein Fluch, der aus dem Jenseits auf diese Elenden niederfährt. Furchtbar sollen die De Simones die Schuld büßen, die sie auf sich geladen haben.«
Bunavo atmete schwer. Von draußen brandete der Lärm der Hauptverkehrsstraße am Tiberufer in sein düsteres, schäbiges Kelleratelier. Durch die staubigen Kellerfenster konnte man die Beine der Passanten sehen, die draußen vorbeischritten. Der Maler beachtete sie nicht.
Er konnte zufrieden sein, so fand er. Das Bildnis war schlechthin vollendet, ein makabres Kunstwerk, wie vielleicht noch nie eines auf der Erde geschaffen worden war. Eine Atmosphäre des Grauens, der sich niemand entziehen konnte, ging von dem Bild aus …
Es zeigte ein Schlachtfeld einen oder zwei Tage nach dem großen Morden. Es war hügeliges, mit Büschen bewachsenes Gelände. Die Sonne stand schon tief, sie war blutrot und sandte einen düsteren Schimmer auf die grausige Szene. Tote lagen in allen möglichen Stellungen auf der Erde, grauenhaft verrenkt und bleich.
Manche waren verstümmelt, andere hatten furchtbare Wunden. Die Leichname waren in rote und blaue Uniformen gekleidet und mit Säbeln und altertümlichen Musketen bewaffnet. Sie waren unzweifelhaft tot, aber man spürte, dass dennoch ein grausiges, schreckliches Leben in ihnen sein musste.
Es schien, als warteten sie nur auf den Einbruch der Dunkelheit, um zu einem grauenhaften Dasein zu erwachen. Die Art, wie Massimo Bunavo das dargestellt hatte, war mehr als meisterhaft. Sie hatte schon etwas Okkultes, Übermenschliches.
In den Schatten auf dem Bild verbargen sich düstere Gestalten, mehr zu erahnen als zu erkennen. Was auf den ersten Blick ein abgestorbener Baum zu sein schien, wurde bei längerem Hinsehen zur dunklen Albtraumgestalt. Die Konturen waren nicht klar zu erkennen und machten die Darstellung noch schrecklicher.
Teufel und Horrorwesen spukten in den Schatten, warteten auf die Nacht.
Oben im Sonnenlicht tanzten ätherische Wesen, ebenfalls nicht scharf umrissen. Es waren beileibe keine herkömmlichen Engel, sondern Lichtgestalten und –figuren. Sie gehörten auch nicht unbedingt zu den himmlischen, guten Mächten.
Sie hatten vielmehr etwas Zwiespältiges.
Vielleicht waren es die Seelen der Toten auf dem Schlachtfeld, die von der Fäulnis der Körper und dem Horror, dem sie verfallen waren, angesteckt wurden.
In der Bildmitte sah man eine Reitergruppe mit einer blauen Fahne. Der vorderste Reiter war ein Mann mit einem roten Purpurmantel, ein Schwert in der Hand. Die Reiter spürten, ahnten etwas, man sah es ihnen an. Ein unterschwelliges Grauen war ihnen ins Gesicht geschrieben.
Zwischen den Hufen des Pferdes, in dessen Sattel der Reiter mit dem Purpurmantel saß, lag ein Leichnam. Er war im Erwachen begriffen. Gerade fasste er mit der grünlich bleichen Rechten nach einem Pferdehuf.
Massimo Bunavo nickte befriedigt. Er hatte ein satanisches Kunstwerk geschaffen, dem selbst ein Goya oder ein van Gogh ihre Referenz erwiesen hätten. Nur auf den ersten Blick konnte selbst ein Laie das Ölgemälde für einen nichts sagenden, dilettantischen Schinken halten.
Beim zweiten schon spürte man, dass da etwas eingefangen war, etwas Unheimliches und Übernatürliches.
Bunavo legte den Pinsel auf die Palette bei der Staffelei. Er hatte seinen letzten Pinselstrich getan, nicht nur an diesem Bild. Der schmächtige, grauhaarige Mann mit dem farbbeklecksten Malerkittel setzte sich auf einen Schemel nieder.
Er nahm die Chiantiflasche, entkorkte sie und trank einen Schluck. Er sah sich um, und es war, als sähe er seine Umgebung seit Monaten zum ersten Mal. Staubige Spinnweben hingen in den Ecken. Auf dem Tisch bei dem zerwühlten, schmutzigen Bett standen Teller und Schüsseln mit Essensresten.
Bei dem Bett lagen aufgeschlagene Bücher über Magie und Okkultismus. Weitere standen auf dem Regal an der Wand. Ein paar Bilder, die Bunavo zu früheren, glücklichen Zeiten gemalt hatte, waren zur Wand hin gedreht.
Im Keller war es düster und kalt. Die Rippenheizung rauschte und knarrte.
Bunavo trank einen weiteren Schluck Chianti. Dann erhob er sich langsam und mühsam, so als laste ein schweres Gewicht auf seinen Schultern. Er schlurfte zur Wand, und hier nahm er einen Strick, der an einem Haken hing.
Er rückte den Hocker zurecht, kletterte darauf und befestigte den Strick mit der Schlinge an einem Wasserrohr. Nun legte er sich die Schlinge um den Hals und zog sie zusammen, bis die rauen Fasern des Strickes sacht seine Haut berührten.
Der Maler blickte auf das Bild. Es war ihm, als sähe der Reiter mit dem Purpurmantel ihn erwartungsvoll an. Massimo Bunavo dachte daran, was er alles hatte tun müssen, um sein letztes Gemälde fertigzustellen. Die Riten und Beschwörungen gingen ihm durch den Kopf, die er vollführt hatte. Er erinnerte sich an die Nächte, in denen er über düsteren Kapiteln in furchtbaren, verrufenen Büchern gebrütet hatte.
Jetzt galt es, das Letzte, das Entscheidende, zu tun.
Er wusste, dass er auf dem richtigen Weg war, er war sich seiner Sache sicher. Wie sonst hätte ihm ein solches Gemälde gelingen können, ihm, der immer mehr schlecht als recht von seiner Malerei gelebt hatte? Er sei ein besserer Postkartenmaler, hatten andere Maler, Kunstkenner und Kritiker immer gesagt.
Dieses Bild hätten sie sehen sollen, dann wäre ihnen der Spott im Halse stecken geblieben.
Bunavo überlegte noch einmal, ob er an alles gedacht, ob er alles richtig gemacht hatte. Sein Testament lag in der Tischschublade oben auf den anderen Papieren und war leicht zu finden.
Bunavo holte tief Luft.
Dann stieß er entschlossen den Schemel um.
✞
Carlo Trenzi reichte es jetzt endgültig. Ein Vierteljahr war Massimo Bunavo nun schon mit der Miete im Rückstand. Das konnte er nicht länger dulden, schließlich hatte er nichts zu verschenken.
Schnaufend stieg der dicke Hausbesitzer die Treppe zu Bunavos Kelleratelier hinunter. Missbilligend schnupperte er die feuchte, modrige Luft, als sei Bunavo dafür verantwortlich.
»Ein Maler«, knurrte er verächtlich, als er am Fuß der Treppe für einen Augenblick verschnaufte. »Keine Lira in der Tasche, aber Flausen im Kopf. Künstler! Alles Taugenichtse und Hungerleider, die einem ehrlichen Mann wie mir sein Geld vorenthalten. Ins Arbeitslager sollte man sie alle stecken.«
Er klopfte hart an die Tür.
Niemand antwortete, nichts regte sich.
Trenzi klopfte wieder.
»Ich weiß, dass Sie da sind, Bunavo. Es hat keinen Zweck, sich zu verstecken. Ich werde nicht weggehen, bevor ich ein ernstes Wörtchen mit Ihnen geredet habe, Signore.«
Als noch immer kein Laut zu hören war, drückte Trenzi die Türklinke nieder. Es war abgeschlossen. Der Hausbesitzer holte einen Schlüsselbund aus der Tasche. So leicht kam ihm dieser Massimo Bunavo nicht davon.
Trenzi schloss auf und trat ein. Es war halbdunkel in dem niederen Kelleratelier. Nicht einmal die trübe Funzel brannte.
Im Halbdunkel sah Carlo Trenzi die Gestalt von der Decke baumeln. Er erschrak, aber er fasste sich gleich, trat ein und schloss die Tür hinter sich. Carlo Trenzi, ein sechzigjähriger Mann, hatte ein Herz so hart wie Stein. Er war habgierig, geizig und abgebrüht wie kaum ein zweiter.
Das musste man sein, wenn man abbruchreife, verlotterte Altbaukästen zu horrenden Preisen vermietete. Trenzi war bei seinen Mietern verhasst, denn er presste sie aus und übervorteilte sie, wo er nur konnte. Er wusste, dass niemand ihn mochte, und es störte ihn nicht sonderlich.
Er wollte sehen, ob er in Bunavos Wohnatelier noch irgendwelche Wertsachen auftreiben konnte, um sich für die ausstehende Miete schadlos zu halten. Er beachtete den Erhängten nicht weiter.
»Das hast du nun von deiner Malerei«, sagte er nur, als er an ihm vorbeiging.
Zunächst streifte Trenzi auch das Bild nur mit einem flüchtigen Blick. Er durchsuchte Bunavos Wohnatelier gründlich, wobei er seine rechte Hand mit einem Taschentuch umwickelte, um keine Fingerspuren zu hinterlassen. Er fand aber nichts, dessen Wert über ein paar Lire hinausging.
Bunavos billige Armbanduhr, die auf dem Sockel des Kellerfensters lag, streifte er nur mit einem verächtlichen Blick.
Als Trenzi die Schublade des Tisches öffnete, auf dem Farbtuben herumlagen sowie zwei Okkultbücher und ein Block mit Notizen, sah er Massimo Bunavos Testament. Er nahm es und entfaltete es mit seiner vom Taschentuch geschützten Hand.
Das Testament war kurz. Bunavo hinterließ nichts als Schulden, ein paar persönliche Dinge, etwas Krimskrams und anderthalb Dutzend Bilder. Bis auf das letzte hatte er alle Bilder bereits mehrmals vergeblich zu verkaufen versucht.
Trenzi stutzte, als er sah, dass der Maler sein letztes Werk der reichen und angesehenen Familie De Simone vermacht hatte. Wie kam Massimo Bunavo zur Bekanntschaft der De Simones, dieser millionenschweren, alteingesessenen vornehmen Familie?
Trenzi sagte sich, dass Künstler in allen Kreisen verkehrten und oftmals die merkwürdigsten Bekanntschaften schlossen.
Wenn aber Bunavo den De Simones sein letztes Bild vermacht hatte, aus welchem Grund auch immer, dann musste es einen Wert darstellen. Leuten wie den De Simones hängte man keinen wertlosen Plunder an.
Trenzis Entschluss war sofort gefasst. Die De Simones hatten mehr Geld als er, denen würde das Bild nicht fehlen. Der Hausbesitzer trat vor Bunavos letztes Werk hin.
Er betrachtete die Schlachtfelddarstellung. Ein Schauer überlief den abgebrühten, hartherzigen Mann. Eine seltsame, nie gekannte Angst keimte in ihm auf, und sein Herz, das ohnehin nicht das beste war, hämmerte wie rasend. Er schnaufte.
Zu grässlich war das, was er da sah. Im Halbdunkel schien das Bild ein furchtbares, dämonisches Leben zu haben, schienen die dargestellten Gestalten, selbst die Toten, sich zu regen und zu bewegen. Massimo Bunavo hatte etwas Grauenhaftes gemalt.
Trenzi, obwohl kein Kunstkenner, erkannte, dass an diesem Bild etwas Besonderes war. Es war außergewöhnlich, nicht jedermanns Geschmack, aber es gab sicher Leute oder sogar Museen, die eine Menge Geld für so etwas zahlten.
Trenzi zwang sich, den Blick von dem Bild abzuwenden. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn.
»Ich werde alt«, seufzte er. »Früher hätte ein gemaltes Bild mich nicht so erschüttern können. Was ist schon daran? Leinwand und ein wenig Farbkleckserei.«
Trenzi fuhr mit dem Finger sacht über die Leinwand und merkte, dass die Farbe trocken war. Er löste die Leinwand von der Holzfaserplatte an der Atelierstaffelei und rollte sie vorsichtig zusammen. Er streifte einen Gummi über die Rolle, damit sie zusammenhielt.
Nun nahm er ein Bild, das mit der Leinwand zur Wand stand, und löste es aus dem Keilrahmen. Es war ein kitschiges Stillleben mit Früchten und Blumen. Das Stillleben spannte er auf die Staffelei. Es sollte aussehen, als hätte Bunavo zuletzt daran gemalt.
Sollten die De Simones mit dem Stilschinken glücklich werden. Trenzi verließ jetzt das Kelleratelier, ohne sich weiter aufzuhalten. Er hatte Massimo Bunavo nicht untersucht, der erste Blick in das verzerrte, entstellte und verfärbte Gesicht hatte ihm schon genug gesagt.
Der dicke Mann eilte die Treppe hinauf. Zuerst verließ er durch den Hinterausgang das Haus und ging zu seinem Wagen, der im Hof geparkt war. Er legte die Leinwand auf den Rücksitz. Dann kehrte er in den schmalbrüstigen Altbau zurück und stieg in den zweiten Stock hoch zu dem einzigen Mieter im Haus, der ein Telefon hatte.
Von hier aus rief er die nächste Polizeistation an und teilte den Carabinieri mit, dass sein Mieter Massimo Bunavo sich erhängt hatte.
✞
Mark Saxon wusste, dass er sich gratulieren konnte, mit Paola De Simone verlobt zu sein. Sie war groß für eine Italienerin, dunkelhaarig, dunkeläugig und bildschön.
An diesem Abend bei der Opernfreiluftaufführung in den Caracalla-Thermen ruhten wieder viele Blicke bewundernd auf Paola und neidvoll auf Mark.
Während der Pause vertraten sie sich die Beine. Paola plauderte mit ein paar Bekannten. Einige junge Männer waren darunter, die zu gern bei ihr gelandet wären. Schließlich war sie eine der besten Partien von Rom.
Doch deshalb hatte Mark kein Verhältnis mit ihr begonnen. Er liebte Paola, und sie liebte ihn. Das war die schlichte Wahrheit. Mark Saxon war Auslandskorrespondent und arbeitete für verschiedene US-amerikanische Zeitungen und Magazine, gelegentlich auch für Fernsehgesellschaften. Er war zwar kein Millionär, verdiente und lebte aber sehr gut.
Mark war groß und dunkelhaarig. Er hatte ein scharf geschnittenes, kühn und abenteuerlustig wirkendes Gesicht. Auf der High School hatten ihn die anderen Korsar genannt, da er so aussah, wie sie sich einen Piraten vorstellten.
Die Pause ging zu Ende, und Mark und Paola kehrten auf ihre Tribünenplätze zurück. Die Zuschauerränge stiegen rund um die große Spielfläche an; es gab zwei Tribünen. Flutlicht beleuchtete die Szene. Die Caracalla-Thermen, im Jahre 217 nach Christus von Kaiser Caracalla eröffnet, gaben den im Sommer stattfindenden Opern- und Theateraufführungen einen grandiosen Rahmen.
Hier gesehen zu werden, war eine gesellschaftliche Pflicht.
Mark interessierte sich nicht besonders für die italienische Barockoper, die an diesem Abend aufgeführt wurde. Er verstand einiges vom Aufbau einer Story, und die Opernhandlung erschien ihm recht dilettantisch.
Da starben haufenweise Leute durch Gift, Dolchstoß, Bolzenschuss aus dem Hinterhalt oder beim Duell. Keiner versäumte, im Sterben noch rasch eine Arie zu singen.
Nachdem endlich auch den im Bass singenden Erzbösewicht des Stückes sein verdientes Schicksal ereilt hatte, war die Oper zu Ende. Mark und Paola warteten eine Zigarettenlänge auf ihren Plätzen, um nicht ins wüsteste Gedränge an den Ausgängen zu geraten.
»Wollen wir bei Ranieri noch einen Happen essen?«, fragte Mark.
Ranieri war ein Luxusrestaurant, das besonders durch seinen Hummer glänzte.
Paola schüttelte den Kopf. »Nein, Mark, ich will nach Hause. Ich habe ohnehin schon ein schlechtes Gewissen, dass wir hier sitzen, während es Vater so schlecht geht.«
»Es scheint, dass die Krise vorbei ist«, sagte Mark. »Wenn wir im Palazzo sitzen und Trübsal blasen, ist ihm auch nicht geholfen. Die Ärzte meinen, dass er es überstanden hat.«
Paola winkte mit ihrer kleinen, hübschen Hand ab. Ebenso wie ihr Vater hielt sie nicht sehr viel von den Ärzten und ihrer Kunst. Mark respektierte ihren Wunsch, und er versuchte nicht, sie zu überreden.
Als das Gedränge sich etwas verlaufen hatte, gingen sie durch die imposanten Ruinen der alten Thermengebäude zum Parkplatz. Mark legte mit seinem Maserati einen Kavaliersstart hin, dass die Reifen quietschten. Sie fuhren am Postministerium, am Forum Romanum und am Kolosseum vorbei quer durch die Stadt zum Prominentenviertel Pinciano, wo beim Park Villa Borghese der Palazzo der De Simones stand.
An diesem Sommerabend herrschte in den Straßen der Zweieinhalb-Millionen-Stadt noch ein reger Verkehr. Aber Mark hatte sich in den drei Jahren, die er jetzt in Rom war, bestens an den italienischen Fahrstil gewöhnt. Er fuhr rasant und schaffte die Strecke in einer guten Zeit.
Die Auffahrt zum Palazzo war beleuchtet. Um diese Zeit stand das schmiedeeiserne Haupteingangstor noch offen. Mark fuhr durch den parkähnlichen Garten, der den Palazzo umgab. Die De Simones hatte nicht nur einen alten, vornehmen Namen, sie waren auch reich.
Ihre Interessen reichten von Reedereien bis zu Beteiligungen an Autofabriken und im Immobiliengeschäft. Als Mark vor dem Haus stoppte, sahen er und Paola einen alten, grauen Citroen, der recht schäbig wirkte. Sie stiegen aus, und aus dem Citroen zwängte sich ein fetter, schwitzender Mann.
»Marchesa, Marchese«, rief er kurzatmig, »bitte, warten Sie.«
Mark blieb stehen, auch Paola wartete. Das Mädchen trug ein tiefausgeschnittenes Abendkleid, Mark hingegen kleidete sich etwas salopper mit weißem Anzug und offenem Hemd.
»Was gibt es, Signore?«
»Ich … ich habe etwas für Sie. Mein Name ist Carlo Trenzi, ihr ergebener Diener.« Der dicke Mann nickte Mark und Paola zu, er grinste. »Ich bin hergekommen, um das Gemälde abzugeben, das Bildnis des Massimo Bunavo. Er hat es Ihnen testamentarisch hinterlassen. Ich … eh, ich hatte es unter meine Obhut genommen. Aber nun halte ich es für meine Pflicht, es Ihnen sofort herzubringen.«
Paola sah Mark fragend an.
»Ich habe nie etwas von einem Massimo Bunavo gehört«, sagte sie.
Mark war der Dicke vom ersten Augenblick an unsympathisch. Er hatte Schweinsäuglein und Hamsterbacken, auf dem Kopf war er fast kahl. Mark hielt ihn für einen groben und raffgierigen Klotz.
Er täuschte sich nicht in seinem Urteil.
»Erzählen Sie mal der Reihe nach«, forderte er. »Was haben Sie mit Massimo Bunavo zu tun, und um was für ein Bild handelt es sich?«
Der Dicke ging zum Wagen und nahm ein gerahmtes Gemälde vom Rücksitz. Er brachte es heran, aber er hielt es so, dass Mark und Paola vorerst nur die Rückseite sehen konnten. Er erzählte nun, dass er Bunavos Hauswirt sei, und dass er ihn am Nachmittag erhängt aufgefunden habe.
Selbstmord, so hatte die Polizei zweifelsfrei in sehr kurzer Zeit festgestellt. Trenzi sagte, dass ihm Bunavos Testament rein zufällig in die Hände gefallen sei.
»So weit, so gut«, meinte Mark. »Aber wie kommt jetzt dieses Bild zu Ihnen, das Bunavo doch den De Simones vermacht hat?«
Trenzi wand sich wie ein Wurm am Angelhaken.
»Bunavo war mit der Miete im Rückstand. Zu erwarten ist aus seinem Nachlass nichts. Da habe ich … da dachte ich …«
»Da haben Sie das Bild einfach an sich genommen, um es zu verkaufen und zu Geld zu machen. Was für die De Simones gut genug ist, muss schließlich etwas wert sein. So war es doch, Signor Trenzi, oder?«, fragte Mark scharf.
»Urteilen Sie doch nicht gleich so hart. Ich bin ein armer Mann, der sehen muss, wo er bleibt. Ich habe ein anderes Bild auf die Staffelei gestellt, damit die Familie De Simone nicht leer ausgehen muss.«
»Und weshalb haben Sie Ihre Meinung so plötzlich geändert und bringen das Bild um halb zwölf Uhr nachts an?«
»Das … das möchte ich nicht sagen.«