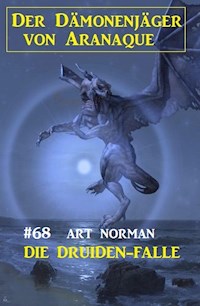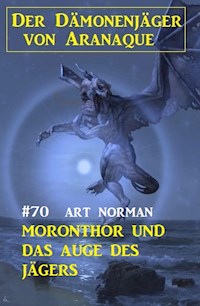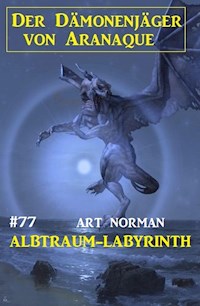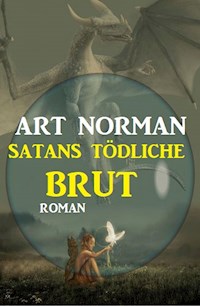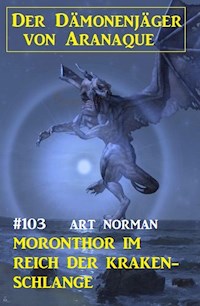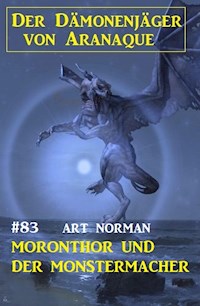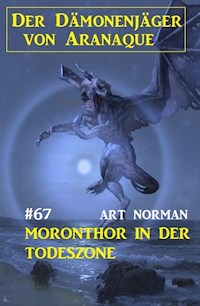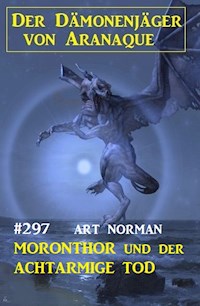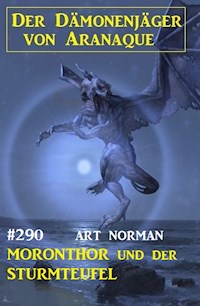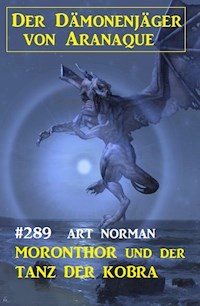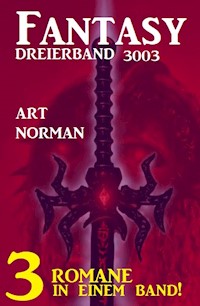Seine Augen wurden schmal. Aschfahl sein Gesicht, und er riß
die Arme hoch, streckte die Hände abwehrend aus und wollte
zurückweichen, aber er stand schon mit dem Rücken zur Wand.
»Nein«, keuchte er. »Sag, daß das nicht wahr ist. Sag, daß ich
mich täusche, daß ich nur träume…«
Aber Nadija Perkowa grinste nur. Innerhalb weniger Augenblicke
war ihre blühende Gestalt zu einem wahren Zerrbild geworden. Sie
wirkte wie eine Zweihundertjährige, eingefallen, faltig und grau,
und ihr rotes Haar war nicht mehr seidenweich und glänzend, sondern
stumpf und strähnig. Drei, vier schwarze Zahnstummel höhnten dort,
wo gerade noch ein makelloses Gebiß gelächelt hatte.
»Du träumst nicht, Stana Ilonkin«, kicherte sie. »Ich bin eine
Hexe, ja… und du bist am Ende deines Weges… und deine Seele bekommt
er …«
»Nein!« schrie der junge Petersburger. »Nein, niemals… dich
soll der Teufel holen, verdammte Hexe!« Er griff nach dem Dolch in
der silberbeschlagenen Scheide, riß ihn hoch. Nadija Perkowa, die
ihm vorgegaukelt hatte, ein hübsches junges Mädchen zu sein, lachte
schrill.
»Damit kannst du mich nicht verletzen… und nun bekomme ich
dich… deine Seele wird zur Hölle fahren, damit ich deinen Körper
übernehmen kann…«
»Du, eine Frau?« keuchte er.
»Was spielt es für eine Rolle? Vielleicht werde ich dreißig,
vierzig Jahre ein Mann sein, dann wieder eine Frau… oder ein
Tier…«
Er umklammerte den Elfenbeingriff des Dolches, starrte die
Hexe an.
Es fiel ihm immer noch schwer zu glauben, was er gesehen
hatte. Diese unglaubliche Verwandlung… Sie bewegte die knochigen,
dürren Spinnenfinger.
Ihre rissigen, dünnen Lippen begannen Zauberworte zu
murmeln.
Stana sah, wie sich die Flammen der Kerzen ihm entgegenneigten
und wie Schatten über die Wände krochen, auf ihn zu. Licht und
Dunkelheit konzentrierten sich auf ihn, ohne sich gegenseitig
auszulöschen. Er fühlte, wie sich eine eigenartige Lähmung über ihn
legte. Eine Lähmung, die den Geist betraf. Sein Denken verlangsamte
sich…
Etwas Kaltes kam aus dem Nichts, und als es ihn berührte,
begann seine Seele zu brennen…
»Nein«, keuchte er entsetzt. »Nein… nicht meine Seele…«
Er zwang sich, den Dolch zu benutzen. Er nahm alle Kraft
zusammen, derer er fähig war. Die Klinge blitzte, zog einen raschen
Schnitt über seinen Unterarm, als er sich mit ersterbender
geistiger Kraft an das erinnerte, was einen Zauberer oder eine Hexe
zu töten vermochte. Und dann wirbelte er den Dolch, an dem sein
eigenes Blut haftete, durch die Luft, genau in die Brust der
uralten Hexe, die keine Gelegenheit mehr bekam, Erschrecken zu
zeigen.
Wie vom Blitz gefällt, brach sie zusammen.
Der Zauber erlosch. Der Bann wich von Stana Ilonkin. Der junge
Petersburger wirbelte herum, stürmte aus dem Raum des Grauens und
verließ das Haus. Draußen stand sein Pferd, der Sattel lag im
Schuppen.
Stana nahm sich nicht die Zeit, den Sattel aufzulegen. Er
sprang auf den blanken Pferderücken und jagte davon, über den Zaun
hinweg, nur fort von hier.
Er sah nicht den Schatten, der aus den Nachtwolken herabfuhr
und durch den Kaminschlot in das kleine Haus fuhr. Er sah nicht die
Schwärze, die sich über alles legte mit einer bedrückenden Aura,
die jedes Tier verstummen und sich verkriechen ließ. Denn das Böse
selbst war gekommen…
Erst als der Tag anbrach, kehrte Stana Ilonkin zurück. Er war
müde, aber das Licht der Morgensonne gab ihm Kraft. Er ging in den
Schuppen, holte den Sattel heraus und legte ihn dem Pferd auf, dann
bekreuzigte er sich, nahm allen Mut zusammen und drang wieder in
das Haus ein.
Es wirkte kalt, abweisend, tot. Stana fand das Zimmer, in dem
aus dem hübschen jungen Mädchen die uralte, verdorrte Hexe geworden
war, die ihn bedrohte und seine Seele dem Teufel schenken
wollte.
Aber da lag nur noch der Dolch mit dem Elfenbeingriff, und ein
wenig verkrustetes Blut daran. Stanas Blut, dessen Unterarmwunde
nur noch schmerzte, wenn er die Muskeln spannte. Hexenblut befand
sich keines am Dolch. Er nahm die Waffe wieder an sich. Sie lag in
einem kleinen Staubhäufchen. Das war alles, was noch an die Hexe
Nadija Perkowa erinnerte. Die Kerzen waren niedergebrannt.
Dennoch, obwohl Nadija tot war, glaubte Stana, von irgendwoher
beobachtet zu werden. Der Hauch des Bösen schwebte immer noch im
Haus. Aber da war niemand, der Stana beobachten konnte. Da war nur
sein eigenes Abbild in dem großen, goldumrandeten Spiegel.
Stana Ilonkin floh aus dem Haus und kehrte nimmermehr
zurück.
***
Nadija Perkowa war noch nicht tot gewesen, als Stana in der
Nacht das Haus verließ. Der Dolch hatte ihren
Unverwundbarkeits-Zauber zwar durchbrochen, sie aber nicht tödlich
getroffen. Mit ihrer Hexenkunst hätte sie sich noch zu retten
vermocht. Sie hätte die Wunde schließen können.
Aber immerhin war sie schwer angeschlagen, und sie konnte
Stana Ilonkin nicht halten. Er entzog sich ihrem lähmenden Bann und
entwich.
Nadija Perkowa war zornig und verzweifelt. Sie brauchte einen
neuen Körper! Der alte hielt nicht mehr lange vor, jetzt, nach der
Dolchverletzung, erst recht nicht. Er verfiel von Woche zu Woche
mehr. Sie mußte einen neuen Körper übernehmen, um weiterleben zu
können, mußte die andere Seele verdrängen und selbst
hineinschlüpfen in die fleischliche Hülle.
Aber sie konnte nicht jeden beliebigen Körper nehmen. Er mußte
eine ganz bestimmte Aura aufweisen, die ihr Einfahren erleichterte,
und er mußte magisch neutral sein. Beides zusammen kam unter
hunderttausend Menschen bei einem einzigen vor. Nadija hatte lange
gesucht, bis sie auf Stana Ilonkin gestoßen war.
Er war der geeignete Körper.
So hatte sie eine Beziehung zu ihm aufgebaut. Mit Hexenkunst
gaukelte sie ihm Jugend und Schönheit vor, und er hatte sich
täuschen lassen.
Sie hatte alles vorbereitet, seine Seele ihrem Herrn, dem
Teufel versprochen, und dieser hatte eingewilligt. Er war an
Ilonkins Seele interessiert, und er würde sie bekommen, sobald
Nadija sie aus seinem Körper verdrängte.
Aber es war mißlungen. Im letzten Moment hatte Stana sich
gewehrt.
Sie hatte, um die Seelentauschbeschwörung durchführen zu
können, ihre Maske fallen lassen müssen. Sie hatte alle Kraft für
die Beschwörung gebraucht. Und sie hatte nicht ahnen können, daß
er, der magisch neutral war, dennoch genug über die Abwehr gegen
Hexen und Zauberer wußte. Mit dem blutigen Dolch hatte er sie
getroffen und ihren Zauber zerstört.
Es war vorbei.
Sie würde schwerlich Ersatz für Stana Ilonkin bekommen.
Wahrscheinlich würde sie also sterben müssen. Oder sie mußte ein
Tier finden, das ihren Bedürfnissen entsprach, und als Tier dann
wieder auf Menschenjagd gehen, um einen neuen menschlichen Körper
zu gewinnen, gleichgültig, ob Mann oder Frau.
Hauptsache, jung.
Mühsam raffte sie sich auf. Sie mußte den Dolch langsam
entfernen und ebenso langsam und vorsichtig dieWunde schließen, die
er gestoßen hatte. Sie wünschte Ilonkin die Pest auf den Hals, aber
ihre Kraft reichte jetzt nicht mehr, ihm den Fluch wirksam
nachzuschleudern.
Aber dann geschah etwas anderes.
Der Teufel kam.
Er fuhr durch den Kamin ins Haus ein und trat aus dem Feuer
hervor.
Eine Schwefelwolke wehte ihm voraus und warf die verletzte,
dem Tode nahe Hexe förmlich zurück. Der Gehörnte entfaltete seine
Flügel wieder, der Schweif mit der Glutspitze zuckte hin und her,
bereit in Brand zu setzen, was ihm in die Quere kam. Zornig
stampfte der Teufel mit dem Huf auf.
»Du versprachest mir eine Seele, erbärmliche Hexe«, grollte er
dumpf.
»Wo ist sie, diese Seele? Wo ist der Mensch, in dessen Körper
du schlüpfen wolltest? Wo ist Stana Ilonkin?«
»Fort, geflohen, Herr«, keuchte Nadija Perkowa. »Sieh seinen
Dolch in meiner Brust. Er versuchte mich zu töten. Der Bann
brach…«
»Du bist eine Stümperin«, zischte der Teufel. »Wie eine
blutige Anfängerin hast du dich benommen, Fehler begangen trotz
deiner fast tausendjährigen Erfahrung! Ich glaube gar, du wirst
alt, Nadija Perkowa!«
Und wieder stampfte er mit dem Huf.
»Was liegt Euch schon an dieser Seele, Herr?« wimmerte die
Hexe.
»Es gibt tausende von Seelen, die Ihr haben könnt. Ich werde
sie Euch beschaffen…«
Er machte einen Schritt auf sie zu.
»Was mir an dieser Seele liegt, fragst du, du Stümperin? Viel,
sehr viel! Weißt du nicht, wer Stana Ilonkin ist? Der Sohn eines
Adligen bei Hofe! Wärest du in seinen Körper geschlüpft, hättest du
großen Einfluß auf den Zaren und seine Familie nehmen können! Denn
Stanas Vater ist dem Zaren ein guter Freund! Großes hatte ich mit
dir vor. Du hättest die Macht über ganz Rußland haben können, die
Macht als engster Berater des Zaren! Doch nun ist dir diese
Karriere verwehrt. Er selbst wird aufsteigen oder fallen,
wahrscheinlich fallen, denn er hat nicht deine Größe und deine
Jahrtausenderfahrung! Vorbei, vertan…«
»Herr…«, wimmerte die Hexe. »Ich wußte nicht…«
»Du hättest es wissen müssen mit deiner Kunst, die ich dir
einst schenkte! Aber du warst zu leichtfertig, zu oberflächlich!
Nun, du wirst nie wieder einen solchen Fehler begehen!«
»Bestimmt nicht«, schluchzte sie. »Ich werde diesen Fehler
wiedergutmachen, ich werde…«
»Nichts wirst du«, sagte der Teufel. »Nichts, du Relikt der
Vergangenheit. Wohl oder übel werde ich mich weiter auf Rasputin
verlassen müssen, doch Rasputin ist ein unsicherer Mann, er geht
seinen eigenen Weg, spielt sein eigenes Spiel. Nun, das ist eine
Sache, die dich nichts angeht.«
Er trat direkt vor sie.
»Was habt Ihr vor, Herr?« kreischte sie angstvoll.
Der Teufel lachte zornig auf. Sein Schweif mit der Glutspitze
fuhr heran, berührte die uralte Hexe und riß ihr die Seele aus dem
Leib. Er schleuderte sie durch die Luft und bannte sie in den
Spiegel über dem Kamin. Ein schauerlicher Klagelaut schwang durch
das Haus und verwehte.
Das Spiegelglas wurde ein wenig matter. Die Hexe war darin
gefangen, für immer und ewig und alle Zeiten. Eine furchtbare
Strafe für ihr Versagen, eine Strafe, wie sie sich nur der Teufel
erdenken kann…
Der Leib der Hexe aber zerfiel zu feinkörnigem Staub.
Und der Teufel verließ diese Stätte des Grauens wieder. Er
schwang sich durch den Kamin in die Lüfte empor und entschwand mit
wuchtigen Schlägen seiner lederartigen Schwingen in den
Nachtwolken.
***
Etwa siebzig Jahre später wurde das Haus dem Erdboden
gleichgemacht.
Vergessen war die Zeit des Zaren, tot waren Nikolaus II. und
der teuflische Wundermönch Rasputin. Vergessen war auch die Hexe
Nadija Perkowa, deren Seele vom Teufel in einen Spiegel gebannt
worden war.
Das Haus war der Verbreiterung der großen Überlandstraße im
Wege, die vom ehemaligen Petersburg, das jetzt Leningrad hieß, nach
Moskau führte.
Als die Arbeiter das Haus betraten, das seit Jahrzehnten
leerstand und dessen früherer Besitzer oder dessen Erben nicht mehr
festzustellen waren, umwehte sie ein Hauch der Düsternis und der
Bedrohung. Sie waren froh, als sie wieder im Freien standen. Aber
es hatte sich gelohnt. Wassil Wassilowitsch schleppte einen alten
Schrank zu sich nach Hause, Pjotr Kobiniakin dagegen einen Spiegel,
dessen Glasfläche seltsam trüb war, aber dessen Rahmen mit
Blattgold beschichtet war. Allein der Rahmen war eine Kostbarkeit
für sich.
»Schlag doch das Glas kaputt, das kann doch sowieso niemand
mehr benutzen, Genosse Kobiniakin«, riet ihm der Vorarbeiter der
Kolonne, der sich an anderen Kostbarkeiten schadlos gehalten hatte.
»Dann brauchst du nicht so vorsichtig mit ihm umzugehen.«
Aber Kobiniakin zerschlug das Spiegelglas nicht. Er nahm das
wertvolle Stück heil mit nach Hause, und er konnte es für 500
Rubelchen verkaufen.
Die 500 waren ein Handgeld, mehr nicht, wenn man den wahren
Wert des Spiegels in Betracht zog, aber für Kobiniakin reichte das
Geld aus, endlich den altersschwachen Moskwitsch zu kaufen, der
zwar schon aus fast allen Schrauben und Schweißnähten platzte, aber
immerhin ein Autochen war. Und es fuhr, das Autochen, und Pjotr
Kobiniakin brauchte jetzt nicht mehr mit dem Fahrrad zur
Sammelstelle zu strampeln, wo ihn der Arbeiterbus abholte, um ihn
zur jeweiligen Baustelle zu bringen, sondern Kobiniakin konnte
jetzt mit dem eigenen Autochen zur Baustelle fahren, und die
Nachbarn staunten, weil er im Dorf nach dem Genossen Ortsvorsteher
der einzige war, der so ein Autochen besaß. Kobiniakin war
plötzlich jemand, zwar ein Arbeiter, aber ein hochangesehener,
reicher Bürger, der sich ein Autochen leisten konnte.
Der den Spiegel kaufte, kümmerte sich nicht darum. Er hatte
das gute Stück günstig bekommen, den Verkäufer gehörig übers Ohr
gehauen, und reihte den Spiegel seiner Sammlung von Antiquitäten,
Raritäten und Kostbarkeiten ein.
Fortan, so sagte man, ging es im Hause dieses Sammlers nicht
mehr mit rechten Dingen zu. Bilder fielen von der Wand, Lampen
gingen grundlos an und aus, und wer zu Besuch kam, war froh, wenn
er wieder gehen konnte, so bedrückend war die Atmosphäre innerhalb
der vier Wände.
Gut zehn Jahre konnte sich Sergej Publikow an seinen Schätzen
noch erfreuen, dann starb er, weil ihm bei einem Herbststurm ein
vom Baum abgerissener Ast auf den Kopf fiel und sich das Holz als
wesentlich stabiler erwies als der russische Dickschädel. Der
Spiegel stand auf dem Dachboden und verstaubte schon seit
langem.
Man schrieb inzwischen das Jahr 1987…
***
Das Hospital von Leicester war, wie Nicandra Darrell sich
ausdrückte, »klinisch tot«. Es herrscht eine geradezu ungewöhnliche
Ruhe. An den weißgetünchten Wänden hingen farblos blasse Bilder
moderner Neonkünstler, ganz entgegen aller britischen Tradition,
alles strahlte vor Sauberkeit und Sterilität – nicht nur im
biologischen, sondern auch im übertragenen Sinne. Nicandra fühlte
sich in diesem Krankenhaus nicht wohl.
Sie war froh, daß Moronthor und sie nur als Besucher hier
waren. Seit einigen Tagen war ihr gemeinsamer Freund Ted Ewigk hier
Patient. Auch jetzt sah er noch blaß aus und hing noch an den
Instrumenten und Apparaten, die ihn künstlich ernährten, seinen
Kreislauf stabil hielten und die Herz- und Gehirntätigkeit
überwachten. Immerhin ging es ihm schon etwas besser als bei der
Einlieferung.
»Trotzdem spüre ich meinen Körper immer noch nicht«, sagte er
gezwungen ruhig. »Ich kann mich bewegen, aber ich spüre nichts. Und
ich glaube, ich kann die Bewegungen auch nicht bewußt
steuern.«
»Du sollst dich aber nicht bewegen, hat der Onkel Doktor
gesagt, der mit der Hornbrille«, rügte Professor Moronthor.
»Zumindest vorläufig noch nicht. Wenn du nicht mehr liegen kannst,
sollst du gefälligst Schwester oder Pfleger herbeirufen, daß sie
dich anders lagern.«
»Weiß ich«, murmelte Ted. Die Sprechanlage, mit der er das
Personal zu sich holen konnte, schaltete sich auf einen schrillen
Pfeifton hin auf Sendung, den er allemal mit gespitzten Lippen
zustandebrachte. Danach konnte er sprechen und seine Wünsche
äußern.
»Mann, über kurz oder lang drehe ich hier durch«, murmelte der
Reporter.
»Dieses Stilliegen ist nichts für mich. Da draußen dreht sich
die Welt doch weiter, mit einer Geschwindigkeit von 24 Stunden pro
Umdrehung!«
Nicandra grinste.
»Deinen Reden nach muß es dir schon wieder verflixt gutgehen«,
sagte sie. »Wir haben dir deinen Kristall mitgebracht. Lieutenant
Spooner hat ihn freigegeben. Er konnte nichts damit
anfangen.«
»Habt ihr ihm das nicht vorher gesagt? Leg den Kristall da
neben mich auf die Tischplatte«, bat er. Dann betrachtete Ted Ewigk
den blauen, aber nicht sonderlich großen Kristall
nachdenklich.
Es war der Machtkristall, der Ted Ewigk innerhalb der
geheimnisumworbenen SIPPE DER EWIGEN in den Rang des ERHABENEN
erhob.
Ted Ewigk war die oberste herrschende Instanz jener
Gruppierung, die vor Jahrtausenden das Universum beherrscht haben
sollte; um sich dann schlagartig von allen kontrollierten Welten
zurückzuziehen. Erst das Duell zwischen Moronthor und Asmodis, dem
Fürsten der Finsternis, hatte sie wieder aufgeschreckt. In den
Felsen von Ash-Naduur war Dämonenblut geflossen und hatte ein
Signal gegeben, das die SIPPE wieder auf den Plan rief.
Sie kamen, um zu erobern, aus Weltraumtiefen zur Erde.
»Schlafende Agenten« erwachten auf der Erde und griffen ins
Geschehen ein. Moronthor, Pater Aurelian und Ted Ewigk hatten ihnen
eine empfindliche Niederlage beigebracht und den damaligen
ERHABENEN samt seinen Eroberungsplänen ausschalten können. Ted
Ewigk hatte das Amt übernommen.
In ihm floß das Blut des Zeus, und er trug den Machtkristall
des Zeus, den Arrayhd-Kristall dreizehnter Ordnung, mit dem Sonnen
zerstört werden konnten, wenn man seine Macht mißbrauchte.
Aber das hatte in all den Jahrmillionen noch niemand
gewagt.
Zwar kümmerte Ted sich wenig um die Belange der SIPPE, deren
Wesen er selbst noch nicht zur Gänze durchschaute; er hatte nur
angekündigt, jeden Eroberungsversuch nachhaltig zu verhindern und
die Drahtzieher auszuschalten. Aber den radikalen Kräften unter den
EWIGEN paßte das nicht. Sie wollten die Macht unter Einsatz von
Gewaltmitteln erneuern. Man munkelte, daß in den Tiefen des
Universums andere EWIGE daran arbeiteten, mit ihren Kräften
Machtkristalle zu erschaffen.
Wer es schaffte, würde das Amt des ERHABENEN anstreben – und
Ted Ewigk zum Kampf fordern müssen.
Aber Ted Ewigk konnte nicht kämpfen. Nicht jetzt, in diesen
Wochen.
Es hatte damit begonnen, daß ein auf der Erde lebender EWIGER
versuchte, einen Machtkristall zu formen. Doch in diesem Kristall,
der mehr und mehr erstarkte, hatte sich einer der MÄCHTIGEN vom
Ende der Existenz manifestiert und die Kontrolle selbst über den
EWIGEN übernommen.
Mehr durch Zufall war Ted darauf gestoßen, und der MÄCHTIGE in
Gestalt des Arrayhd-Kristalls hatte sofort mit aller Kraft
zugeschlagen.
Teds Wagen war explodiert, während der Reporter sich darin
befand, und nur sein eigener Arrayhd hatte verhindern können, daß
er starb.
Aber Ted war dabei schwer verletzt worden.
Moronthor hatte den Kampf aufgenommen. Er steuerte Teds
Machtkristall über sein Amulett, Merlins Stern, und verhinderte so,
daß der Kristall ihm den Verstand verbrannte. Denn Moronthor
vermochte wohl mit seinen Para-Kräften einen Kristall dritter
Ordnung zu bändigen, aber nicht einen der dreizehnten Stufe.
Dennoch hatte er es über Merlins Stern geschafft, den anderen
Kristall, den MÄCHTIGEN in dieser bizarren Gestalt, mit magischer
Energie zu überladen und auszulöschen. [1]
Zunächst war der Kristall wie auch die ausgeglühten Reste des
Rolls-Royce von der Polizei beschlagnahmt worden, um die
Explosionsursache und alles, was damit zusammenhängen konnte, zu
ergründen. Moronthor hatte sich den Kristall gegen Quittung
ausgeliehen und dann wieder abliefern müssen. Jetzt waren die
Untersuchungen abgeschlossen, und Polizeileutnant Spooner hatte den
Arrayhd freigegeben.
»He«, sagte Nicandra plötzlich. »Was machst du da, Ted?«
Ted Ewigk sah den Kristall nur an. Tief im Innern des
Zaubersteins begann es leicht zu leuchten. Der Arrayhd war aktiv!
Gleichzeitig begann die Anzeige des die Gehirntätigkeit des
Reporters überwachenden Elektroenzephalographen stärker
auszuschlagen. Moronthor sah Nicandra verblüfft an. Mit seinen
Para-Fähigkeiten hatte er keinen Impuls wahrgenommen, Nicandra aber
hatte etwas gespürt, noch ehe die Instrumente reagieren konnten. Es
mochte an dem schwarzen Blut liegen, das sie für kurze Zeit in den
Adern gehabt hatte, oder an jenem in seinen Auswirkungen noch
unerforschten Serum des Schwarzen Lords, daß sie sensibler für
übersinnliche Erscheinungen geworden war.
Ted antwortete nicht.
Der Arrayhd leuchtete stärker.
Nicandra erhob sich von dem Besucherstuhl, auf dem sie sich
niedergelassen hatte. Sie ging langsam durch das Zimmer auf den
Spiegel über der Waschnische zu. Moronthor sah ihr befremdet zu.
Was geschah hier?
Er merkte nichts davon, auch Merlins Stern reagierte nicht auf
die magische Kraft, die hier offenbar wirkte.
»Nici…«
Sie reagierte nicht. Vor dem Spiegel blieb sie stehen, hob
beide Hände und wollte die Glasfläche berühren.
Da fühlte Moronthor den Gefahrenimpuls.
»Weg!« schrie er. »Paß auf!«
Nicandra reagierte mit enormer Geschwindigkeit und ließ sich
zu Boden fallen. Aus dem Arrayhd-Kristall fuhr ein blaßblauer
Blitz, einem Laserstrahl nicht unähnlich, und erfaßte den Spiegel.
Sekundenlang wurde er von hellem Licht umwabert, dann war es wieder
vorbei.
Nichts war geschehen. Nicandra erhob sich vorsichtig. Der
Arrayhd erlosch langsam.
Ein Arzt und zwei Schwestern stürmten in den Raum. Der
Elektroenzephalograh hatte sie alarmiert, als er die übermäßig
starken Alpha-Rhythmus-Impulse anmaß. Aber jetzt war alles wieder
normal.
»Was ist hier geschehen?« stieß der Arzt mit der Hornbrille
hervor.
»Haben Sie Mister Ewigk über Gebühr aufgeregt?« Zornig
fixierte er Moronthor und Nicandra, die vor dem Spiegel
stand.
Moronthor schüttelte den Kopf.
»Sie haben mich nicht aufgeregt«, bestätigte Ted Ewigk.
»Vielleicht spielen Ihre Instrumente verrückt. Sie sollten sie
einmal überprüfen lassen.«
Damit wollte der Arzt sich nicht zufriedengeben, aber es gab
für den Vorfall keine Erklärung, die ihm glaubwürdig
erschien.
»Sie sollten den Patienten nicht mehr sooft besuchen, Mister
Franzose«, sagte er unhöflich zu Moronthor. »Sie regen ihn wirklich
nur unnötig auf.«
»Ich komme, wann immer Herr Ewigk meine Anwesenheit wünscht,
Monsieur Engländer«, gab Moronthor lächelnd zurück. »Aber ich
glaube, wir gehen tatsächlich wieder.« Er nickte Nicandra zu. Ein
Gespräch mit Ted war jetzt unmöglich. Der bebrillte Arzt in seiner
verständlichen Sorge um seinen Patienten würde das Krankenzimmer
erst wieder verlassen, wenn Moronthor und Nicandra gegangen
waren.
Nun, dachte der Parapsychologe. Morgen ist auch noch ein
Tag.
Und vielleicht wußte Nicandra mehr. Immerhin mußte sie auf
etwas aufmerksam geworden sein, was mit dem Spiegel
zusammenhing.
***
Sie befand sich irgendwo in den Tiefen von Zeit und Raum auf
dem Weg von der Vergangenheit in die Zukunft. Zeit hatte für sie
nur untergeordnete Bedeutung. Nicht umsonst wurde sie DIE ZEITLOSE
genannt.
Blau schimmerte die Haut ihres Körpers, aus dessen Rücken
mächtige Schmetterlingsflügel ragten. Blau war das Fell des
Einhorns, auf dem sie durch die Ewigkeit ritt. Sie war auf der
Suche.
Auf der Suche nach einem Mann, der Professor Moronthor genannt
wurde.
Schon einmal hatte sie mit ihm zu tun gehabt, gestern oder vor
einer Million Jahren. Jene, die dem Strom der Zeit unterworfen
waren, hatten den Zeitpunkt ihrer Begegnung in der Kreidezeit
angesiedelt, in tiefster Erdvergangenheit. Damals hatten sie Seite
an Seite gekämpft und sich dann wieder aus den Augen verloren.
[2]
Jetzt war sie, die ZEITLOSE, wieder auf diesen Professor
Moronthor aufmerksam geworden. Er schaffte das, was bislang
niemandem gelungen war: Die MÄCHTIGEN zu töten.
Dabei waren sie unsterblich. Sie konnten besiegt werden, in
die Flucht geschlagen werden. Doch nie zuvor war es einem Menschen
gelungen, einen MÄCHTIGEN wirklich zu töten. Denn sie
manifestierten sich in den unterschiedlichsten Erscheinungsformen,
weil sie das universelle Schattenleben an sich waren.
Doch Moronthor hatte soeben den dritten MÄCHTIGEN getötet. Das
gab der ZEITLOSEN zu denken.
Hatte sie etwas in der Struktur des Kosmos gewandelt? Wandte
sich die Natur jetzt gegen die MÄCHTIGEN! Oder hatte sich jener
Moronthor selbst gewandelt? Die ZEITLOSE wollte es herausfinden.
Sie mußte es herausfinden, denn es war auch für sie ein
existentielles Problem. Sie mußte mehr über Moronthor, sein Umfeld,
seine Art zu leben, seine Verbündeten erfahren.
Aber zunächst mußte sie ihn im Strom der Zeit finden.
Sie hielt in ihrer Reise inne. Es gab eine Möglichkeit, ihn
aufzuspüren.
Sie wußte, daß sie sich ungefähr in der richtigen Zeitepoche
aufhielt. Sie glitt aus ihrer zeitlosen Sphäre hinaus in die Welt
der Menschen.
Sie hatte sich einen einsamen, abgelegenen Ort für ihr
Vorhaben ausgesucht.
Es wäre nicht gut, wenn jemand sie überraschend
erblickte.
Denn ihr Aussehen war doch zu ungewöhnlich, um vom
menschlichen Verstand so einfach verarbeitet zu werden.
Mit raschem Flügelschlag schwang sie sich vom Rücken des
Einhorns hinunter. Sie stand auf fruchtbarem, grasbewachsenem
Boden. Ausgedehnte Wälder erstreckten sich ringsum, und unmittelbar
vor ihr vernahm sie das Plätschern eines Baches. Nur wenige Meter
entfernt sah sie einen kleinen Teich, dessen abfließendes Wasser
sich dem Bach zugesellte.
Der Teich war genau das, was sie brauchte.
Sie trat an sein Ufer. Das Wasser war trübe, grünlich, von
Algen durchsetzt.
Käfer liefen hastig über die Oberfläche. Hier und da kauerte
eine Grille am Ufer zwischen den Gräsern. Irgendwo nahte sich
hüpfend ein Frosch, um Beute zu suchen. Fliegen, Mücken und Wespen
surrten, ein Schmetterling bewegte sich durch die Sträucher.
Das alles nahm die Zeitlose mit einem kurzen, schnellen Blick
auf.
Das Leben im Teich störte sie. Es brachte zu viel Bewegung in
die Oberfläche des Gewässers. Auch die Algen mußten verschwinden.
Die Zeitlose kauerte sich am Ufer nieder, dann hielt sie eine Hand
in das Wasser, das erfrischend kühl war.
Es war die linke Hand.
Ringsum begannen die Algen zu verdorren. Sie schrumpften und
vergingen.
Die Insekten flohen, so rasch sie konnten, und verbargen
sich.
Endlich war der Teich so, wie die Zeitlose ihn haben
wollte.
Sie begann mit der Beschwörung des Dämons Vassago, der sowohl
von der Schwarzen als auch von der Weißen Magie angerufen werden
kann und zu Diensten steht. Nach einer Weile gab sich Vassago
tatsächlich zu erkennen.
»Du, die du mich mit einem Siegel riefest, was begehrst du?«
Mit keiner Regung gab er zu erkennen, über ihr Aussehen erstaunt zu
sein oder sie gar zu erkennen. »Wisse, daß ich mich nur ungern
stören lasse.«
Die Zeitlose lächelte.
»Ich weiß es. Jeder, der ein wenig von der Magie versteht,
will sich deine Kunst zunutze machen und durch deinen Spiegel
schauen. Aber mein Anliegen ist wichtig. Zeige mir jenen, der
Professor Moronthor heißt.«
»Moronthor?« keuchte Vassago auf. »Was hast du mit ihm zu
schaffen? Bist du ihm Freund oder Feind?«
»Weder, noch. Ich stehe ihm so neutral gegenüber wie du,
Vassago«, erklärte die Zeitlose. »Doch ich muß wissen, wo ich ihn
finden kann. Zeige ihn mir. Oder muß ich dich mit einem Zwang
belegen?«
Vassago zögerte. Er versuchte, die Zeitlose einzuschätzen.
Doch dann kam er wohl zu der Erkenntnis, daß es nicht gut sei, sich
mit ihr im Bösen anzulegen. Zum einen stand er durch die
Beschwörung teilweise in ihrem Bann, zum anderen ging etwas von ihr
aus, das ihn tief berührte.
Und er wußte nicht, ob es Licht oder Dunkelheit war.
»So sei es denn«, sagte er.
Der Spiegel des Vassago erwachte. Auf der Oberfläche des
Teiches – es hätte auch eine simple kleine Wasserschüssel sein
können – begannen sich verwaschene Bilder abzuzeichnen. Die
Zeitlose konzentrierte sich auf das Schwingungsmuster von
Moronthors persönlicher Ausstrahlung.
Sie hatte es damals aufgenommen, aber sie war sich nicht
sicher, ob sie ihn wirklich allein gefunden hätte. Deshalb nahm sie
Vassagos Hilfe in Anspruch.
Der Dämon, der insgeheim hoffte, eines Tages wieder zum Licht
erhöht zu werden, beobachtete sie stumm und lenkte seine Kräfte in
den Spiegel. Die Bilder stabilisierten sich allmählich, wechselten
nicht mehr so schnell. Und sie wurden klarer.
Schließlich blieb nur noch eines dieser Bilder.
Die Zeitlose sah ein Gesicht. Moronthor! Doch ein anderes
Gesicht schob sich davor. Das seiner Gefährtin. Sie mußte etwas
spüren. Viele weiße und hellgraue Kästen standen in dem Zimmer,
Schläuche und Schnüre führten zu einem Mann, der auf einem
fahrbaren Lager ruhte. Und ein blauer Kristall funkelte. –Und griff
an!
Das Bild explodierte förmlich, loderte in rasendem Feuer, und
unwillkürlich wehrte die Zeitlose die unheimlichen angreifenden
Kräfte ab, ließ sie an sich vorbeigleiten an ein anderes Ziel. Und
dort wurde etwas ausgelöst, das sich in seinen Konsequenzen jetzt
noch nicht absehen ließ.
Vassagos Spiegel kräuselte sich, und Flammen tanzten über dem
Wasser.
Das Bild verging, der mächtige Bildzauber zerbrach. Vassago
keuchte.
Und verschwand.
Mit aller Kraft, die er aufzubringen vermochte, löste er sich
aus dem Bann der Zeitlosen und zog sich zurück, und er schirmte
sich mit Bannsprüchen ab, damit sie ihn kein zweites Mal beschwören
konnte.
Die Zeitlose trat vom Teich zurück, der wie ausgestorben
wirkte.
Moronthor war da, existierte in dieser Zeit, aber sie hatte
nicht herausfinden können, wo er sich genau aufhielt. Sie war nicht
klüger geworden als zuvor. Jemand hatte ihren Versuch, Moronthor zu
beobachten und durch die Beobachtung seinen Aufenthaltsort zu
finden, erkannt und mit der Macht des stärksten Arrayhd-Kristalls
des Universums zurückgeschlagen.
Die Zeitlose mußte nach einem anderen Weg suchen, Moronthor zu
finden.
Sie verließ den Teich, schwang sich wieder auf den Rücken des
blauen Einhorns und glitt in die zeitfreie Sphäre zurück. Sie stand
wieder fast am Anfang ihrer Suche.
Und wußte nicht, was durch diesen magischen Schlag und ihre
Abwehr ausgelöst worden war…
***
»Was war nun los?« wollte Moronthor wissen, als er mit
Nicandra zurück zum Hotel fuhr. Sie hatten sich hier in Leicester
einquartiert, um direkt vor Ort zu sein, falls es bei Ted
Komplikationen geben würde.
Eigentlich waren sie beide nur aus einer Laune heraus nach
England geflogen. Ausnahmsweise war dort besseres Wetter als im
Loire-Tal in Frankreich, und sie wollten ein wenig ausspannen.
Gleichzeitig wollten sie im Beaminster Cottage, ihrer zweiten
Basis, wieder einmal nach dem Rechten sehen. Und unversehens waren
sie in das Abenteuer mit Gryf und Teri, mit dem EWIGEN und dem
MÄCHTIGEN hineingeschlittert.
Inzwischen waren sie unten im Süden Englands im Cottage
gewesen, sie hatten auch einen Abstecher nach London gemacht und
Babs Crawford besucht, die Lebensgefährtin des Druiden Kerr, der im
Kampf gegen den Hexenjäger Eysenbeiß das Leben hatte lassen müssen.
Babs war immer noch nicht so ganz über Kerrs Tod hinweggekommen,
aber sie begann, ihr Leben jetzt allmählich wieder zu
meistern.
»Urlaub wollten wir machen«, hatte Nicandra geschmunzelt.
»Ausspannen und faulenzen. Und was tun wir? Wir fahren kreuz und
quer durch England, hierhin und dahin und dorthin…«
Moronthor fuhr den dunkelgrünen Jaguar auf den Hotelparkplatz.
Er blieb noch hinter dem Lenkrad sitzen. Nicandra Darrell strich
sich durch das Haar.
»Vassagos Zauber«, sagte sie. »Ich spürte, daß uns jemand
beobachtete. Aber bevor ich feststellen konnte, wer es war,
schaltete sich Teds Kristall ein. Ich bin mir dabei nicht einmal
sicher, ob das nötig war. Ich habe keine negativen Gefühle
empfangen.«
»Sondern?«
»Irgendwie neutral und nicht faßbar. Aber es könnte sein, daß
der Beobachter jetzt auf diesen Arrayhd-Angriff mit eigenen
Feindseligkeiten reagiert. Ob Ted sich darüber Gedanken gemacht
hat?«
»Wir werden ihn fragen, wenn wir morgen wieder im Krankenhaus
sind«, sagte Moronthor. »Hoffentlich kommt er bald wieder auf die
Beine. Niemand weiß, was genau mit ihm geschehen ist. Die
Verbrennungen, die er erlitten hat, sind im Grunde nebensächlich,
innere Verletzungen gibt es keine. Und sein Nervensystem ist
irgendwie gestört. Ich führe es auf die Magie des MÄCHTIGEN
zurück.«
Nicandra nickte.
»Das ist anzunehmen. Wenn wir nur wüßten, wer uns beobachten
wollte.«
Moronthor stieg jetzt aus und ging um den Wagen herum, um
Nicandra die Autotür zu öffnen, aber sie war schon draußen.
»Vielleicht meldet der Beobachter sich ja wieder bei uns. Auch
im Hotelzimmer gibt es Spiegel.«
»Sofern der Spiegel als Echogeber funktioniert. Es kann Zufall
gewesen sein, daß der im Krankenhaus auf den Vassago-Zauber
ansprach. Vielleicht ist’s das nächste Mal der Wasserspiegel in der
Badewanne.«
»Auch möglich«, gestand Nicandra. »Was hälst du eigentlich
davon, wenn 17 wir dem Küchenchef dieses hübschen Hotels mal wieder
Arbeit verschaffen?«
Moronthor verzichtete auf eine Antwort. Er steuerte das
Hotelrestaurant an und bahnte Nicandra den. Weg.
***
Der Blitz, der den Spiegel in Ted Ewigks Krankenzimmer
getroffen hatte, um durch ihn hindurch den fremden Beobachter zu
treffen, war von der Zeitlosen abgeleitet worden. So war er nicht
aus der Oberfläche des kleinen Teiches herausgeflammt, um sie zu
erfassen und zu versengen, sondern in einen anderen Spiegel
geschleudert worden.
Wahl- und ziellos, irgendwohin.
Es war jener Spiegel, in den vor gut 80 Jahren der Teufel die
Seele der Hexe Nadija Perkowa bannte.
Und der Arrayhd-Blitz änderte diesen Zustand. Er weckte die
Seele der Hexe auf!
Und Nadija Perkowa erwachte…
***
Sergej Publikows Haus war ein Fall für die
Parapsychologen.
Trotz der seltsamen Phänomene in seinem Haus hatte Publikow
zeitlebens abgelehnt, daß sich Wissenschaftler mit der Aufklärung
dieser Vorfälle befaßten. Jetzt aber war die Situation anders
geworden. Publikow lebte nicht mehr, und es gab überraschenderweise
keine Erben. Es gab auch kein Testament. So wurde das Haus zunächst
einmal unter staatliche Aufsicht gestellt, bis darüber entschieden
werden konnte, was weiter geschehen sollte.
Die Beamten der Stadtverwaltung von Tschudowo, der kleinen
Zwanzigtausend-Seelen-Stadt hundert Kilometer südöstlich von
Leningrad am Fluß Wolchow gelegen, spürten größtes Unbehagen, als
sie sich in Publikows Haus aufhielten und Bestandsaufnahme machten.
Publikow war ein Kunstsammler gewesen, ein angesehener Bürger der
Stadt, dessen Stimme Gewicht hatte. Er war reich gewesen, sein Haus
am Stadtrand überraschend groß. Aber die Größe vermochte doch nicht
den Hauch des Düsteren zu verdrängen, der über allem lag, und die
Beamten konnten erst dann wieder richtig aufatmen, als sie dann
draußen waren.
Sie berichteten von ihren seltsamen Empfindungen. Auch früher
hatten Besucher des Hauses schon von der Ausstrahlung erzählt, die
über allem lag. Und nun kam jemand auf die kluge Idee, das Institut
für Parapsychologie an der Universität von Moskau zu unterrichten,
daß nunmehr verwaltungsrechtlich keine Bedenken mehr beständen, das
Haus einmal eingehend zu untersuchen.
Boris Iljitsch Saranow wurde beauftragt, mit seinen beiden
Assistenten nach Tschudowo zu fahren und sich um den Fall zu
kümmern.
Leonid Abramov war nicht sonderlich begeistert, Moskau
verlassen zu müssen. Er fühlte sich nur in der Großstadt wohl.
Natascha Solenkowa dagegen war begeistert. Sie war reiselustig,
hatte aber selten Gelegenheit, ihrer Lust nachzugeben. Denn die
Angestellten des parapsychologischen Instituts waren stark
eingespannt, bekamen wenig Urlaub und wurden in aller Regel auch
überwacht, da sie teilweise an staatlichen Geheimprojekten
arbeiteten. Saranow selbst gehörte zu den Geheimnisträgern.
Er pendelte ständig zwischen Moskau, wo er einen Lehrauftrag
hatte, und Akademgorodok hin und her, wo er an einem
Telepathie-Projekt arbeitete. Psi-Forschung wurde in der
Sowjetunion im Geheimen betrieben, aber recht
großgeschrieben.
Daran, ständig überwacht zu werden, hatte Saranow sich längst
gewöhnt.
Auch in Tschudowo würde er sich nicht unbeobachtet bewegen
können, und seine beiden Assistenten auch nicht. Zu groß war die
Befürchtung des KGB, er könne entführt werden und fremde Mächte
sich seines Wissens über den Stand der Psi-Forschung
bemächtigen.
Immerhin kamen die drei Wissenschaftler so zu dem Privileg,
mit einem Dienstwagen des KGB nach Tschudowo gefahren zu werden.
Saranow und Abramov lümmelten sich auf dem Rücksitz des schwarzen
Wolga-Gaz-24, Natascha Solenkowa streckte ihre langen Beine auf dem
Beifahrersitz aus, und der schweigsame Kapitän Igor Semjonow lenkte
den Wagen von Moskau nach Tschudowo.
Die Stadt erwies sich als ein nicht sonderlich sehenswertes
Provinznest, wie Leonid Abramov sich abfällig äußerte. Publikovs
Villa stand am Stadtrand, und das Grundstück war von einer hohen
Mauer umgeben.
Ein unauffälliger Lada parkte vor dem Gittertor. Der Beamte
der Stadtverwaltung, der die Schlüsselgewalt hatte, fühlte sich
sichtlich unwohl.
Semjonow, der Schweigsame, hielt neben ihm an.
»Öffnen Sie bitte, Genosse, damit wir hindurchfahren
können.«
Der Verwaltungsbeamte gehorchte. Er murmelte etwas vor sich
hin, was glücklicherweise niemand verstand. Der schwarze Gaz-24
rollte mit metallisch hämmerndem 110-PS-Motor über die große
Einfahrt auf die Freitreppe vor dem Haus zu. Der Verwaltungsbeamte
folgte zu Fuß. Er hatte keine Durchfahrtsgenehmigung für das
verwaiste Privatgelände.
Semjonow auch nicht, aber das hatte ihn noch nie
gestört.
Boris Saranow faltete seine einhunderteinundzwanzig Zentimeter
einschließlich zwei Zentner Lebendgewicht aus dem Fond des
Dienstwagens, glättete sich sorgfältig und legte den Kopf in den
Nacken, um die Hausfront zu betrachten. Er konnte nichts
Auffälliges entdecken. Aber das war normal. Para-Phänomene zeigten
sich nicht in äußerlichen Effekten.
Saranow wartete, bis alle ausgestiegen waren, dann streckte er
den Zeigefinger aus und tippte einen nach dem anderen an.
»Schwesterchen Natascha, du schaust dich in den beiden oberen
Etagen um. Brüderchen Leonid, du schreibst auf, was wir dir
zurufen. Ich nehme den Keller. Und Sie, Brüderchen Spion, passen
auf, daß wir nicht abhanden kommen. Vielleicht wollen uns ein paar
Gespenster entführen.«
Igor Semjonow verzog nur das Gesicht. »Aufschließen«,
schnarrte der den Stadt-Beamten an.
»Brüderchen Spion, so unwirsch redet man nicht mit einem
verdienstvollen Staatsdiener«, rügte Saranow. »Sie sollten Ihr
Benehmen ruhig ändern. Es geht auch mit ein wenig Höflichkeit
anderen gegenüber, ja?«
Semjonow schwieg weiter. Er betrat als erster das Haus. Boris
Saranow folgte ihm. Sofort spürte er das Bedrückende, das sich über
ihn legen wollte. Er empfand es wie einen körperlichen
Schlag.
»Schreib, Brüderchen Leonid«, murmelte er und schilderte seine
Eindrücke.
»Immer ich«, knurrte Abramov unwillig. »Reicht es nicht, daß
ich jetzt für ein paar Tage in diesem besseren Dorf versauern muß?
Muß ich da wirklich auch noch arbeiten?«
»Schade, daß heute kaum noch jemand nach Sibirien geschickt
wird«, grinste Saranow. »Die Lager sind alle schon übervoll…«
»Saranow«, fauchte Semjonow ihn an. »Was sollen diese
Bemerkungen?«
»Ach, Sie können ja reden, Brüderchen Spion.« Er schob sich an
dem KGB-Mann vorbei. Er kannte das Innere des Hauses von Fotos her.
Er sah Natascha treppauf verschwinden. Hin und wieder rief sie
Bemerkungen durch das Treppenhaus, die Leonid Abramov lustlos auf
seinem Notizblock festhielt. Jeder andere hätte ein Diktiergerät
benutzt. Abramov mochte diese »moderne Technik« nicht. Er war eben
ein Mann voller Gegensätze. Vielleicht entsprangen gerade aus
diesen Gegensätzen seine Ideen, deretwegen Saranow ihn in sein Team
genommen hatte.
Saranow überlegte. Diese bedrückende Wolke über seinem Geist…
ihr Ursprung ließ sich nicht lokalisieren. Sie wurde nicht stärker
und nicht schwächer, gleichgültig, wohin er sich wandte. Er ließ
sich von dem Stadt-Beamten etwas über die Geschichte des Hauses
erzählen. Aber da gab es nichts, was Anhaltspunkte gab. Kein
tragischer Unglücksfall, der Ursache für einen Spuk sein könnte,
kein Verbrechen… und Publikowa war auch nicht para-begabt gewesen.
Zumindest hatte niemals jemand diesen Eindruck gehabt.
»Eigentlich hat es erst vor etwa zehn Jahren angefangen«, fuhr
der Beamte fort. Saranow hörte aufmerksam zu und machte sich
Gedächtnisnotizen, manches ließ er Abramov aufschreiben. Nach einer
Weile kam Natascha wieder von oben herunter.
»Nichts«, sagte sie. »Dieses Gefühl der Bedrohung, des Bösen
kommt überall gleich stark durch. Vielleicht sollten wir es einmal
auspendeln.«
»Vielleicht hat es dämonischen Ursprung«, überlegte Abramov.
»Ein Fluch könnte über dem Haus liegen. Jemand, der Publikow nicht
mochte…«
Saranow hob die breiten Schultern.
»Schaut euch doch mal den Spiegel auf dem Dachboden an«,
schlug Natascha vor. »Da steht ein Prachtstück… ich fühlte mich
irgendwie davon angezogen, kann aber nicht sagen, weshalb.
Vielleicht hat der Spiegel etwas damit zu tun.«
»Dobro«, murmelte Saranow. Er schnaufte die Treppen empor bis
unters Dach. Das erste was er sah, als er den großzügigen Dachboden
betrat, war der Spiegel. Da standen noch andere Möbelstücke herum,
Figuren, Leuchter, Gemälde… der Kunstsammler Publikow schien nicht
mehr gewußt zu haben, wohin mit seinem ganzen Kram, und hatte daher
eine ganze Menge an Gegenständen auf den Dachboden verbannt. Unter
anderem auch den von Natascha Solenkowa erwähnten Spiegel.
Er war ziemlich eingestaubt. Ein paar Dutzend Spinnen hatten
ihre Netze an ihm verankert. Der Spiegel war etwas über einen Meter
hoch und mit einem kostbar verzierten, aufwendig gearbeiteten
Rahmen eingefaßt.
Saranow kauerte sich vor dem Spiegel auf die Bodenbretter und
strich mit dem Finger durch den Staub.
»Gold«, sagte er. »Das Ding wird ein Vermögen wert
sein.«
»Mit diesem blinden Glas? Das ist ja mehr Grauschleier als
Spiegel«, murrte Abramov. Er zog ein Taschentuch hervor und wischte
über das Glas. Aber der Grauschleier blieb. Abramov pfiff durch die
Zähne.
»Sag einer, da wäre kein einziges Staubkörnchen auf dem Glas«,
murmelte er verwundert.
»Hm«, machte Saranow. »Ein seltsames Ding. Gerade so, als sei
er völlig blind. Wer ist denn so blöd und läßt in einem solchen
Prunkspiegel so ein idiotisch schlechtes Glas? Man erkennt sich ja
kaum…«
Er versuchte Einzelheiten zu erkennen. Aber er sah sich nur
verschleiert und verblaßt. So als sei es kein Spiegelbild, sondern
ein Gemälde, das ausgebleicht sei. Und das Gesicht wirkte sogar
verfremdet.
»Nanu«, machte Saranow und versuchte zu ergründen, warum ihm
sein Spiegelgesicht so verfremdet vorkam. Er betrachtete die
Augenpartie.
Das sind nicht meine Augen, dachte er erschrocken.
***
Zu Moronthors und Nicandras Überraschung war Ted Ewigk nicht
allein, als sie ihn am nächsten Tag wieder aufsuchten. In einem
Sessel, der gestern noch nicht hier gestanden hatte, saß ein Mann
unbestimmbaren Alters in einem unauffälligen grauen Anzug. Je
nachdem, wie das Licht fiel, schimmerte der Anzug ein wenig
silbrig.
Der Mann erhob sich nicht, als Moronthor und Nicandra
eintraten. Er fixierte sie nur aufmerksam und ließ sich gerade eben
zu einem leisen »Guten Tag« herab.
»Wer ist das, Ted?« fragte Moronthor.
»Mein Leibwächter«, erklärte der Reporter.
»Bist du irre?« stieß Moronthor verblüfft hervor. »Wofür
brauchst du einen Leibwächter?«
Ted Ewigk versuchte zu lächeln, aber es wollte ihm nicht so
richtig gelingen.
»Solange ich hier festgenagelt bin«, sagte er, »bin ich allen
Angriffen wehrlos ausgesetzt. Ich kann den Kristall nicht richtig
einsetzen, wie ich es gern möchte. Und nach jenem EWIGEN, der
versuchte, den Machtkristall zu schaffen, werden auch noch andere
auf die Idee kommen, daß 22 sie mich doch eigentlich mit einem
Überraschungsangriff töten könnten. Zumal ich jetzt fast wehrlos
bin.«
»Das müssen sie doch erst einmal erfahren, Ted«, versuchte
Nicandra ihn zu beruhigen.
»Es ist leicht, es herauszufinden. Es war für mich selbst
fetzt leicht, EWIGE auf der Erde aufzuspüren.«
»Gestern… ?« fragte Moronthor schnell. »Die Sache mit dem
Spiegel?«
»Ja und nein«, gestand Ted. »Ich versuchte Kontakt mit einem
EWIGEN aufzunehmen, den ich aufgestöbert hatte. Während des
Kontaktes merkte ich, daß jemand uns über den Spiegel zu beobachten
versuchte. Es muß Vassago-Magie gewesen sein, nicht wahr? Nicandra
hat es wohl auch gespürt. Ich nehme sehr stark an, daß es jemand
war, der seinerseits mich suchte und beobachten wollte. Und das
kann im Grunde nur ein Anhänger der radikalen SIPPE-Hälfte
sein.«
Moronthor warf einen raschen Blick auf den Leibwächter.
»Er ist zwangsläufig eingeweiht und weiß, wovon wir reden«,
sagte Ted. »Ich habe also zurückgeschlagen und dafür gesorgt, daß
ich nicht weiter beobachtet werden konnte. Seither hat es keinen
Versuch mehr gegeben. Aber er kann sich jederzeit wiederholen. Es
kann auch passieren, daß nach der Beobachtung ein Angriff
erfolgt.«
Nicandra schüttelte den Kopf.
»Ted, du bist zum Träumer geworden! Wer sagt dir denn, daß
dein Leibwächter, so gut er auch sein mag, Arrayhd-Magie abwehren
kann? Und wer sagt dir, daß er nicht ein gedungener Mörder deiner
Gegner ist?« Sie beobachtete dabei den Mann, der keine Miene
verzog, nur still da saß und lauschte. Es war fast, als sei er in
Trance versunken.
Ted lachte leise, was einen Hustenanfall zur Folge hatte. Er
beruhigte sich rasch wieder.
»Er ist kein gedungener Mörder meiner Gegner, und er ist der
Arrayhd- Magie gewachsen«, sagte Ted. »Erst recht, wenn ich meine
verfügbaren Kräfte mit ihm zusammenschalte. Wißt ihr, ich habe ihn
gestern über den Arrayhd-Kontakt zu mir gebeten. Er ist einer der
wenigen EWIGEN auf der Erde, die mir treu ergeben sind und zu den
positiven, fortschrittlichen Kräften gehören.«
Nicandra schnappte irritiert nach Luft. Moronthor schüttelte
nur den Kopf.
Der EWIGE im silbergrauen Anzug öffnete den Mund, ohne seine
Sitzhaltung zu verändern.
»Sie können mich Beta nennen«, sagte er ruhig.
Nicandra schluckte. Ausgerechnet ein Beta, einer der höchsten
Ränge, von denen es nur wenige EWIGE gab! Darüber standen nur noch
die zahlenmäßig noch geringeren Alphas, und über ihnen der ERHABENE
– derzeit der Mann, der hier auf dem Krankenlager ruhte.
»Bist du seiner ganz sicher, Ted?« fragte Nicandra noch
einmal. Ihr Mißtrauen, das sie dem Beta offen entgegenbrachte,
glitt an jenem ab. Sein Gesicht blieb ausdruckslos.
»Glaubt mir, ich weiß, wenn ich einem EWIGEN trauen kann und
wann nicht«, sagte Ted. »Er wird ständig hier sein, er braucht so
gut wie keinen Schlaf. Er wird für meine Sicherheit sorgen. – Nicht
alle von ihnen… von uns sind so schlecht, so böse und grausam wie
jene, die ihr bisher kennengelernt habt.«
»Na, hoffentlich«, murmelte Nicandra. Ihr Mißtrauen blieb.
Möglicherweise, wahrscheinlich sogar tat sie dem Beta damit
unrecht. Aber bislang hatten Moronthor und sie noch keine
angenehmer, Erlebnisse mit der SIPPE gehabt…
Mit einer Ausnahme, durchzuckte es sie. Damals, als wir aus
der Meegh-Welt zurückkehrten und im indischen Dschungel strandeten…
und in Ash’Naduur! Da waren die beiden Turbanträger, die Zu einem
einzigen Wesen verschmelzen konnten und die sich in Ash’Naduur
opferten…
Auch sie hatten, wie erst später in Erfahrung gebracht werden
konnte, zur SIPPE DER EWIGEN gehört.
»Nun gut«, sagte Moronthor. »Du mußt wissen, was du tust,
Ted.«
»Ein Vorfall wie gestern wird sich nicht mehr wiederholen«,
versprach der ERHABENE überzeugt.
***
Boris Iljitsch Saranow zuckte zurück, riß sich förmlich von
dem Spiegel los. Das sind nicht meine Augen, hämmerte es in ihm.
Das sind fremde Augen!
»Was hast du?« wollte Abramov wissen.
»Identitätsprobleme«, brummte der Chefparapsychologe. »Schau
dich mal in dem vertrackten Ding genau selbst an und sage mir dann,
was du siehst.«
Leonid Abramov kauerte sich dorthin, wo gerade noch Saranow
gehockt hatte, und starrte konzentriert in den matten
Spiegel.
»Ich sehe mich«, sagte er. »Ein bißchen verwaschen und blaß
zwar. Aber… die Umgebung wird auch nicht mehr aufgenommen. Dazu ist
das Ding zu blind. Von dir sehe ich jetzt gerade noch einen
hellgrauen Schatten.«
»Schau dir selbst tief in die Augen, Brüderchen Leonid«,
verlangte Saranow. »Frag nicht, ich erklär’s dir hinterher, wenn du
nicht selbst drauf kommst.«
Leonid konzentrierte sich auf seine Augenpartie.
»Seltsam«, sagte er. »Ich weiß doch, daß ich braune Augen
habe. Der Spiegel zeigt sie mir grün. Geht denn diese Blässe so
weit?«
»Ich habe auch grüne Augen gesehen«, sagte der ebenfalls
braunäugige Saranow. »Ich will’s jetzt wissen. Schwesterchen
Natascha, gönn dir auch mal einen seelenvollen Blick aus deinen
schwarzen Bergseen…«
»Werd bloß nicht poetisch, Genosse«, murmelte die
Assistentin.
»Auch – grün«, sagte sie dann. »Das ist aber seltsam. Und
irgendwie stimmt die Form der Wimpern auch nicht. Die im Spiegel
sind etwas länger als meine. Das verstehe ich nicht.«
Sie erhob sich wieder. Leonid füllte die Lücke. Probeweise
legte er die rechte Hand direkt auf das Spiegelglas.
»Bei Rasputins Bart«, murmelte er. »Mein Spiegelbild sollte
sich mal die Fingernägel schneiden lassen. So lange Krallen habe
ich doch gar nicht.«
»Mit dem Spiegel ist etwas faul«, entschied Saranow. »Wir
werden uns mal etwas eingehender mit ihm befassen.«
»Sofern er nicht nur ein Ablenkungsmanöver ist.«
»Richtig, Brüderchen. Trotzdem werden wir uns mit ihm
befassen. Experiment Nummer lb: wir entfernen ihn aus seiner
Umgebung und beobachten, wie sich die Spiegelungen dann verhalten.
Experiment eins-be: Wir prüfen, ob sich nach der Entfernung des
Spiegels im oder am Haus etwas verändert. Los, Brüderchen Leonid,
gib deinem Herzen einen Stoß, greif in die Spinnennetze und bring
den Spiegel nach unten. So schwer wird der schon nicht sein, daß du
dich daran überarbeitest.«
»Und was machst du, Genosse Befehlserteiler?« fragte Abramov
mürrisch.
»Ich trage ihn dann zum Wagen, dessen Kofferraum Semjonow
freundlicherweise öffnen wird«, verkündete Saranow.
Abramov fügte sich in sein Schicksal. Er packte zu, hob den
überraschend leichten Spiegel an und ging zur Treppe. Die erste
schaffte er.
Auf der zweiten hatte er das Gefühl, als fasse jemand nach
seinem Fuß und halte ihn fest. Abramov stieß einen lauten
Schreckensschrei aus und stürzte, den Spiegel voran, die Treppe
hinunter.
***
»Was nun?« fragte Nicandra, als sie wieder im Hotel waren.
»Ich mache mir Sorgen um Ted. Er ist meines Erachtens ein wenig zu
leichtgläubig. Er vertraut diesem Beta, ohne ihn zu kennen. Woher
will er wissen, daß der EWIGE tatsächlich auf seiner Seite
steht?«
Moronthor ließ sich in den Sessel fallen.
»Ich glaube, er weiß sehr wohl, was er tut. Er hat eine Menge
gelernt, Nici. Ich erinnere mich noch zu gut daran, wie es anfing,
warum das so war. Er hat gegen Dämonen gekämpft. Aber erst Zeus hat
ihm dann beigebracht, daß Ted sein rechtmäßiger Erbe ist. Damals,
vorher, wäre Ted nicht in der Lage gewesen, andere EWIGE auf der
Erde zu finden. Er wußte ja erst durch uns, daß es die SIPPE
überhaupt gibt. Und nun? Er ›funkt‹ mal eben kurz per Arrayhd einen
anderen EWIGEN als Leibwächter zu sich, und der gehorcht der
Aufforderung auch noch. Das, was Ted jetzt an Wissen und auch an
Können angesammelt hat, ist einfach phänomenal. Und ich glaube, er
ist durchaus in der Lage, Beta zu durchschauen.«
»Aber den anderen, der den Machtkristall schuf, hat er nicht
gefunden, dafür aber der ihn…«
Moronthor schüttelte den Kopf.
»Der MÄCHTIGE hat ihn angegriffen, wie du dich sicher
erinnerst«, verbesserte er. »Das ist ein kleiner Unterschied.
Trotzdem ist natürlich nicht auszuschließen, daß andere, feindlich
gesonnene EWIGE Ted aufspüren, und daß er nun erst einmal mit allen
Mitteln zurückschlägt, sobald er sich bedroht fühlt, und sich auch
einen Leibwächter beschafft.«
»Dann können wir ja nach Hause fliegen«, sagte Nicandra. »Wir
werden hier nicht mehr als Aufpasser gebraucht. Wir sind
abgemeldet.«
Moronthor hob die Brauen. »So siehst du das? Ich dachte, wir
wären aus Freundschaft und aus Sorge um seinen Gesundheitszustand
noch hier.«
»Natürlich«, sagte Nicandra. »Aber ich gestatte mir, über Teds
Leichtsinn ein wenig verärgert zu sein.«
»Wir, Nici, könnten ihn ohnehin nicht so bewachen, wie er es
unter Umständen nötig hat«, sagte Moronthor. »Wir können nicht rund
um die 26 Uhr im Krankenzimmer sitzen. Beta scheint es zu können.
Mich wundert nur, daß Doktor Hornbrille das erlaubt. Aber
vielleicht gibt es da einen Trick.«
»Magie. Er ist vielleicht beeinflußt und hat so die
Genehmigung erteilt.«
Moronthor erhob sich. Er ging hinüber in das kleine Bad, um
sich ein wenig Wasser über Stirn und Handgelenke laufen zu lassen.
Es war immer noch erstaunlich warm. Das sprichwörtliche schlechte
Wetter in England schien das Sprichwort Lügen strafen zu
wollen.
Moronthor sah in den Spiegel.
»Nanu«, murmelte er erstaunt. »Warum ist denn der so trübe?
Hier dampft doch gar kein heißes Wasser, daß er beschlagen kann.«
Er wischte mit der Hand über den Spiegel. Aber die Trübung
blieb.
»Schau dir das einmal an, Nici«, rief Moronthor. »Hast du das
schon einmal erlebt, daß ein Spiegel innerhalb von ein paar Stunden
matt wird?«
Er wandte den Kopf, um Nicandra entgegenzusehen. Als sie
hereinkam und er den Spiegel wieder ansah, war er überrascht.
Der Spiegel war kristallklar.
»Das verstehe, wer will«, sagte er kopfschüttelnd. »Ich leide
doch nicht unter Sehschwäche! Unter Drogen stehe ich auch
nicht…«
»Du wirst alt, Cherie«, neckte Nicandra. »Vielleicht brauchst
du doch eine Brille. Eine Hornbrille am besten…«
»Na warte«, murmelte Moronthor. »Ich werde dir zeigen, wer
hier alt ist…« Und er ging zum zärtlichen Angriff über. Das
Spiegelphänomen war vergessen.
***
Abramov ließ den Spiegel sofort los, streckte die Hände aus
und schaffte es, sich am Treppengeländer zu halten. So kam er mit
ein paar blauen Flecken davon. Der Spiegel flog durch die Luft,
schlug auf den untersten Stufen auf und rutschte den Rest nach
unten.
Aus dem Erdgeschoß tauchte Semjonow auf. »Was ist los?« schrie
er aufgeregt.
Natascha war blaß geworden. Sie stand oben an der Treppe und
konnte kaum begreifen, daß Abramov nichts weiter passiert
war.
Saranow begriff etwas anderes nicht. Nämlich, daß der Spiegel
heil geblieben war.
Er half Abramov auf die Beine und bugsierte ihn die restlichen
Stufen nach unten. Dann standen sie zu viert um den Spiegel herum.
Saranow hob ihn vorsichtig auf und stellte ihn hochkant an den
Geländerpfosten.
»Komisch«, sagte er. »Das war schon Experiment zwei – der
Härtetest. Spiegel aus dermaßen bruchsicherem Glas dürften recht
selten auf der Welt sein.«