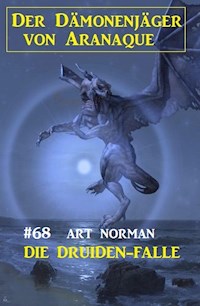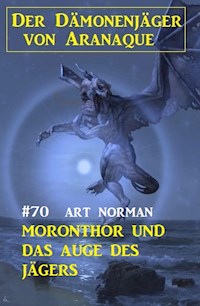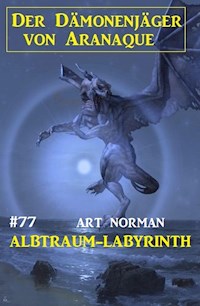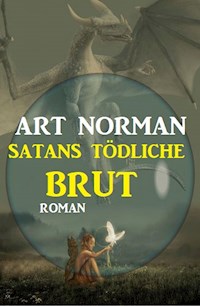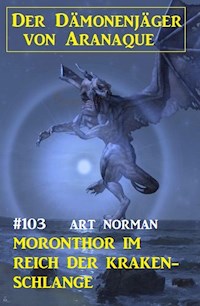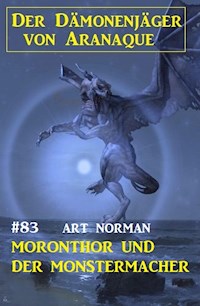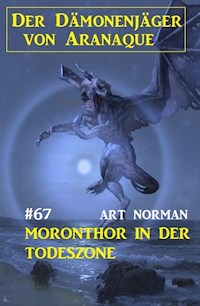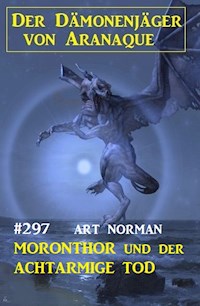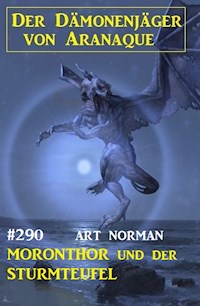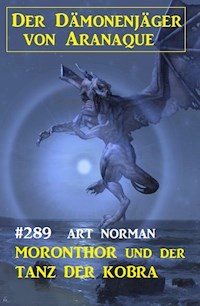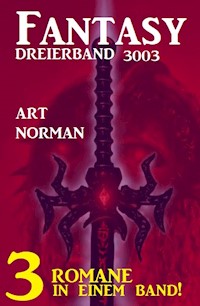Der Mann, der schwungvoll durch die Ladentür trat, war ein
Dämon. Der Inhaber des Geschäftes wußte das, aber es störte ihn
nicht. Viele seiner Kunden besaßen schwarzes Blut.
Seine kleine Modeboutique mit dazugehöriger Schneiderei war
ein Geheimtip unter den Angehörigen der Schwarzen Familie. Der
Besitzer fertigte Kleidung ganz besonderer Art an. Sie war magisch
behandelt und besaß zuweilen recht interessante
Eigenschaften.
Der Dämon, der einen bestellten Anzug abholte und wie jeder
normale Mensch bezahlte, um nicht aufzufallen, hatte für den
Schneider einen Tip.
»Sei auf der Hut«, sagte er. »Wir wollen dich nicht verlieren,
weil wir deiner Dienste noch lange bedürfen… sei vorsichtig. Gefahr
droht. Professor Moronthor ist in der Stadt!«
Damit glaubte er alles gesagt zu haben. Grußlos verließ er den
Laden. Nachdenklich sah der Schneider ihm nach.
Professor Moronthor, der Dämonenjäger! Da war wirklich höchste
Wachsamkeit geboten…
***
»Ich habe«, stellte Nicandra fest und machte damit das Problem
des Jahres deutlich, »nichts anzuziehen.«
Professor Moronthor lehnte sich weit im bequemen Sessel
zurück, schlug das rechte Bein lässig über das linke und
betrachtete seine Lebensgefährtin, Partnerin, Sekretärin und
Zusatzgedächtnis wohlgefällig.
»Das ist äußerst erfreulich«, sagte er.
»Gar nicht erfreulich«, protestierte Nicandra Darrell, hübsch,
schlank, langbeinig, aufregend, zur Zeit rothaarig und nur mit
ihrer Schönheit und ihrem ausgeprägten Selbstbewußtsein bekleidet.
»Ich kann doch nicht den ganzen Tag nackt draußen
herumlaufen.«
»Warum eigentlich nicht?« fragte Moronthor. »Du würdest etwa
fünfzig Prozent der hier ansässigen Menschen damit eine Freude
machen.«
»Grrr«, machte Nicandra.
Vor ihr auf dem breiten. Hoteldoppelbett lag der Inhalt von
insgesamt drei Koffern verstreut. Kleider, Blusen, Röcke, Hosen,
Shirts, Schuhwerk, diverse Reizwäsche…
Nicandra schüttelte den Kopf. »Das kann man wirklich nicht
anziehen«, sagte sie energisch. »Wirklich nicht. Moronthor,
Liebling«, flötete sie mit Unschuldmiene.
Der Parapsychologe wußte, was kam. Denn sehr zu seinem
Leidwesen entschloß sich Nicandra tatsächlich nicht dazu, nackt zu
bleiben. Ganz im Gegenteil.
Sie kam zu ihm, schmiegte sich mit in den Ledersessel und
kraulte sein Kinn. »Wenn du nachher deinen Vortrag hältst, könnte
ich doch die Zeit nutzen und ein wenig einkaufen…«
Moronthor seufzte. Genau das war es: einkaufen. Wenn die
Länderpacht von Château Aranaque im schönen Loire-Tal sowie eine
Reihe von Aktienpaketen nicht so viel Geld abwerfen würden, wären
ihre kostspieligen Reisen und Aktionen gegen die Mächte der
Finsternis längst an Geldmängeln gescheitert. Denn nur von den
Beträgen, die Moronthor für seine Gastvorlesungen an den
Universitäten erhielt, konnte Nicandras Einkaufsfimmel kaum
ausgeglichen werden.
Aber trotzdem oder gerade deshalb liebte er sie doch so.
Er nutzte die Gelegenheit und küßte sie ausgiebig, bis sie
atemlos wieder aufsprang. »Stop, Moronthor«, entschied sie. »Wenn
wir weitermachen, kommst du nicht zu deiner Vorlesung und ich nicht
zum Einkäufen…«
»Letzteres wäre wirklich ein Grund, weiterzumachen«, erkannte
Moronthor, sprang auf und sauste hinter Nicandra her. Aufjauchzend
ergriff sie vor ihm die Flucht, suchte hinter einem Tisch Deckung,
den Moronthor entschlossen beiseite räumte, und rannte in Richtung
Tür, »Weglaufen hilft nicht«, rief Moronthor und setzte ihr nach.
Nicandra wollte sich aber noch lange nicht ergeben, probierte
»Trick siebzehn« aus und verschwand durch die Tür, die sie
Moronthor vor der Nase zuzog, um sich dann gegen die Klinke zu
stemmen.
»Warte, ich kriege dich«, drohte Moronthor von drinnen.
Schepperndes Klirren und ein spitzer Aufschrei kamen von
draußen.
Nicandra fuhr erschrocken herum und ließ die Tür zu. Moronthor
fegte nach draußen und prallte mit ihr zusammen.
»Ach du blaues Einhorn«, entfuhr es Nicandra.
Im Eifer des Gefechtes hatte sie total übersehen, daß sie sich
nicht daheim im Château Aranaque befanden, sondern in einem
geradezu stinkvornehmen Hotel in San Francisco. Und die
perlenkettenüberwucherte ältere Lady, die gerade die Treppe
heraufkam, verkraftete naturgemäß den eigentlich reizenden Anblick
eines rothaarigen Nackedeis nicht. Aufschreiend geruhte Mylady in
Ohnmacht zu fallen, nicht ohne sich zu vergewissern, daß rein
zufällig ein Zimmerkellner in Griffnähe war, der sie auffangen
konnte. Daß der dabei ein Tablett mit Gläsern und Flaschen fallen
lassen mußte, interessierte die Dame dabei nicht. Tablett, Scherben
und mehr oder weniger alkoholische Flüssigkeiten bewegten sich nun
auf getrennten Wegen die breite Treppe hinunter und verursachten
einen ungebührlichen Lärm in den heiligen Hallen.
Moronthor betrachtete die Szene.
»Hilfe«, stammelte der Zimmerkellner entsetzt, der auch nicht
so genau wußte, was er mit den zwei Zentnern Ohnmacht in seinen
Armen anfangen sollte. Er sah Moronthor blaß an. »Sir, bitte…
könnten Sie vielleicht…«
»Wie Sie sehen«, schmunzelte Moronthor und deutete auf
Nicandra, »habe ich zu tun. Aber wenn Sie das Gewicht nicht mehr
aushalten, könnten Sie die Dame vielleicht auf den Teppich legen -
aber vorsichtig, von wegen der Quetschfalten.«
Die ältere Lady holte auf jaulend Luft. So ohnmächtig war sie
nun auch wieder nicht! Entschlossen kämpfte sie sich frei und
stampfte auf. »Unfaßbar!« keifte sie. »Muß ich mir so eine
Frechheit bieten lassen? Sie - Sie - Sie Ungeheuer! Mein Schirm! Wo
ist mein Regenschirm? Ich will sofort meinen Regenschirm
haben!«
»Bitte, äh… Madam… wofür? Draußen scheiht die Sonne«, brachte
der Zimmerkellner zögernd hervor.
»Schweigen Sie!« fuhr die Lady ihn an. »Ich will ihn diesem -
diesem Flegel über den Kopf schlagen!« Zeternd stampfte sie auf
Moronthor und Nicandra zu. Nicandra bedachte sie mit giftigen
Blicken. »Bedecken Sie sich! Dies ist ein anständiges Haus!«
»Richtig«, erwiderte Nicandra lächelnd. »Und deshalb ist auch
alles, was hier geschieht, anständig. Nicht wahr? Ein
phantastisches Kleid haben Sie da, es gefällt mir. Wo lassen Sie
arbeiten, wenn man fragen darf?«
Schlagartig verrauchte der Zorn der streitbaren Dame.
Hoheitsvoll ließ sie sich über die Kunstfertigkeiten der
Schneidermeister von heute aus, erwähnte diverse Adressen, die über
den ganzen Erdball verstreut lagen, und engte den Bereich
schließlich auf ihren Haus- und Hofschneider ein. Sprachlos hörte
Moronthor zu. Verstehe einer die Frauen, dachte er. Da stehen eine
dicke Dame und ein nacktes Prachtgirl auf dem Hotelflur und
unterhalten sich über Modeprobleme!
Der Zimmerkellner war nicht minder fassungslos.
Moronthor drückte ihm einen Zehn-Dollar-Schein in die Hand.
»Vergessen Sie’s«, sagte er, »und lassen Sie die Treppe säubern und
entsplittern. Falls Nicandra nämlich auf die Idee kommen sollte,
jetzt so nach unten zu gehen…«
Da endlich entschloß sich Nicandra, wieder in die
Abgeschiedenheit des Hotelzimmers zurückzukehren.
Freundlich lächelnd und winkend verabschiedeten sich die
beiden so ungleichen Geschlechtsgenossinnen voneinander. Die Lady
hatte dennoch nur einen vernichtenden Blick für Moronthor
übrig.
»Trotz Ihrer reizenden Gattin sind Sie ein Flegel, Mister«,
fauchte sie ihn an und betonte das »Mister« besonders
abfällig.
»Sie irren«, sagte Moronthor schon in der Tür.
»Parapsychologe, wenn Sie gestatten, nicht Flegel. Professor
Moronthor. Empfehlen Sie mich bitte weiter.«
»Ein akademischer Flegel, auch das noch!« ächzte Mylady.
»Nein, die Jugend von heute…«
Moronthor folgte Nicandra ins Zimmer. Nicandra warf sich in
den Sessel und begann zu lachen. »Ich werde verrückt«, sagte sie.
»So etwas… Himmel, die Frau muß in den Zirkus. Die Vorstellung war
bühnenreif! Gibst du mir einen Orangensaft?«
Moronthor öffnete die in die Wand eingebaute Kühlbox und
schenkte ein. »Aber mit diesem Auftritt wäre bewiesen«, sagte er,
»daß du eigentlich wirklich nichts anzuziehen brauchst…«
Nicandra nippte an dem Getränk.
»Geizkragen«, verkündete sie. »Du hast ja nur Angst, daß ich
ein bißchen Geld investiere. Die Wirtschaft muß angekurbelt
werden.«
»Du mußt patriotisch denken«, versuchte Moronthor es ein
letztes Mal. »Als Französin solltest du nicht die amerikanische,
sondern die französische Wirtschaft ankurbeln. Warte mit dem
Einkauf, bis wir wieder in Frankreich sind«, sagte er und fügte in
Gedanken hinzu: Bis dahin fällt mir vielleicht ein weiteres
Ablenkungsmanöver ein… Nicandra schüttelte den Kopf.
»Nichts da. Ich durchschaue dich. Du gönnst mir wieder mal gar
nichts. Trotzdem solltest du dich allmählich fertigmachen. In einer
Stunde beginnt dein Vortrag.«
»Ich«, sagte Moronthor. »Sicher. Ich muß mich fertig machen.
Wer sonst?« Er sah an sich herunter. Weißer Anzug, rotes Hemd,
Seidenschleife. Wenn hier jemand ausgehfertig bekleidet war, dann
war doch wohl er es.
Nicandra erhob sich wieder und begann in den auf dem Bett
verteilten Sachen zu wühlen. Schließlich entschied sie sich für
eine durchscheinende Spitzenbluse, weiße Jeans, die so eng waren,
daß sie fast einen Schuhanzieher dafür benötigte, ebenfalls weiße
Cowboystiefel und einen breitrandigen Hut. Unternehmungslustig
klatschte sie in die Hände.
»Wir können, Chef.«
Nichts anzuziehen, dachte Moronthor resignierend und genoß
ihren aufreizenden Anblick. Das nennt sie nichts anzuziehen… aber
versteh’ einer die Frauen!
Er verdrängte die dummen Gedanken, die sich in ihm ausbreiten
wollten, und konzentrierte sich auf die bevorstehende Arbeit. »Weck
schon mal Bill, das alte Faultier, und dann sehen wir zu, daß wir
zur Uni kommen…«
***
Der Mann sah nicht wie ein Dämon aus. Das war seine Stärke. Er
glich einem eleganten Manager eines Industriekonzerns, etwa Mitte
der dreißig, dunkelhaarig und hoch gewachsen.
Moronthor, dachte er. Moronthor ist in der Stadt. Unser
größter Gegner! Der Mann, dem wir unsere schlimmsten Verluste
verdanken…
Er überlegte. Es mußte eine Möglichkeit geben, Moronthor zu
vernichten oder wenigstens zu schwächen. Aber dabei mußte man sehr
vorsichtig zu Werke gehen. Moronthor war gefährlich.
Er war superstark und clever und würde sich nicht so leicht
hereinlegen lassen. Der Dämon, der sich Rod Kidney nannte, wußte,
wie viele seiner Artgenossen schon an Moronthor gescheitert waren.
Sie hatten geglaubt, spielend leicht mit ihm fertig zu
werden.
Und der Parapsychologe hatte sie alle irgendwie
hereingelegt.
Rod Kidney wußte, daß Moronthor über eine sehr starke Waffe
verfügte: das Amulett des Leonardo de Aranaque. Dieses Amulett
mußte zunächst entfernt werden. Das würde nicht einfach sein, denn
Moronthor pflegte es stets an seinem Körper zu tragen.
Man mußte es ihm gewaltsam entwenden…
Ein Überfall! Das war es. Ein paar Kriminelle mußten Moronthor
überfallen und ihn berauben. So mußte es gehen. War das Amulett
erst einmal aus dem Spiel, dann konnte Kidney sich daran machen,
mit Moronthor abzurechnen. Natürlich stellte er sich auch das nicht
leicht vor, denn Moronthor war mit allen Wassern gewaschen und
besaß auch so noch eine Menge an magischem Wissen und Tricks.
Ansonsten hätte er sich nicht so lange gegen die Schwarze Familie
halten können.
Mit ein bißchen Glück, überlegte Rod Kidney, müßte das aber zu
ändern sein. »Satan, steh mir bei«, murmelte er. »Dann will ich
diesem Moronthor an den Kragen gehen…«
Daran, daß er vor ein paar Stunden dem Schneider eine Warnung
zuflüsterte, dachte er schon gar nicht mehr. Er hielt es auch nicht
für bedeutsam.
Es gab Wichtigeres zu bedenken.
***
Der weiße Cadillac schwebte durch die Straßen von San
Francisco. Natürlich war Nicandra dafür verantwortlich, daß sie den
größten und teuersten der verfügbaren Mietwagen genommen hatten.
Seit sie vor ein paar Monaten ein Heckflossen-Cabriolet aus den
endfünfziger Jahren gekauft hatte, schwärmte sie für Cadillac. Und
so waren sie jetzt in einem solchen Gefährt unterwegs zur
Hochschule.
Bill Relokin fiel in all dem Weiß -Auto, Moronthor, Nicandra -
auf wie ein Papagei am Nordpol. In kurzärmeligem, knallbunten Hemd
und ausgewaschenen Jeans saß er am Lenkrad des großen Wagens. Der
blonde Historiker aus New York begleitete Moronthor und Nicandra
aus Freundschaft bei Moronthors Vortragsreisen durch die
Vereinigten Staaten. Oft genug hatten sie schon gemeinsam Kämpfe
ausgestanden, und der letzte lag noch gar nicht lange zurück. Bill
war nur zufällig dazu gekommen; er hatte gerade eine längere
Auslandsreise hinter sich. Moronthor wurde in die graue Vorzeit der
Erde verschlagen, und Bill und ein paar Freunde versuchten, ihn
zurück in die Gegenwart zu holen.
Mit Erfolg, wie man sah.
San Francisco war nun die letzte Etappe auf Moronthors
Vortragsreise. Bill, der noch ein paar freie Tage zur Verfügung
hatte, versuchte die beiden Gefährten zu einem kurzen Urlaub an
Kaliforniens weißen Stränden zu überreden.
Schließlich lenkte er den Wagen auf das Hochschulgelände. Die
beiden Männer stiegen aus. Bill wollte sich zwischen die Studenten
mischen. »Mal sehen, was du so zu sagen hast«, nickte er Moronthor
zu. »Die anderen Vorlesungen habe ich ja geschwänzt, um Nicandra
Gesellschaft zu bieten, aber sie kann ja dieses eine Mal auch
allein auskommen, nicht wahr?«
Nicandra nickte. »Wann soll ich euch abholen?« fragte sie und
glitt hinter das Lenkrad des Wagens.
Moronthor zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Ich weiß
nicht, wie lange die Diskussion nach der Vorlesung dauern wird, wie
üblich. Und vielleicht wird der Dekan auch noch mit mir fachsimpeln
wollen… weißt du was? Wir bestellen uns ein Taxi, wenn wir hier
fertig sind. Okay?«
»Okay«, flötete Nicandra. Moronthor beugte sich zu ihr hinab
und küßte sie.
»Jetzt aber Tempo«, drängte Bill. »Wir sind schon spät dran
und müssen auch noch dem Dekan einen Antrittsbesuch machen…«
Seufzend löste sich Moronthor von seiner Gefährtin. Nicandra
fuhr an. Der weiße Cadillac entschwebte förmlich. Die beiden Männer
sahen sich an, dann schritten sie auf das riesige Portal zu.
Nicandra steuerte die City an.
Die Würfel waren gefallen.
***
Der Dämon Rod Kidney saß den drei Männern gegenüber, die
keinen vertrauenerweckenden Eindruck machten. Kidney wußte jedoch,
daß sie ihn nicht enttäuschen würden. Sie konnten es nicht. Denn er
würde sie überall auf der Welt wiederfinden, falls sie versuchten,
ihn hereinzulegen oder einfach versagten.
»Dies ist der Mann«, sagte Rod Kidney und legte das große Foto
auf die runde Tischplatte in der Gaststube. Niemand sah dem Foto
an, daß es auf magischem Weg geprägt worden war. Nach Rod Kidneys
Erinnerung war das Abbild Moronthors entstanden. Kidney selbst
kannte Moronthor nicht, aber die exakte Beschreibung reichte ihm
aus, und Professor Moronthor selbst wäre verblüfft gewesen über die
Ähnlichkeit. Nur unwesentliche Kleinigkeiten stimmten nicht ganz,
aber sie reichten nicht aus, den Mann verwechseln zu können.
»Und?«, fragte Mills, der Wortführer der drei. Reggin und
Stakowsky lauschten nur.
Kidney beschrieb Moronthors Amulett. »Wahrscheinlich trägt er
diesen Gegenstand an einer Halskette vor der Brust. Ich brauche
diese Silberscheibe, koste es, was es wolle. Nehmt sie ihm ab,
prügelt ihn durch.«
Mills’ Gesicht blieb ausdruckslos. »Kleinigkeit, Boß. Was,
wenn wir nicht verhindern können, daß er draufgeht?«
Der Dämon grinste.
»Ich nehme zwar nicht an, daß ihr das schafft - aber traurig
wäre ich auch nicht darüber. Haben wir uns verstanden?«
»Noch nicht ganz«, sagte Mills und hielt die Hand auf. Einen
Preis nannte er nicht. Er setzte voraus, daß Kidney Bescheid
wußte.
Kidney griff in die Tasche. Durch dämonische Magie entstanden
gerade in diesem Moment dort einige Geldscheine. Sie würden genau
vierundzwanzig Stunden existieren und dann einfach zerfallen. Dann
aber sollten die drei Burschen kommen und Ersatz fordern!
Kidney lächelte. Er zählte jedem der drei Männer zwei
Tausender in die Hand. »Das wird reichen«, sagte er. »Heute abend,
bis Mitternacht, erhalte ich von einem von euch dreien
Besuch.«
Mills nickte.
»Noch etwas, was wir wissen müßten, Boß?«
Als Kidney den Kopf schüttelte, erhoben sich die drei Männer
wie Drillinge und verließen die Gaststätte. Kidney blieb mit der
Rechnung zurück. Draußen summte der Motor eines schwarzen Buick
auf.
Der Dämon war zufrieden. Professor Moronthor würde mit allem
rechnen -nicht aber mit einem ganz stinknormalen Raubüberfall.
Kidney wußte, daß er mit diesem Vorgehen gegen den dämonischen
Kodex verstieß, magische Gegner nur mit Hilfe der Magie
anzugreifen, aber wenn er Erfolg hatte, würde man ihm dies
nachsehen. Wichtig war, daß Moronthor wenigstens geschwächt
wurde.
Spätestens um Mitternacht wußte Kidney mehr…
***
Nicandra Darrell brauchte nicht sonderlich weit zu fahren. Sie
ließ den Cadillac dicht am Straßenrand langsam dahingleiten, und
dabei spähte sie nach den Geschäften, die für sie von Interesse
waren.
Anfangs gab es nur Privathäuser. Dann aber, als sie dem
Stadtzentrum ganz allmählich näher kam, tauchten die ersten
kleineren Läden auf. Hier gab es alles mögliche und unmögliche zu
kaufen, und plötzlich sah Nicandra das Hinweisschild auf eine
kleine Modeboutique.
Normalerweise war sie äußerst wählerisch und ließ so manchen
Laden links liegen, wenn schon der äußere Eindruck ihr nicht
behagte. Hier aber verriet ihr eine innere Stimme, daß sie richtig
war.
Sie glaubte nebenbei auch noch das kleine Schild gesehen zu
haben, das auf eine »eigene Schneiderei« hinwies. Das war dann
natürlich etwas ganz besonders Feines. Hier ließen sich exklusive
Modelle erstehen.
Sie hielt nach einer Parkmöglichkeit Ausschau. Aber da war
nichts. Der Straßenrand war von anderen Fahrzeugen bereits
gespickt, und ein Streifenpolizist äugte bereits mißtrauisch
herüber; wahrscheinlich wartete er nur darauf, seiner Beförderung
durch einen weiteren Strafzettel wieder einen Schritt näher zu
kommen. Nicandra lächelte. Sie konnte ja ein Stück zurückgehen,
wenn sie nicht hier direkt einen Parkplatz fand.
Endlich tauchte ein Hinweisschild auf. Ausnahmsweise kein
Parkhaus, sondern eine große Abstellfläche, nicht einmal
gebührenpflichtig. Nicandra lenkte den großen Straßenkreuzer auf
die Fläche und parkte lässig quer über zwei Stellflächen ein.
»Breit sein ist alles«, murmelte sie, schaltete Klimaanlage
und Motor ab und stieg aus. Sorgfältig schloß sie den Wagen ab. Man
hörte in den letzten hundert Jahren so viel von Autodiebstählen
überall auf der Welt…
Nicandra reckte sich im strahlenden kalifornischen
Sonnenschein, rückte den Cowboyhut leicht zurecht und setzte sich
in Bewegung. Der dunkelhäutige, breitschultrige Polizist, der
vorhin sein Interesse dem weißen Cadillac widmete, zeigte sich
jetzt an Nicandra selbst nicht weniger interessiert und nickte ihr
freundlich zu.
Nicandra grüßte zurück und setzte ihren Weg fort. - Ein paar
Menschen kamen ihr entgegen oder überholten sie, doch es hielt sich
in Grenzen. Hier war nicht sonderlich viel los. Das große Gewühl
ging erst ein Stück weiter stadteinwärts los.
Aber da konnte man mit dem Einkaufsbummel ja anschließend
weitermachen.
Nach einer Weile erreichte Nicandra den kleinen Laden. Der Weg
war doch weiter, als es vom Auto her aussah. Aber nun war sie
da.
Rechts und links der kleinen Tür gab es Schaufenster. Sie
waren phantasievoll dekoriert, mit künstlichen Pflanzen, Postern
und Tierpräparaten. Dazwischen, dem jeweiligen Landschaftsteil
angepaßt, standen die Puppen in Kleidern und Anzügen.
Sie sahen verblüffend lebensecht aus. Nicandra vertiefte sich
in den Anblick. Sechs Puppen waren es, in jedem Fenster drei. Der
sie geformt hatte, mußte ein genialer Künstler sein. Die Puppen
befanden sich in erstarrter Bewegung. Es sah fast so aus, als
lebten sie, als wären sie mitten in der Bewegung eingefroren.
Als hätte jemand die Zeit angehalten.
Die Kleidung, die sie trugen, war wunderschön. Der Schneider
mußte nicht minder genial sein als der Puppenmacher. Nicandra war
sicher, daß sie hier fündig wurde.
Entschlossen trat sie durch die Glastür. Ein Glöckchen
bimmelte.
Der Laden war von anheimelndem, romantischen Licht erfüllt.
Nicandra konnte allerdings keine Lampen erkennen. Sie lagen gut
versteckt hinter Halbvorhängen und Regalen. Ein breiter Ladentisch
prangte in der Mitte des Raumes, geziert von einer
vorsintflutlichen Registrierkasse mit Handkurbel. Auch hier standen
Blumen. An den Wänden wechselten sich Regale mit Kleiderständern
ab. Die ausliegenden Stücke waren nicht zahlreich, waren aber sehr
erlesen. Zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, standen am Fenster.
Nicandra wollte sie schon ansprechen, als sie erkannte, daß es sich
ebenfalls um Puppen handelte. Leise pfiff sie durch die Zähne und
sah sich weiter um.
Hinter dem Ladentisch führte eine halb offene Tür in den
hinteren Teil des Ladens. Wahrscheinlich wirkte dort der Meister
selbst mit Nadel und Zwirn. Nicandra rief leise: »Hallo?«
»Ich komme ja schon«, krächzte jemand aus dem angrenzenden
Raum. Asthmatisches Keuchen ertönte, und dann erschien ein altes,
verhutzeltes Männchen mit Kahlkopf und Hornbrille. »Ein alter Mann
ist kein Eilzug. Entschuldigen Sie, Miß. Womit kann ich Ihnen
dienen?«
Er sah Nicandra prüfend an und lächelte. Ein seltsames
Glitzern trat in seine Augen.
»Ah, warten Sie. Sagen Sie nichts«, rief er. »Ich zeige Ihnen
etwas. Gerade vor ein paar Minuten fertig geworden. Es wird Ihnen
gefallen. Ein Einzelstück. Warten Sie.« Er wieselte wieder zurück
in die Schneiderei. Nicandra hörte ihn brabbeln und kramen, und
dann tauchte er wieder auf. Er breitete ein Kleid auf dem
Ladentisch aus.
»Gefällt es Ihnen?« fragte er.
Nicandra traten fast die Augen aus dem Kopf. Sie war
sprachlos.
Natürlich gefiel es ihr!
Es war ein Meisterwerk und stellte alles in den Schatten, was
sie bisher jemals gesehen hatte. Unfaßbar einfach und doch
raffiniert geschnitten, aus einem fließendweichen,
einschmeichelnden Stoff. Vorsichtig streckte Nicandra die Hand aus
und strich leicht darüber. Der Stoff war warm, schien zu leben und
sich ihr entgegenzustrecken. Sie kannte das Material nicht, hatte
niemals etwas Ähnliches berührt.
»Was ist das?« fragte sie.
Das Glitzern in den Augen des Hutzelmännchens verstärkte sich.
»Das ist mein Geheimnis«, krächzte der Schneider. »Ich fertige
diesen Stoff selbst an. Schauen Sie.« Er nahm das ärmellose Kleid,
das eine Schulter freiließ, und hielt es vor eine der beiden Puppen
am Seitenfenster. »Was sagen Sie, Miß?«
»Ich bin überwältigt«, stellte Nicandra fest.
Sie wußte jetzt, daß sie es haben mußte, um jeden Preis. Und
wenn es tausend Dollar kostete. Aber sie wagte in diesem Moment
nicht nach dem Preis zu fragen, um die traumhafte Stimmung nicht zu
stören.
Der Stoff glitzerte so eigentümlich wie die Augen des
Schneiders. Doch die Ähnlichkeit fiel ihr nicht auf. Sie sah nur
das Kleid und spürte unbändiges Verlangen, es auf der Haut zu
tragen.
»Ich möchte es anprobieren«, bat sie.
»Bitte, Miß«, dienerte der Verhutzelte und deutete auf die
Umkleidekabine, die durch eine schulterhohe Schwingtür betreten
werden konnte. Vorsichtig, als könne sie es durch die Berührung
beschädigen, nahm Nicandra das Kleid entgegen und betrat die
Kabine.
Der Schneider sah ihr nach, und sie glaubte so etwas wie
sehnsüchtiges Begehren nach ihrer Schönheit zu erkennen. Lächelnd
stieg sie aus den Stiefeln, streifte die Bluse ab und legte sie
über die Kante der hölzernen Pendeltür. Dann folgte die weiße
Jeans, die so eng saß, daß der winzige Traum aus sündiger Spitze
und schmalem Bändchen gleich mit ging. Kurz zögerte Nicandra, dann
beschloß sie, der begehrlichen Phantasie des Schneiderleins
Auftrieb zu schenken und präsentierte auch diese letzte Hülle
seinem Blick. Sollte er auf zu dumme Gedanken kommen - nun, dann
würde sie sich zu wehren wissen.
Langsam griff sie nach dem Kleid, genoß den weichen Stoff und
streifte ihn über. Er umfloß ihren Körper und schmiegte sich eng an
ihre bloße Haut. Es war ein traumhaftes Gefühl. Nicandra
betrachtete sich im Spiegel. Das Kleid zeichnete die Konturen ihres
Körpers hauteng nach, paßte sich förmlich an.
Ich muß es haben, dachte sie. Egal, was es kostet.
Sie trat wieder in den Laden und drehte sich einmal um sich
selbst. »Na?« fragte sie.
»Großartig«, gestand das Hutzelmännchen. »Gerade, als hätte
ich es eigens für Sie geschneidert, Miß. Es paßt wunderbar und
steht Ihnen hervorragend. Sie sollten einen Karatekurs besuchen.
Die Männer werden sich förmlich um Sie prügeln, wenn mir diese
Bemerkung erlaubt ist.«
»Oh, ganz so schlimm wird es hoffentlich nicht sein«, wehrte
Nicandra ab. »Es gefällt mir, und ich nehme es. Kann ich es direkt
anbehalten?«
Der Gesichtsausdruck des Schneiders änderte sich.
Gerade noch zeigte er höfliches Lächeln, jetzt aber schien es
Nicandra ein gräßliches, fratzenhaftes Grinsen zu sein. Er
kicherte, und in seinen Augen glitzerte es bösartig.
»Es wird dir wohl nichts anderes übrigbleiben, als es direkt
anzubehalten, Nicandra Darrell«, kreischte der Verhutzelte.
Nicandra erschrak. »Was soll das?« stieß sie hervor.
Sie sah, wie sich die Finger der rechten Hand des Mannes
bewegten und eine seltsame Stellung einnahmen. Sie kannte
sie.
Entsetzen sprang sie an wie ein wildes Tier.
Dämonen werk! Böser Zauber schlug zu!
Ahnungslos war sie in eine Falle gegangen!
Aber woher wußte der Schneider, wer sie war? Sie hatte ihn
doch niemals zuvor gesehen!
Sie wollte herumwirbeln, den Laden verlassen. Sie spürte die
Gefahr, die von allen Seiten auf sie zuraste und nach ihr griff,
wollte noch flüchten.
Aber dazu war es schon zu spät.
Die Falle schlug zu!
***
»Na, wie war’s?« fragte Professor Moronthor. »Wie fühlt man
sich, so unter einem Haufen Studenten?«
Bill Relokin kratzte sich hingebungsvoll im Genick. »Alt«,
sagte er. »Sehr alt.«
Normalerweise stand er selbst, wenn er nicht gerade auf
Forschungsreisen war, selbst in Hörsälen hinter dem Pult und hielt
Vorlesungen und Seminare ab. Er besaß einen Lehrstuhl an der
Harvard-Universität. Aber die meiste Zeit verbrachte er mit
Forschungen - und damit, ähnlich wie Moronthor oder häufig mit
diesem zusammen, dämonischen Erscheinungen nachzuspüren und sie zu
bekämpfen.
Die letzten Studenten verließen den Hörsaal. Zu Moronthors
Überraschung hatte es in der abschließenden Diskussion kaum Fragen
gegeben. Doch das mochte daran liegen, daß es ein Freitagnachmittag
war und jeder nur von dem Wunsch beseelt war, so schnell wie
möglich nach Hause zu kommen.
Der Dekan des Fachbereichs Psychologie, der an dem Vortrag
ebenfalls teilgenommen hatte, schüttelte Moronthor die Hand und
murmelte eine Einladung zum festlichen Abendessen. Moronthor war
froh, daß sich die Unterhaltung nicht direkt an die Vorlesung
anschloß. Er verabschiedete sich und strebte mit Bill Relokin dem
Ausgang zu, nachdem der Dekan versichert hatte, ein Taxi
herbeizuordern.
Dann warteten die beiden Freunde draußen in der Nähe der
Haupteinfahrt.
»Sag mal«, brummte Bill. »Diese Weridar-Fragmente, die du so
ganz nebenbei erwähntest - ich kenne mich ja ziemlich in der
antiken Weltgeschichte aus, aber ein solcher Fund ist mir bislang
noch nicht untergekommen.«
»Sie sind eigentlich auch nicht weltbewegend«, sagte
Moronthor. »Ich weiß selbst nicht ganz genau, woher sie nun stammen
und wer sie ausgrub. Die einzige Ausfertigung, die je entdeckt
wurde, befindet sich allerdings in meiner Sammlung. Schwer zu über
setzen. Ich selbst habe größte Schwier igkeiten damit, zumal es
sich nun eben tatsächlich auch nur um Fragmente handelt.«
»Nicht weltbewegend?« knurrte Bill Relokin. »In unserem Metier
ist alles weltbewegend.«
»Ich weiß«, sagte Moronthor. »Ich gehe aber vom Standpunkt
anderer, unbeteiligter Leute aus…«
Ein Taxi tauchte auf und unterbrach die Unterhaltung.
»Paß auf«, sagte Bill plötzlich, während sie in dem gelben
Chevy stadteinwärts fuhren. »Ich kenne mich ein wenig in diesem
Bezirk aus. Direkt hier an der Ausfallstraße gibt es ein kleines,
gemütliches Lokal. Ein Spezialdrink nach geheimen Rezepten… wenn
wir schon mal hier sind, laß dich einladen… das Stöfflein ist
einmalig, gibt’s nur hier und sonst nirgends auf der Welt…«
Bill schnalzte genießerisch mil der Zunge.
Moronthor kannte seinen Freund Der war alles andere als ein
Alkoholiker, und wenn er von einem Getränk besonders schwärmte,
dann mußte wirklich etwas dran sein.
»Okay. Da Nicandra ohnehin noch lange nicht mit ihrem
Einkaufsbummel fertig sein wird…«
»Na, dann wollen wir mal«, sagte Bill. »Da hinten ist das
Lokal schon. Eh, Mac… halten Sie bitte. Wir steigen aus.«
Beide ahnten nicht, in was sie damit hineinschlitterten…
***
Nicandra erstarrte mitten in der Bewegung. Sie war plötzlich
nicht mehr in der Lage, einen Fuß vor den anderen zu setzen.
Etwas explodierte in ihr!
Sie wollte aufschreien und konnte es nicht! Selbst ihre
Stimmbänder waren gelähmt!
Feuer durchraste sie.
Feuer, das brannte und schmerzte. Feuer, das dem Gewebe des
Kleides entströmte. Entfesselte schwarze Magie, durch die
beschwörende Handbewegung des dämonischen Schneiders geweckt!
Blaue und rote Flammen schlugen aus den Gewebefasern hervor
und umflossen Nicandra. Von einem Moment zum anderen wurde sie eine
Fackel. Aber das Feuer zerstörte sie nicht!
Es schmerzte nur und lähmte sie!
Dann wich das Höllenfeuer. Die Flammen erloschen, aber dafür
breitete sich jetzt Kälte in Nicandra aus. Sie entstand überall
zugleich, floß aus den Adern hervor und durchströmte sie zur
Gänze.
Kälte, die noch schlimmer war als das Feuer!
Und auch die letzte Möglichkeit, sich zu bewegen, wurde
Nicandra genommen! Sie versteinerte, als habe sie in Medusas
Antlitz geschaut.
Das war die dämonische Falle…
Da tauchte der Schneider vor ihr auf. Er grinste immer
noch.
»Ja, meine liebe Nicandra Darrell«, kicherte er. »So einfach
geht das, die Gefährtin des berüchtigten Dämonenjägers
kaltzustellen…«
Woher kennt er mich? fragte sie sich erneut und stellte fest,
daß auch ihre Gedanken viel langsamer abliefen als früher.
Der Schneider rieb sich die Hände.
»Ich erfuhr, daß Moronthor in der Stadt ist«, erklärte er
ungefragt. »Und wo Moronthor ist, da ist Nicandra Darrell nicht
fern! Na, ist das nicht ein schwerer Schlag für ihn, dich so zu
verlieren? Und er wird nicht einmal ahnen, was mit dir
geschah…«
Nicandra stöhnte innerlich, aber kein Laut wurde hörbar.
Moronthor! Er wußte nicht, wo sie sich befand! Er würde zwar nach
ihr suchen - aber San Francisco ist groß! Und wenn, würde er seine
Nachforschungen in der Innenstadt beginnen, in den großen
Einkaufszentren…
Sie hatte kaum eine Chance!
»Du ahnst es«, kicherte der Schneider. »Es ist das Kleid, das
dich lähmt… ja, ich habe es eigens für dich angefertigt und
gehofft, daß du den Weg zu mir findest… ja, du hast mich nicht
enttäuscht. Von nun an wirst du mir nützlich sein. Ist das nicht
herrlich? Die größte Feindin der Dämonen als unentrinnbare,
nützliche Gefangene eines Dämons… gni-hihi…«
Nicandras Verwünschungen kreisten als träge Gedanken.
Der Dämon streckte die Hand aus. Seine Finger berührten
Nicandras Gesicht. Sie spürte nichts. Ihre Tastsinne waren
blockiert. Die Kälte überlagerte alles, aber irgendwie merkte sie,
daß sich etwas veränderte. Der Dämon glättete ihre entsetzten,
erstarrten Gesichtszüge, zauberte ein verlorenes Lächeln auf ihre
Lippen. Und sie konnte sich nicht dagegen wehren!
Dann griff er zu.
Sie war zwar nicht sonderlich schwer, aber sie hätte es nicht
für möglich gehalten, mit welcher Leichtigkeit das Hutzelmännchen
sie anhob und von der Stelle trug. Plötzlich fand sie sich im
Schaufenster wieder, wo sie unbeweglich stand und in die Feme
schaute.
Schlagartig begriff sie.
Die Schaufensterpuppen waren nicht lebensecht gestaltet - sie
lebten! Sie lebten auf die gleiche Weise wie auch Nicandra: zur
Bewegungslosigkeit verdammt, versteinert! Sie waren Menschen wie
sie.
Opfer des Dämons!
Aber was bezweckte er damit? Sie konnte sich nicht vorstellen,
daß er die Menschen aus reinem Sammlertrieb hier einfing,
versteinerte und aufstellte. Es mußte mehr dahinterstecken.
Ich muß es herausfinden, dachte sie.
Aber ein anderer Gedanke wurde stärker: was nützt es mir? Was
kann ich noch damit anfangen? Ich bin verloren wie die
anderen…
Hinter ihr im Laden kicherte der Dämon, der Nicandras
Kleidungsstücke aus der Kabine aufsammelte und
davonschleppte.
Es gab keine Spuren des unheimlichen Ereignisses mehr…
***
Der dunkelhäutige Streifenpolizist setzte seinen Weg fort. Das
rothaarige Mädchen in der aufregenden weißen Kleidung ging ihm
nicht aus dem Sinn. Er träumte von ihr, und er träumte gern in
einer Zeit, in der es kaum etwas zum Träumen gab.
Hatte sie nicht am Lenkrad des weißen Cadillacs
gesessen?
Er ging weiter, sah nach hier und dort und sorgte allein durch
seine breitschultrige, massige Erscheinung für Ruhe und Ordnung.
Nach einer Weile erreichte er auch den freien Parkplatz.
Da sah er den Cadillac.
Er änderte seine Marschrichtung und schlenderte auf den großen
Wagen zu. Kopfschüttelnd stellte er fest, daß das Fahrzeug zwei
Stellflächen einnahm. Das mußte ja wirklich nicht sein, bei aller
Schönheit der Fahrerin!
Aber Cal Lewis, der Polizist, war auch nur ein Mensch mit
menschlichen Schwächen. Er brachte es nicht übers Herz, eine
Verwarnung zu schreiben. Stattdessen rupfte er ein Blatt aus seinem
Notizblock, malte ein paar Blümchen darauf und fügte einen lustigen
Vierzeiler hinzu, in dem er die Fahrerin auf ihr gar schreckliches
Parkvergehen aufmerksam machte.
Aber dann blieb er doch erst mal eine Weile am Wagen stehen.
Vielleicht kam die rothaarige Schönheit ja schon bald zurück, und
vielleicht ergab sich ein kleiner Wortwechsel und eine
Bekanntschaft. An Selbstbewußtsein mangelte es Lewis nicht. Daß
zwischen seinem kleinen Polizistengehalt und einer
Cadillac-Fahrerin unüberbrückbare soziale Schranken standen,
berührte ihn kaum.
Er wartete.
Aber die Fahrerin kam nicht zurück.
Schulterzuckend heftete er den Zettel, weil die
Scheibenwischer versenkt und nur schwer erreichbar waren, mittels
eines Klebestreifens an die Windschutzscheibe und schlenderte sehr
langsam weiter. Immer wieder sah er sich um. Aber sein rothaariger
Traum tauchte nicht auf…
***
Der Dämonenschneider betrachtete zufrieden sein Werk. Sie war
eine erlesene Schönheit, seine neue Schaufensterpuppe! Und nicht
nur das. Sie war eine ausgezeichnete Lebensspenderin, denn sie war
noch jung.
Nicandras Verdacht stimmte. Der Schneider bezweckte etwas mit
seinem Tun. Es ging ihm nicht nur darum, Menschen einzufangen und
ihnen dieses grausige Schicksal zu bereiten.
Er konnte nämlich mit diesen Puppen etwas anfangen…
Sie waren nur äußerlich erstarrt. Innen pulsierte weiterhin
das Leben. Und das war es, worum es ihm ging. Er brauchte die
Lebensenergien.
Von Zeit zu Zeit zapfte er sie diesen Puppen ab und führte sie
sich selbst zu. Auf diese Weise lebte er schon seit vielen
Jahrhunderten unter wechselnden Namen an verschiedenen Orten.
Einst war er jung und schön gewesen. Dann begann er sich mit
schwarzer Magie zu beschäftigen. Er alterte dabei unheimlich
schnell, weil er seine Kräfte schneller verbrauchte, als er sich
davon erholen konnte. Doch die Bösartigkeit und Grausamkeit, die in
ihm lauerte, machte den Fürsten der Finsternis auf den Schneider
aufmerksam.
Asmodis selbst machte ihn zum Dämon.
Er rieb sich die Hände. Für ein paar Monate brauchte er keine
Falle mehr zu stellen. Es war nicht gut, wenn in kurzen Abständen
Menschen verschwanden. Langsam vorgehen, war seine Devise. So blieb
er unauffällig und unangetastet.
Er sah in den Spiegel, betrachtete sein runzliges Gesicht. Oft
schon hatte er gehofft, die Falten wieder glätten zu können, doch
stets ging ihm der Versuch daneben. Denn in zu häufigen Abständen
erhielt er Aufträge, magisch aktive Kleidung für andere Dämonen zu
fertigen. Und in jedem Stück, das er auf diese Weise schuf, war
auch ein Stück von ihm.
Jetzt aber…
Diese Nicandra Darrell barst förmlich vor Lebensenergie.
Vielleicht konnte er mit ihr experimentieren und versuchen, endlich
nach so vielen Jahrhunderten nicht nur eine Lebensverlängerung zu
erreichen, sondern gar die erhoffte Verjüngung!
Zumindest wollte er es versuchen.
Zunächst aber kehrte er wieder in seine Schneiderei hinter dem
Laden zurück und begann, Nicandras Sachen zu beseitigen. Nichts
Verräterisches durfte bleiben. Denn der Zufall konnte wollen, daß
doch einmal jemand hier nachschaute…
Der Dämon war übervorsichtig.
Deshalb existierte er immer noch. Und er wollte auch weiterhin
existieren. Darum ging er kein Risiko ein.
Selbst wenn dieser Moronthor persönlich hier auftauchte -
würde er nichts finden…
***
Im »Fisher’s Inn« hatten Moronthor und Bill Relokin den
»Fisher’s special« genossen. »Hier kann man Stammgast werden«,
versicherte Moronthor, der sich nicht erinnern konnte, ein
ähnliches Getränk jemals irgendwo anders kredenzt bekommen zu
haben. »Mein lieber Bill, ich glaube, daß wir mit Nicandra heute
abend ein zweites Mal hier vorsprechen werden…«
Bill grinste. »Heute abend ist Gala-Diner bei Professors«,
erinnerte er. »Der Dekan gibt eine Portion Pommes frites mit
Ketchup und zwei Hamburgers aus.«
»Zynikus«, murmelte Moronthor. »Laß uns gehen, ehe ich noch
einen« special »bestelle und hinterher fahruntüchtig bin…«
»Von zwei Drinks?« staunte Bill.
Moronthor lächelte. »Man muß genießen, und der größte Genuß
ist es, wenn man sich dabei beherrschen kann…«
Einige Minuten später hatte San Franciscos
Spätnachmittagssonne sie wieder. »Laß uns ein wenig schlendern und
nach einem vorüberfahrenden Taxi Ausschau halten«, schlug Bill vor.
Offenbar hatte er heute seinen gemütlichen Tag.
Moronthor hing seinen Gedanken nach. Es zog ihn wieder nach
Frankreich in sein Schloß. Die Vortragsreise war lang gewesen, und
er sehnte sich wieder nach ein wenig heimischem Boden. Und er
wußte, daß es Nicandra genauso erging. Sie waren zwar beide die
geborenen Weltenbummler und überall zuhause, und dennoch gab es
etwas, das sie immer wieder nach Frankreich zurückzog.
Wieviel Geld mochte Nicandra inzwischen ausgegeben haben auf
ihrem Einkaufstrip? Kleider und Perücken übten einen
unwiderstehlichen Reiz auf sie aus.
Neben ihnen tauchte ein kleiner Laden auf. Boutique und
Schneiderei… Moronthors Blick wanderte über die Auslagen,
registrierte die Schaufensterpuppen… erstaunlich, wie lebensecht
die aussehen!
»Schau mal, Bill«, machte er den Freund darauf aufmerksam.
»Hübsch gemacht, nicht wahr?«
Bill Relokin pfiff durch die Zähne. »In der Tat«, sagte er.
»Wenn Nicandra diesen Laden sähe, würde sie schnurstracks
hineinspazieren…«
»Das Kleid da«, sagte Moronthor und deutete auf ein einfach
und doch raffiniert geschnittenes Stück aus eigenartig schimmerndem
Stoff. »Das würde sogar zu ihr passen, würde ihr gut stehen… ob ich
mal hineingehe und es ihr kaufe?«
»Sag mal, spinnst du?« fragte Bill trocken. »Schon genug, daß
sie Geld ausgibt, als käme es morgen außer Mode, und nun willst du
auch noch damit anfangen? Aber kein Wunder, daß du auf die Idee
kommst… die Puppe hat ja eine verblüffende Ähnlichkeit mit
Nicandra.«
Moronthor war es auch schon aufgefallen. Die Ähnlichkeit hatte
ihn ja erst besonders auf dieses Kleid aufmerksam gemacht.
Er beschloß, Nicandra immerhin darauf aufmerksam zu machen.
Vielleicht konnte man diese so verblüffend ähnliche Puppe sogar dem
Ladenbesitzer abkaufen und als Erinnerung mit nach Frankreich
nehmen…
Er sah in die Runde, prägte sich die Umgebung der Boutique
ein, um sie auch wiederzufinden, und setzte dann den Weg
fort.
Sie kamen zehn Meter weit.
Da erfolgte der Überfall!
***
Der Dämonenschneider war unruhig. Moronthor war in der Nähe!
Er hatte sogar das Schaufenster betrachtet! Wußte er bereits, was
geschehen war?
Niemals hätte der Schneider damit gerechnet, daß Moronthor
hier auftauchen würde. Aber er hatte ihn eindeutig erkannt. Er war
es, so wie die neue Puppe im Fenster Nicandra Darrell war!
Der Schneider klammerte sich daran, daß es Zufall sein mochte.
Denn Moronthor konnte einfach noch nicht herausgefunden haben, was
mit seiner Gefährtin geschehen war, und wo sie sich befand!
Es mußte ein Zufall sein.
Ansonsten war er selbst in höchster, in allerhöchster
Gefahr!
Daß Moronthor weitergegangen war, beruhigte ihn nicht im
Geringsten. Es konnte ein Trick sein, ihn in Sicherheit zu wiegen.
Er würde zurückkehren in einem Moment, -in welchem der Schneider
schon gar nicht mehr daran dachte!
Er mußte Vorkehrungen treffen. Er durfte sich nicht von
Moronthor überraschen lassen, zumal er nicht die Fähigkeit besaß,
die Gedanken anderer zu lesen und daraus zu erkennen, in welcher
Form sie ihn angreifen würden.
Der Schneider sah aus dem Fenster. Moronthor war nicht mehr zu
entdecken. Aber er war da, irgendwo in der Nähe…
Vielleicht war es doch ein Fehler gewesen, sich um seine
Gefährtin zu kümmern. Vielleicht hätte er vorher gründlicher planen
und alle Möglichkeiten berechnen sollen. Sich absichern und
schützen…
Jetzt - mußte alles schnell gehen. So schnell, wie er das
Geschehen eingeleitet hatte. Er mußte einen Schutzzauber
wirken.
Der Dämon murmelte eine Verwünschung. Die Kraft, die er für
seine Verjüngung ausersehen hatte, würde wohl hierbei verbraucht
werden…
»Moronthor«, murmelte er. »Wenn ich dich doch töten könnte…
oder in eine meiner Puppen verwandeln…«
Aber war Moronthor dafür nicht zu stark?
***
Auch Nicandra, die Puppe, sah Moronthor, so wie er sie sah,
aber nicht erkannte!
Sie begann innerlich zu vibrieren. Moronthor und Bill standen
vor dem Schaufenster, sahen sie an und deuteten auf sie! Fiel ihnen
denn nichts auf? Bemerkten sie denn nicht, daß diese
Schaufensterpuppe Nicandra Darrell war?
Nicandra verzweifelte innerlich. Es mußte doch eine
Möglichkeit geben, sich bemerkbar zu machen! War Moronthor denn
blind? Begriff er nichts? Mit ihren Gedanken schrie sie nach ihm.
Er war doch schwach telepathisch begabt! Warum nahm er ihre
Gedanken nicht wahr?
Und sie konnte nicht einmal die Pupillen drehen!
Damit war ihr Gesichtsfeld eingeschränkt! Sie sah, wie die
beiden Freunde sich aus ihrem Gesichtskreis entfernten.
Hatten sie etwas bemerkt?
Dann mußten sie doch gleich den Laden betreten!
Doch nichts dergleichen geschah. Die Türglocke klang nicht
auf. Niemand betrat den Laden.
Eine Welt brach für Nicandra zusammen. Moronthor hatte die
furchtbare Wahrheit nicht erkannt! Er ging einfach weiter,
entfernte sich!
Der Wagen, dachte sie. Der weiße Cadillac auf dem Parkplatz.
Er war zu auffällig. Sie mußten ihn sehen. Vielleicht würden sie
dann etwas merken. Denn die Ähnlichkeit der Puppe Nicandra mit der
lebenden Nicandra war doch viel zu groß, um dann noch Zufall sein
zu können.
Ihre ganze Hoffnung setzte sie in diese letzte Chance, die sie
noch besaß.
Aber die Zeit verstrich, und kein Retter kam. Dafür kam der
Dämonen-Schneider wieder. Er hatte etwas vor… !
***
Moronthor hörte das Motorengeräusch und wirbelte herum. Da sah
er den schwarzen Buick heranjagen.
Gerade an dieser Stelle standen keine geparkten Fahrzeuge am
Straßenrand. Auf eine Länge von zwanzig Metern trennte nichts
Fahrbahn von Gehsteig außer der Bordsteinschwelle.
Und die stellte für den Wagen kein Hindernis dar.
Hinter den getönten Fenstern konnte Moronthor keine
Einzelheiten erkennen, aber daß es sich um einen Unfall handelte,
wollte er nicht glauben. Hier verlor niemand zufällig die Kontrolle
über den Wagen. Das war eine gezielte Aktion.
Sie galt ihm, Moronthor! Und auch seinem Freund Bill!
Der Wagen sprang förmlich auf den breiten Bürgersteig. Aus den
Augenwinkeln sah Moronthor, der abermals herumfuhr, daß die
Nummernschilder verdeckt waren. Damit war der Fall klar. Der
Parapsychologe gab Bill Relokin einen kräftigen Stoß. Zwischen
ihnen sauste der Wagen hindurch. Bremsen kreischten, er schleuderte
mit dem Heck herum und berührte Moronthor. Der Parapsychologe wurde
gegen die Hauswand geschleudert. Seine Hüfte schmerzte, und er
knickte rechts ein.
Vor seinen Augen tanzten grellbunte Flecken. Nur mühsam konnte
er seine Gedanken Zusammenhalten. Ein Dämonenangriff? Dann hätte
ihn das Amulett gewarnt. Das hier war etwas völlig anderes. Eine
Art Überfall, die er nicht begriff.
Durch rote Schleier sah er, daß der Buick so stehenblieb, daß
er jederzeit wieder starten und sich in den Verkehr einreihen
konnte. Die Türen flogen auf. Zwei dunkel gekleidete Männer mit
Sonnenbrillen sprangen heraus. Einer deutete auf Bill. Der andere
wandte sich Moronthor zu.
Der Meister des Übersinnlichen überwand seine Schwäche. Er
richtete sich auf, bereit, den Gegner anzunehmen. Aber übergangslos
starrte er in die schwarze Mündung einer Waffe.
»Umdrehen! Hände an die Wand, Beine auseinander«, befahl der
Dunkle.
Bill prügelte sich derweil mit dem zweiten. Ein dritter Mann
saß noch hinter dem Lenkrad.
Zähneknirschend folgte Moronthor der Aufforderung des
Bewaffneten. Es hatte keinen Zweck, wenn er sich hier erschießen
ließ. Der Mann trat zu ihm, tastete ihn blitzschnell ab. Eine Hand
riß das Hemd auf, griff nach dem Amulett!
»Nein«, keuchte Moronthor und stieß sich von der Wand ab gegen
den anderen. Doch naturgemäß kam er dabei nicht in Schwung. Bevor
er ihn mit seinem Körper noch rammen konnte, hieb der Gangster ihm
den Griff der Waffe in den Nacken. Moronthor sank aufstöhnend
zusammen. Dann gab es einen heftigen Ruck, und die Silberkette, die
das Amulett hielt, riß einfach. Ein ziehender Schmerz durchfuhr
Moronthor.
Halb gelähmt rollte er sich herum.
»Warte, Freundchen«, hörte er Bill Relokin ein paar Meter
weiter toben. Es klatschte hörbar. Ein würgender Laut. Dann brüllte
ein Schuß auf.
Moronthor sah Bill Relokin gegen den schwarzen Buick taumeln.
Seine Hand fuhr hoch, preßte sich gegen Brust oder Schulter. Ein
heftiger Schlag ließ den Historiker zusammenbrechen.
Der Bewaffnete sprang in den Wagen.
Wieder krachte ein Schuß. »Halt, Polizei«, brüllte eine Stimme
aus der Entfernung. Der zweite Mann, der allein nicht mit Bill
fertiggeworden war, kroch halb in den Wagen. Moronthor raffte sich
mit aller noch verfügbaren Energie auf, warf sich nach vom und
bekam die Füße des Mannes zu fassen. Der Buick ruckte an. Moronthor
hielt eisern fest. Der Gangster wurde aus dem Wagen gerissen!
Ein neuerlicher Schuß zerschmetterte eine Fensterscheibe des
Wagens. Glas regnete auf Moronthor und den Mann, den er krampfhaft
festhielt, nieder. Reifen kreischten. Der schwarze Wagen jagte auf
die Straße. Hupen und jaulende Bremsen mischten sich, dann gab es
einen donnernden Knall, Knirschen von Blech und Klirren von Glas.
Wieder Schüsse. Moronthor sah einige Dutzend Meter entfernt einen
dunkelhäutigen Polizisten in Combatstellung auf den Buick feuern.
Doch der schwarze Wagen raste davon, überquerte die nächste
Kreuzung bei Rot und verschwand.
Zwei andere Fahrzeuge, die ihm ausweichen wollten, hatten sich
ineinander verkeilt. Das war das Krachen und Klirren gewesen, das
Moronthor wahmahm.
Sein Gegner wollte sich wieder hochschnellen. Aber Moronthor
riß ihn erneut nieder, warf sich über ihn. Noch ehe der
angeschlagene Gegner Moronthor abzuwehren vermochte, betäubte er
seinen Gegner für kurze Zeit.
Dann richtete er sich müde auf. Er fühlte sich erschöpft.
Seine rechte Hüfte und sein Nacken schmerzten teuflisch. Er sah
nach Bill. Der Historiker kauerte am Boden und preßte die Hand an
eine Stelle knapp unterhalb des linken Schlüsselbeins. Dort
sickerte Blut hervor.
Eine Menschenmenge bildete sich. Neugierige starrten das Bild
an, das sich ihnen bot. Der dunkelhäutige Polizist schob sich
heran, zwängte sich durch die Menge und warf auch einmal jemanden,
der absolut nicht weichen wollte, mit kräftigem Schlag zur Seite.
Dann stand er in der Mitte des Kreises. Moronthor sah das
Walkie-Talkie am Gürtel des Beamten.
»Verstärkung und Krankenwagen kommen gleich«, sagte der
Polizist, immer noch die Waffe in der Hand. Jetzt erst lud er sie
rasch nach und steckte sie zurück. Er wandte sich Bill zu.
»Sie sind verletzt, Sir? Lassen Sie mal sehen!«
»Nicht der Rede wert«, ächzte Bill und sank bewußtlos auf die
Gehsteigplatten.
Moronthor tastete zur Brust. Er fühlte sich auf seltsame Weise
nackt. Das Amulett war fort.
Warum? Was bezweckten ein paar Gangster damit? Woher konnten
sie überhaupt wissen, daß er ein silbernes Amulett unter dem Hemd
trug?
Er konnte es sich doch denken… !
***
Die Verstärkung, die Streifenpolizist Cal Lewis angefordert
hatte, schaffte es immerhin, die Zuschauermenge dadurch zu
zerstreuen, daß einzelne Personen angesprochen wurden, als Zeugen
zu dienen. Doch so genau wollte nun niemand etwas mit dem Vorfall
zu tun haben.
Bill Relokin wurde im Krankenwagen fortgebracht. Moronthor
unterhielt sich mit dem Sergeant, der die fünfköpfige
Polizistengruppe anführte, und mit Cal Lewis.
»Der Überfall diente dem Raum eines Gegenstandes, den ich
immer mit mir führe«, sagte Moronthor und beschrieb das Amulett.
»Jemand muß gewußt haben, daß ich mich zu diesem Zeitpunkt hier
befand. Die Aktion war genau geplant, bis auf das hier.« Er deutete
auf den noch Bewußtlosen. »Ich nehme an, die Gangster haben nicht
damit gerechnet, daß ich in Begleitung unterwegs war.«
»Kennen Sie die Leute?«
Moronthor zuckte mit den Schultern. »Woher?« fragte er. »Ich
weiß auch nicht, ob man über den Wagen etwas erreichen kann. Die
Nummernschilder waren verdeckt…«
»Wir kriegen ihn«, versicherte Cal Lewis. »Ich habe ihm eine
Scheibe zerschossen. Ein schwarzer Buick mit diesem Schaden dürfte
aufzuspüren sein.«
Aber ob damit auch die Fische ins Netz gingen, wagte Moronthor
zu bezweifeln. Wenn er Fahrer des Buick wäre, würde er den Wagen an
erstbester Stelle stehenlassen und sich zu Fuß oder per Taxi
weiterverfügen.
»Die Männer müssen Sie nicht gekannt haben, Mister Moronthor,
auch wenn es umgekehrt nicht der Fall ist. Haben Sie einen
Verdacht? Weshalb der Überfall?«
»Um das Amulett zu entwenden«, sagte Moronthor. »Ich sprach
doch schon davon.«
»Welchen Wert besitzt es?«
Moronthor schüttelte den Kopf. »Wenn Sie nach harten Dollars
Fragen, muß ich passen. Aber der… hm… ideelle Wert ist
ungeheuerlich.«
Er konnte diesen braven Polizisten, die an nichts anderes als
an das Greifbare und Sichtbare glauben durften, doch nichts von
Dämonen erzählen. Zumal es sich bei den Amulett-Dieben nicht um
Dämonen handelte, sondern um normale Menschen! Sonst hätten sie das
Amulett nicht so einfach an sich bringen können!
Jene silberne Scheibe, die einst von dem mächtigen Magier
Merlin aus der Kraft einer entarteten Sonne geschaffen wurde und
die über fantastische Kräfte und Möglichkeiten verfügte -wenn sie
nicht gerade den Dienst verweigerte. In letzter Zeit wurde sie
immer unberechenbarer.
Ein Verdacht keimte in Moronthor auf. War es bereits so weit,
daß es nicht mehr auf Dämonen ansprach?
Moronthor nahm für ein paar Minuten im Polizeiwagen Platz.
Dort hatte er Gelegenheit, sich ein wenig zu erholen. Die Schmerzen
ließen nach. Gebrochen war nichts, nur ein paar häßliche blaue
Flecken würden Zurückbleiben. Und der weiße Anzug war nach der
heftigen Auseinandersetzung reif für den Müll.
Moronthor erzählte seine Geschichte zum zweiten und zum
dritten Mal. Beim vierten Mal explodierte er. »Schön, ich verstehe,
daß Sie mir als Ausländer skeptisch gegenüber stehen, bloß stinkt
mir mittlerweile Ihr Verhör-Stil! Wenn Sie schon so tun, als
hielten Sie mich für den Boß der Bande, warum legen Sie mir dann
nicht direkt Handschellen an?«
Der Sergeant entschuldigte sich nicht. Er fragte nur: »Wohin
dürfen wir Sie bringen, Sir, oder möchten Sie Ihren Weg zu Fuß
fortsetzen?«
Ergrimmt nannte Moronthor das Hotel, in dem sie Zimmer bezogen
hatten. »Und dann hätte ich noch gern die Krankenhaus-Adresse,
wohin Bill Relokin gebracht wurde.«
Er bekam sie.
Er wurde per Streifenwagen zum Hotel gebracht. Dadurch und
durch sein ramponiertes Aussehen erregte er mehr Aufsehen, als ihm
lieb sein konnte, und dann mußte ihm im Foyer noch die wohlbeleibte
Dame von vorhin über den Weg laufen. Hämisch grinsend und
triumphierend nickend musterte sie ihn von oben bis unten.
Himmel, Arm und Zwirn! dachte Moronthor. Aber taktvoll schwieg
er und benutzte statt der altehrwürdigen Treppe den noch
altehrwürdigeren Lift. Jetzt fehlte nur, daß die Kabine zwischen
zwei Etagen steckenblieb!
Sie blieb nicht.
Moronthor erreichte die Zimmerflucht, trat ein und war nicht
verwundert, Nicandra noch nicht anzutreffen. Wenn, sie einkaufte,
dauerte das natürlich lange.
Er duschte, legte frische Kleidung an und telefonierte mit dem
Krankenhaus. Dort konnte man ihm über Bills Gesundheitszustand
keine verbindliche Auskunft geben. Mißmutig knallte Moronthor den
Hörer auf die Gabel, hob wieder ab und bestellte einen
Mietwagen.
Er wollte nicht auf Nicandras Rückkehr warten und trotzdem
mobil sein.
Er wußte, daß er jetzt gefährdeter denn je war. Daß man ihm
zielbewußt und ausschließlich das Amulett entwendete und dabei
sogar einen Überfall auf offener Straße am hellen Tag riskierte,
bewies ihm, daß Dämonen dahintersteckten. Man hatte ihn seines
Schutzes beraubt. Wenn der Dämon wollte, konnte er Moronthor jetzt
mit Leichtigkeit angreifen.
Es kam nur auf Ort und Zeit an.
Und ein Taxi war schon immer ein geeignetes Mittel gewesen,
jemanden spurlos aus der Weltgeschichte verschwinden zu lassen. Um
wieviel leichter mußte das sein, wenn es sich um einen Dämon
handelte, der den Anschlag auf Moronthor plante!