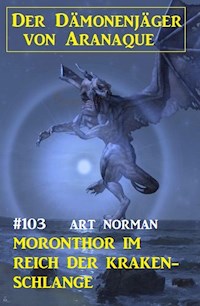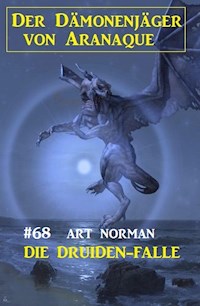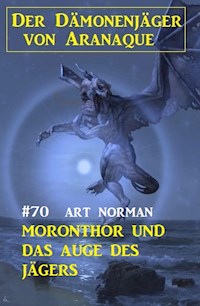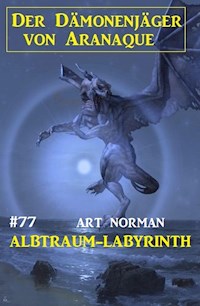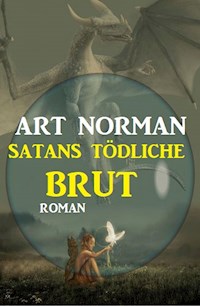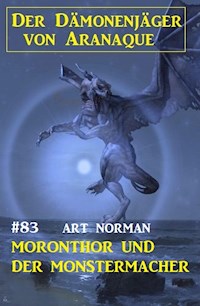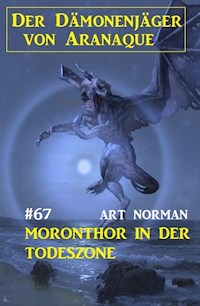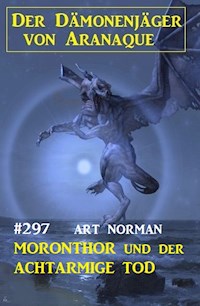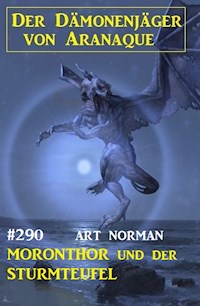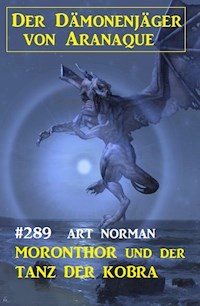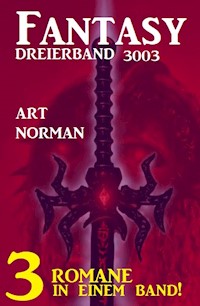Es war ein Ungeheuer, das eigentlich gar nicht auf der Erde
existieren dürfte. Es mochte eine Seeschlange aus den alten Mythen
und Legenden sein, ein riesiger Krake, dessen Fangarme ganze
Schiffe zerstören konnten, ein Nest giftiger, zischender Schlangen,
deren Biß unverzüglich tötet.
Es war nichts von alledem, und es war etwas von jedem. Eine
entsetzliche, gefährliche Mischung. Daß es diese Bestie geben
könnte, wollte niemand glauben.
Aber es gab einen, der sie herbeibeschwor. Der eine tödliche,
mörderische Falle stellen wollte für seinen größten Feind. Und so
war das unglaubliche Ungeheuer plötzlich da, und der Schrecken
begann.
Das Monster, diese gefährliche Mischung aus verschiedenen
Bestien, schlug seine Opfer…
Er starrte in die düstere Glut. Hier und da züngelten Flammen
auf, zischte Feuer über heiße Steine. Manchmal wurden für wenige
Sekunden Gesichter in den Flammen und der wabernden Glut sichtbar,
verzerrte Fratzen. Da waren Schreie, die niemanden zum Mitleid
anregen konnten. Derwische tanzten kreischend und triumphierend um
die verlorenen Seelen, die im Seelenfeuer brannten, der Verdammnis
anheim gefallen.
Tausend kleine Teufel schürten die Flammen und genossen ihren
Sieg.
Der Betrachter kauerte auf einem menschlichen Gerippe, das auf
Kniescheiben und Handwurzelknochen gestützt seine Wirbelsäule als
Sitzbalken darbot. Der Betrachter las ein Muster aus der Glut und
erkannte, was vorgefallen war.
Einer war ausgelöscht worden. Auf eine denkbar primitive Art
und Weise.
»Er hat versagt, Astaroth«, sagte der dämonische Betrachter.
Er wandte den Kopf und sah den anderen an, der neben ihm über den
rötlichen Steinen schwebte. »Konntest du mir keinen Besseren zur
Verfügung stellen als jenen, der vorher noch prahlte, er habe
niemals versagt und nichts könne sich ihm in den Weg stellen? Ist
es deine Absicht, Astaroth, mir solche Versager zur Verfügung zu
stellen? Damit du hinterher mit dem Finger auf mich zeigen kannst
und sagst: Da seht ihr alle, daß alle seine Vorhaben fehlschlagen?
Ich durchschaue dich, Erzdämon.«
Astaroth grinste.
»Ein offenes Wort, Leonardo deAranaque - mir gefällt es nicht,
daß du Fürst der Finsternis bist. Es hat mir nie gefallen. Das
wissen wir beide, und das wissen auch andere, die dich nicht mögen.
Aber du kannst sicher sein, daß ich geschickter vorgehen würde,
wenn ich deinem Ansehen schaden wollte.«
Leonardo runzelte die Stirn. Der Dämon, der einmal vor langer
Zeit ein Mensch gewesen war, dessen Seele in diesem Höllenfeuer
brannte, sah Astaroth durchdringend an. »Du willst mich von meinem
Thron verdrängen.«
»Nein«, sagte Astaroth. Er lachte meckernd. »Diesen Ehrgeiz
besitze ich nicht. Ich bin einer der Uralten, viel älter als du,
und ich besitze Macht. Ich habe viele Fürsten der Finsternis kommen
und gehen gesehen. Asmodis, Damon aus der Straße der Götter,
Belial, jetzt du… sie verschwinden, aber ich bin immer noch da. Das
ist mein Ziel. Kämpft ihr um die Macht -ich schaue zu und
lache.«
»Lache nicht zu laut«, warnte der Fürst. »Und bedenke, daß in
diesem Fall mein Ziel auch dein Ziel war. Den Einfluß der SIPPE DER
EWIGEN einschränken, ihre menschlichen Helfer ausschalten… und der,
den du mir aus deinen Legionen gäbest, versagte, ließ sich
töten.«
»Er war leichtsinnig. Er konzentrierte sich auf
Nebensächlichkeiten statt auf seine Aufgabe. Und er ließ sich mit
einem Gegner ein, gegen den bisher noch jeder den Kürzeren gezogen
hat - angefangen bei Asmodis. Auch du - und auch ich - konnten
bisher nichts gegen ihn ausrichten, Fürst.«
Seine Anrede war sehr vertraulich und respektlos. Leonardo
merkte es wohl. Er wußte nur zu gut, wie unsicher sein Thron stand.
Die anderen Dämonen, die in ihm einen Emporkömmling sahen, warteten
nur darauf, daß er sich Blößen gab, um den Ast abzusägen, den er
erklommen hatte. Sie waren gegen ihn, der einmal Mensch gewesen
war. Nur einen hatten sie noch mehr gehaßt - Magnus Friedensreich
Eysenbeiß, der Lucifuge Rofocale vorübergehend vertrieb. Doch nun
war Eysenbeiß tot, und Lucifuge Rofocale war wieder da, stärker und
mächtiger denn je.
»Professor Moronthor«, stieß Leonardo hervor und spie aus.
Flammen sprühten auf, wo sein Speichel das Gestein berührte. »Auch
seine Zeit wird kommen, Astaroth.«
Der Erzdämon lachte höhnisch.
»Und wer will ihn töten? Du?«
»Vielleicht«, sagte Leonardo. »Spotte du nur, Alter. Es wird
die Zeit kommen, da der Spott dir vergeht.«
»Oh, darauf warte ich schon seit über hunderttausend Jahren«,
sagte Astaroth. »Du wirst mich sicher darüber informieren, sobald
du Moronthor erschlagen hast. Nun aber muß ich dich mit deinen
Regierungsgeschäften allein lassen, mein Fürst - auch auf mich
warten Aufgaben. Solltest du wieder einen Hilfsdämon aus meinen
zahlreichen Legionen für deine Zwecke beanspruchen wollen, so stehe
ich gern zu Diensten - nur setze ihn nicht auch auf Moronthor an.
Ich verliere so ungern Dämonen mit seltenen Fähigkeiten.«
Er verschwand, ehe Leonardo ihn zum Bleiben auffordern
konnte.
Der Fürst der Finsternis ballte die Fäuste. Sicher war der
Gelbäugige mit einer sehr seltenen Fähigkeit ausgestattet gewesen -
mit seinen Augen vermochte er Laserstrahlen zu verschießen. Und es
verdroß Leonardo kaum weniger als Astaroth, daß dieser Dämon
ausgelöscht worden war. Aber warum hatte er sich auch mit Professor
Moronthor eingelassen? Es war allein die Schuld des Laser-Dämon,
daß er nun nicht mehr existierte. Er hätte Moronthor aus dem Weg
gehen sollen. Auseinandersetzungen mit dem Meister des
Übersinnlichen waren eine ganz besondere Kunst.
Es mißfiel dem Fürsten, daß Astaroth sich so respektlos
zeigte. So wie heute hatte er sich noch nie gebärdet. So
unbotmäßig… die Art, wie er Leonardo ›Fürst‹ nannte, war der
reinste Hohn.
Aber Leonardo konnte es nicht riskieren, sich mit dem Erzdämon
offen anzulegen. Noch nicht. Selbst hier in den Schwefelklüften, wo
jeder des anderen Teufel war, hatte Astaroth zu viele Verbündete.
Und das gerade dann, wenn es gegen Leonardo ging.
Wenn er Astaroth in die Schranken weisen wollte, dann nur
durch die Hintertür. Mit Tricks und Intrigen. Leonardo hatte selbst
den Ruf eines Meisters der Intrigen, aber dieser Ruf war
angeschlagen - sein einstiger Berater Eysenbeiß war ihm in diesen
Dingen noch über gewesen. Und Astaroth war einer der ganz uralten;
es gab wahrscheinlich keinen Trick, den er nicht
durchschaute.
Und jetzt lauert er darauf, daß ich mich in meinem heißen Zorn
auf Moronthor stürze, nur um Astaroth zu beweisen, daß ich doch mit
diesem Menschlein fertig werde, dachte Leonardo grimmig. Aber den
Gefallen, Alter, tue ich dir nicht…
Aber dennoch - er hatte Moronthor längere Zeit nicht beachtet,
hatte ihn schalten und walten lassen. Es war an der Zeit, ihm
zumindest einen Dämpfer zu versetzen. Ihn einmal mehr in eine Falle
zu locken. Es war nicht sicher, ob er diese Falle nicht auch
sprengte, aber solange er mit sich selbst und dem Kampf ums
Überleben beschäftigt war, konnte er sich nicht um andere Dinge
kümmern. Solange er beschäftigt war, konnten die Dämonen und Teufel
der Hölle ungestört Seelenfang betreiben und Sterbliche ins Unglück
stürzen.
Aber es mußte eine Art und Weise sein, die bei einem
Fehlschlag Leonardo keinen Schaden zufügte. Er mußte jemanden oder
etwas auf Moronthor hetzen, der oder das nicht unmittelbar aus den
Kreisen der Hölle entstammte.
Ich hätte da eine Idee, sagte die Stimme aus dem Amulett
munter.
***
»Du schon wieder!« knirschte Leonardo deAranaque. »Verschwinde
aus meinem Leben. Ich hasse dich!«
Wie undankbar, spottete die lautlose Stimme in seinem Kopf.
Ich kann dir helfen. Laß mich nur machen.
»Eines Tages werde ich dich vernichten! Ich verbiete dir,
etwas ohne meine Zustimmung zu tun - und die wirst du nie erhalten!
Schweig und schwinde dahin; ich kann mich selbst um meine Belange
kümmern!«
Er hörte das lautlose Gelächter, und sekundenlang drängte sich
ein Gesicht in sein Bewußtsein - kein richtiges Gesicht, nur eine
silberne Maske. Dann verblaßte der Eindruck wieder.
Das Amulett, das Leonardo deAranaque unter seinem Gewand trug,
vibrierte leicht. Etwas geschah. Der Fürst der Finsternis konnte es
nicht verhindern. Im nächsten Moment war es auch schon wieder
vorbei.
»Ich hasse dich!« brüllte er.
Durch das Gewand hindurch umklammerte er das Amulett, wollte
es zerstören und damit den Geist, der sich darin manifestiert
hatte. Aber er brachte es nicht fertig. Irgend etwas, das er nicht
verstand, hinderte ihn daran. War es die Logik, die ihm sagte, daß
er das Amulett noch gut gebrauchen konnte als eine magische Waffe,
die ihm notfalls auch gegen die anderen Höllendämonen Schutz bot?
Oder war es etwas, das der verfluchte Zauberer Merlin diesem
Amulett einst mitgab, als er es schuf? Oder - war es der Geist
selbst, der sich darin befand?
Leonardo konnte es nicht erkennen.
Vor langer Zeit hatte Merlin, der Zauberer von Avalon, sieben
Amulette geschaffen. Eines stärker als das Vorgehende, aber erst
mit dem siebten war er wirklich zufrieden gewesen.
In grauer Vergangenheit hatte Leonardo deAranaque es besessen.
Jetzt gehörte es Professor Moronthor, und Leonardo mußte sich mit
dem schwächeren begnügen. Wer die anderen besaß, wußte er nicht,
konnte er nur vermuten. Und seines hatte einst Magnus Friedensreich
Eysenbeiß besessen.
Den hatte er als seinen Berater in die Hölle geholt, aber
Eysenbeiß hatte intrigiert und an ihm vorbei Karriere gemacht.
Leonardo hatte Satans Ministerpräsident werden wollen - Eysenbeiß
war es geworden. Doch Eysenbeiß hatte den Fehler begangen, einen
Pakt mit dem ERHABENEN der SIPPE DER EWIGEN einzugehen, dem
Erzfeind der Höllenmächte. So hatte ein Tribunal ihn zum Tode
verurteilt trotz seines hohen Amtes, und der Fürst der Finsternis
hatte das Urteil liebend gern vollstreckt - und das Amulett an sich
genommen, ehe ein anderer es bemerken konnte. Auch er selbst hatte
nichts davon gewußt, bis er es bei dem Hingerichteten fand.
Er hatte sich diebisch gefreut, diese magische Superwaffe sein
eigen nennen zu können.
Und mit der Zeit hatte er festgestellt, daß Eysenbeiß trotz
seiner Hinrichtung nicht tot war, daß er es geschafft hatte, im
Augenblick des körperlichen Todes seinen Geist in eben dieses
Amulett fließen zu lassen. Und da lauerte er jetzt darauf,
trachtete danach, dem Fürsten der Finsternis zu schaden.
Daß er ihm jetzt Hilfe angeboten hatte, hielt Leonardo für
einen üblen Trick. Und er wünschte sich, eine Möglichkeit zu
finden, auch diesen Rest von Eysenbeiß endgültig zu beseitigen.
Erst dann würde er Ruhe haben, wenn sein alter Freund ausgelöscht
war.
»Irgendwann«, murmelte er grimmig. »Irgendwann kriege ich
dich!«
Aber dann erwachte in ihm die Neugier, was Eysenbeiß getan
hatte, der andererseits ja auch Moronthor am liebsten tot gesehen
hätte…
***
Das, was einmal Magnus Eysenbeiß ausgemacht hatte, hatte sich
erinnert.
An seine Vergangenheit. An sein Amt als Großer der Sekte der
Jenseitsmörder, die in einer Parallelwelt ihren Ursprung hatte, in
einer anderen Dimension. Dort hatte Leonardo deAranaque ihn einst
aufgespürt, als er noch nicht Fürst der Finsternis war, und dort
war er auch erstmals mit Professor Moronthor zusammengestoßen.
Damals hatte alles seinen Anfang genommen.
Seine besondere Fähigkeit hatte Eysenbeiß behalten, auch
nachdem er aus der anderen Dimension zur Erde überwechselte -
wenngleich er sie nur noch sehr, sehr selten benutzt hatte. Aber er
hatte diese Kraft nie verloren, mit der er im Wahrtraum in die
Zukunft greifen und Gegenstände von dort in die Gegenwart holen
konnte.
Daran hatte er sich jetzt, als Geist im Amulett, erinnert, und
diese Fähigkeit setzte er nun nach langer Zeit wieder ein,
verstärkt durch die Kraft des vierten Amuletts, um nicht einen
Gegenstand zu holen, sondern ein Wesen.
Eine dämonische Kreatur aus der Zukunft einer Welt, die
Eysenbeiß kannte, die für die Menschen der Erde aber nicht mehr als
eine Sage war. Zu viel verdrängten sie doch, was sie nicht
begriffen, durch ihre Handlungen in andere Dimensionsebenen, aber
zerstören konnten sie die alten Dinge nicht.
Eysenbeiß griff in die Vorbereitungen zu Ragnarök, der
Götterdämmerung, und er zog ein schlangenhaftes dämonisches
Ungeheuer in die Welt der Menschen der Gegenwart. Er konnte sicher
sein, daß Moronthor diese Herausforderung annehmen würde, aber
auch, daß selbst die Kraft des siebten Amuletts nicht ausreichen
würde, das aus der mythischen Zukunft stammende Ungeheuer zu
töten.
Die Aktivität des 4. Amuletts verlosch wieder. Eysenbeiß zog
sich in sich zurück, verkapselte sich. Er war erschöpft. Ein
solches Ungeheuer aus der Zukunft zu holen, über die Grenzen der
Wirklichkeit hinweg, hatte all seine Kraft gekostet. Davon mußte
auch er sich erst wieder erholen.
Aber er schlug vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe.
Denn er wußte sehr genau, was er mit dieser Aktion wirklich
angerichtet hatte.
Nur von einer anderen Sache -hatte er keine Ahnung…
***
Etwas wurde abermals stärker.
Wiederum war eines der niederen Amulette benutzt worden, und
wiederum spiegelte sich die von ihm abgegebene Energie. Das, was
gespiegelt wurde, ohne daß die eigentliche Kraft dadurch verringert
wurde in ihrer Wirkung, drang bis zu dem WERDENDEN vor, wurde von
IHM begierig aufgenommen.
Und abermals wurde ES wieder etwas kräftiger, wurde sich
selbst bewußter. Nicht mehr lange, und ES würde endgültig
erwachen.
Jedesmal, wenn eines jener Amulette benutzt wurde, half es dem
WERDENDEN zu werden. Und niemand ahnte etwas davon - bis auf einen.
Er hatte einen der Amulett-Träger gewarnt. Doch jener, Lucifuge
Rofocale, hatte über die Warnung gelacht und sie wahrscheinlich
längst vergessen. Denn zu viel Zeit war seither vergangen, ohne daß
in der Welt des Sichtbaren etwas geschah.
Doch in der Welt des Unsichtbaren wuchs ES.
Jedesmal etwas mehr…
***
In einer Welt, deren Struktur und Inhalt Menschen nur erahnen
können, war der Einäugige aufmerksam geworden. Etwas hatte sein
Interesse geweckt.
Er verspürte für kurze Zeit eine seltsame Kraft. Sie erinnerte
ihn an etwas, doch noch fiel es ihm schwer zu erkennen,
woran…
Und er sah, daß aus dem Lager der Dämonischen eine Entität
verschwunden war. Verschleppt von der seltsamen Kraft, die ihn an
jemanden erinnerte, den er einmal gekannt zu haben glaubte.
Vielleicht zu gut gekannt…
Wer hatte die dämonische Bestie in eine andere Welt geholt,
wohin und warum? Und weshalb war gerade diese Kraft benutzt
worden?
Der Einäugige war ein Suchender, ein Wanderer auf der Jagd
nach Wissen.
»Ich muß meine Späher aussenden, auf daß ich durch ihre Augen
sehe«, flüsterte er.
***
Manchmal trieb es Julio Zantos an den San-Juan-Fluß. Nicht
dorthin, wohin alle anderen gingen, sondern an den kleinen
Wasserfall, hinter dem zwischen schroffen Felsen ein kleiner See
lag. Auf kaum einer Karte war er eingezeichnet. Er war einfach zu
klein und zu unwichtig. Wichtig war der Toronto-See, der einige
Kilometer weiter im Nordosten lag und der vom Rio San Juan gespeist
wurde.
Julio war gern hier am Wasserfall. Er genoß das Rauschen des
Wassers, das sich aus einer Höhe von etwa vier oder fünf Metern in
den kleinen See ergoß, der schon bald darauf wieder zum Fluß wurde,
um sich weiter durch die schroffe, karge Landschaft zu schlängeln,
die kaum etwas bot. Wenige Pflanzen, wenige Tiere. Ein paar
Schlangen und Skorpione, einige Insektenarten gediehen hier in der
Hitze. Die Nähe der Bolson de Mapimi machte sich bemerkbar - das
Wüstenklima breitete sich aus.
Trotzdem lebten hier ein paar Menschen. Jene, die die hohen
Mieten in den Städten nicht mehr bezahlen konnten, weil sie in den
Zink-Minen kaum genug zum Leben verdienten. Sie hatten irgendwo
ihre Hütten, und von irgend etwas lebten sie und schafften es immer
wieder zu überleben, sich zu ernähren und zu kleiden.
Wenn Julio hier am Wasserfall war, vergaß er, daß die Armut
der ständige Wegbegleiter fast jedes Menschen in dieser Region war.
Es gab kaum Arbeitsplätze, sie waren schlecht bezahlt, und die
Kluft zwischen den vielen Armen und den wenigen Reichen wurde immer
größer.
Und niemand tat etwas dagegen.
Auch Julio nicht.