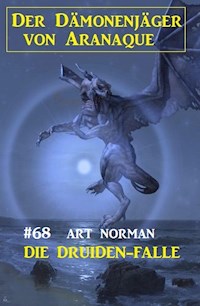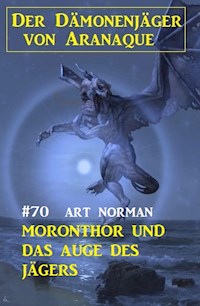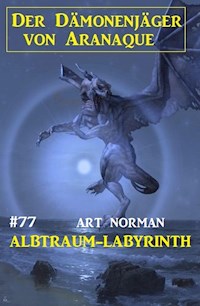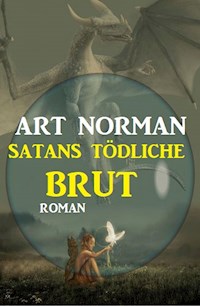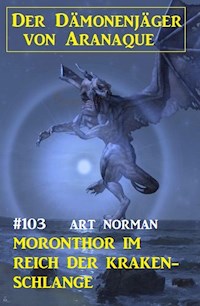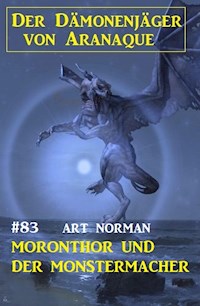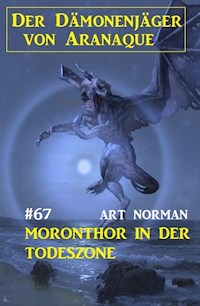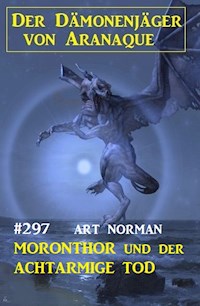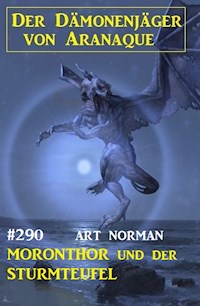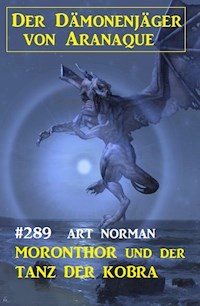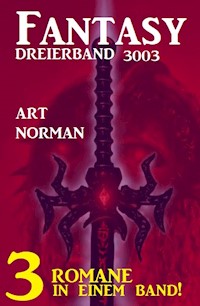Tamote staunte. So ein Wesen hatte er noch nie zuvor in seinem
Leben gesehen. Es sah aus wie ein Mensch, weil es zwei Beine, zwei
Arme und einen Kopf hatte, aber seine Haut war tiefschwarz, es ging
gekrümmt und bucklig, und es trug Kleidung, die so bunt war, daß es
den Augen weh tat, am ganzen Körper.
Aber das war noch längst nicht alles.
Dieses Wesen war in Begleitung eines hellhäutigen Mannes in
ebenfalls sehr eigenartiger Kleidung.
Und - es konnte zaubern.
Das
allerdings fand Tamote gar nicht gut…
***
Ins Lager zurückgekehrt, schwieg Tamote zunächst über seine
Beobachtung. Er zog sich in seine Hütte zurück und überlegte, was
er davon zu halten hatte. Auch dem Häuptling berichtete er nicht
von den beiden Fremden.
Noch nicht.
Er mußte erst einmal für sich selbst herausfinden, was es zu
bedeuten hatte, daß der Schwarze zaubern konnte. Es mußte Zauberei
sein, was er tat, denn keinem normalen Menschen wäre dies möglich
gewesen. Nicht einmal einem Schamanen, so stark dessen Medizin auch
sein mochte.
Tamote war nicht sicher, ob er nachvollziehen konnte, was der
Schwarze getan hatte, selbst wenn er den Großen Geist um eine
besondere Gunst bat.
Es gab zwei Möglichkeiten.
Die eine: der Schwarze war ein von den Geistern gesegneter
Schamane.
Die andere: er war von ihnen verflucht und ein Knecht des
Bösen. Ein Verfluchter, dessen Anwesenheit allein schon reichte,
Unheil heraufzubeschwören.
Das mußte Tamote herausfinden.
Wenn der zweite Fall zutraf, gab es nur eine einzige
Möglichkeit, das Lager und den Stamm vor dem Bösen zu bewahren: Der
Schwarze mußte getötet werden. Und zwar rechtzeitig, ehe er das
Unheil über die Menschen bringen konnte.
Aber wenn seine Kräfte gut waren, war es böse, ihn zu
töten.
Deshalb würde Tamote mit ihm reden müssen.
Zum ersten Mal wurde Tamote bewußt, welche Verantwortung auf
ihm lastete.
Es ging nicht allein darum, den Segen der Götter für eine gute
Jagd zu erbitten und die Geister der Beutetiere um Vergebung zu
bitten dafür, daß man ihre Körper tötete, um ihr Fleisch zu essen
und aus ihrem Fell Kleidung und aus ihren Knochen Pfeilspitzen und
andere nützliche Dinge zu machen.
Hier ging es um Wohl oder Wehe des gesamten Dorfes, vielleicht
sogar um das aller anderen Menschen.
Tamote mußte herausfinden, wer und was der Schwarze war.
Deshalb mußte er zu ihm gehen.
Nur er war in der Lage, die Wahrheit herauszufinden.
Er fragte sich nicht, was der Häuptling dazu sagen
würde.
Er mußte es einfach tun.
Und so verließ er seine Hütte wieder, um dem Schwarzen und
seinem seltsamen Begleiter entgegenzugehen.
Ganz wohl war ihm dabei nicht.
Er gestand sich ein, daß er sich vor der Begegnung
fürchtete.
Aber was sollte er tun?
Es war seine Aufgabe, der er sich nicht entziehen konnte und
durfte…
***
Niemand fragte ihn, wohin er ging. Das war normal. Als
Schamane des Dorfes war er niemandem Rechenschaft schuldig. Nicht
einmal dem Häuptling. Aber diesmal wäre er froh gewesen, mit
jemandem über das reden zu können, was er zu tun im Begriff war.
Vielleicht hätte ein anderer einen Weg gesehen, der Tamote von
seiner Pflicht entband.
Er verließ das Lager, aber dort, wo er den Schwarzen und
seinen großen, dicken Begleiter gesehen hatte, der rote Haare im
Gesicht trug, fand er ihn nicht. Dafür aber eine Menge Spuren. Es
war leicht, ihnen zu folgen.
Die beiden Fremden bewegten sich weiter am Großen Fluß
entlang, der Strömung und damit auch dem Lager entgegen. Das
bedeutete, für die Krieger der hohen Klippe wurde die Zeit
knapp.
Bald schon holte Tamote sie ein. Aber er gab sich ihnen noch
nicht zu erkennen, wie er auch schon bei der ersten Begegnung
darauf verzichtet hatte, sich ihnen zu zeigen. Noch beobachtete er
nur. Und er stellte etwas seltsames fest.
Die beiden Wesen waren untereinander zerstritten.
Der kleine Schwarze schien dabei trotz seiner ungeheuer großen
Medizin immer zu unterliegen. Er gehorchte den Befehlen des großen
Mannes mit den roten Haaren im Gesicht. Jener scheuchte den
Schwarzen ständig hin und her, trug ihm allerlei Arbeiten auf, die
der Schwarze mit deutlichem Mißvergnügen verrichtete, ohne dabei
seine Medizin zu benutzen. Das erstaunte Tamote. Der Schwarze hätte
sich die Arbeit wesentlich erleichtern können, wenn er zu seiner
Zauberkunst gegriffen hätte. Das tat er jedoch nicht.
Das deutete darauf hin, daß er nicht böse war. Er mißbrauchte
die Gabe nicht, die der Große Geist ihm verliehen hatte.
Oder war all dies nur Täuschung?
Die schwarze Haut, dunkler als die Nacht, ließ ihn wie den
Geist aus einem bösen Traum erscheinen. Was er redete, war Tamote
unverständlich, aber er verstand ebensowenig die Sprache des dicken
Mannes mit den roten Gesichtshaaren. Es klang wie dummes Geplapper
ohne jeden Sinn, so, als würden kleine Kinder vor sich hin
brabbeln. Aber wenn man genauer hinhörte, wiederholten sich viele
Laute in einem ganz bestimmten Rhythmus.
Es war eine fremde Sprache.
Vielleicht die der Fremden, die seit einigen Wintern in diesem
Land beobachtet wurden? Fremde mit heller Haut, seltsamer Kleidung
und noch seltsameren Waffen! Diese Waffen waren laut, wenn sie
benutzt wurden, aber statt das Wild mit ihrem Knall zu erschrecken
und zu verscheuchen, fiel es tot um!
Auch Menschen fielen tot um, wenn die Waffen knallten, wenn
aus den seltsamen Rohren, die kurz oder auch lang waren, Blitze
zuckten.
Es war, als hätten böse Geister den Fremden diese Waffen
gegeben, die Feuer spien und Tod brachten. Den Tod aus der Ferne,
ohne daß man einen Pfeil oder einen Speer sah, der flog. Man sah
nur den Blitz und hörte den Knall. Nicht mehr.
Tamote wartete noch ab, ob er sich den beiden unheimlichen
Fremden schon jetzt zeigen sollte. Vielleicht war es besser, sich
noch eine Weile versteckt zu halten und abzuwarten. Sie noch ein
wenig zu beobachten. Daraus ließ sich vielleicht neues Wissen
schöpfen.
Der dicke, große Mann befahl dem Schwarzen schließlich, ein
Lagerfeuer zu entfachen. Tamote verstand die Worte zwar nicht, aber
die Gesten waren eindeutig.
Da erkannte er selbst, daß es bald Nacht wurde.
Das ließ ihm nicht mehr viel Zeit.
Falls die Fremden mit bösen Geistern im Bund waren, war es
nicht gut, die Nacht in ihrer Nähe zu verbringen. Tamote zweifelte
an sich selbst; er war nicht sicher, ob seine Medizin ihn schützen
würde.
Darüber ärgerte er sich selbst. Er hatte nie an sich und dem
Großen Geist gezweifelt und erst recht nicht an seinem Geistführer,
dem er seine Medizin verdankte. Doch jetzt zweifelte er!
Waren das schon Einwirkungen der fremden Bosheit?
Er stand nun vor der Entscheidung, umzukehren und vor den
Fremden davonzulaufen, um sich in Sicherheit zu bringen, ehe die
Dunkelheit der Nacht kam. Oder sich ihnen zu offenbaren.
Aber - die beiden Fremden kamen seiner Entscheidung
zuvor.
Der Schwarze deutete plötzlich mit ausgestrecktem Arm auf das
Strauchwerk, hinter dem Tamote sich bisher erfolgreich verborgen
hatte. Er rief etwas.
Und setzte sich auch sofort in Bewegung.
Da wußte Tamote, daß er nicht mehr davonlaufen konnte. Sein
Schicksal erreichte ihn in dieser Stunde.
***
322 Jahre später, Château Aranaque, südliches Loire-Tal,
Frankreich:
»Ich kann das!« erklärte Eva.
»Was kannst du? Wovon ist die Rede?« wollte Professor
Moronthor wissen.
»Von dem Zeitkreis. Ich kann ihn schließen.«
Der Parapsychologe hob die Schultern und schüttelte den
Kopf.
»Vielleicht bin ich ein wenig dumm im Kopf«, sagte er.
»Speziell bei diesem prachtvollen Sommerwetter. Aber ich begreife
im Moment nicht, worauf du hinauswillst. Von welchem Zeitkreis
redest du?«
»Der Zeitkreis, der entstanden ist, als du Don Cristofero und
seinen Begleiter zurück in die Vergangenheit gebracht hast. Da hat
doch irgendein Zauber nicht funktioniert, einer von Merlins
Zeitringen wurde euch in die Vergangenheit nachgeschickt, damit ihr
mit ihm in die Gegenwart zurückkehren könnt, und dabei hat sich ein
Zeitkreis geöffnet, der bis heute nicht geschlossen werden konnte!
Oder irre ich mich da?«
»Ach, das meinst du«, seufzte Moronthor.
Tief atmete er durch.
Don Cristofero Fuego del Zamora y Montego.
Der schräge Adelige, der zu Moronthors frühen Vorfahren aus
der spanischen Linie gehörte und eines Tages mitsamt seinem
Begleiter, einem namenlosen schwarzhäutigen Gnom, im Château
Aranaque erschienen war. Dem Gnom war, für ihn absolut nichts
Ungewöhnliches, ein Zauber total mißglückt, und so hatte er seinen
Herrn und sich aus dem Jahr 1673 ins Jahr 1991 versetzt. Es hatte
geraume Zeit gedauert, bis es für die beiden eine Rückkehr in ihre
Epoche gab. Dummerweise waren Professor Moronthor und seine
Gefährtin Nicandra Darrell dabei mit in die Vergangenheit gezogen
worden. Erst dadurch, daß ihnen aus ihrer Gegenwart Merlins
Zukunftsring zugespielt worden war, hatten sie es geschafft, selbst
wieder in die Gegenwart zurückzukehren.[1][2]
Damit war aber ein Zeitkreis geöffnet worden, der sich bis
heute nicht hatte schließen lassen.
Denn mit Merlins Zeitringen, der blaue für die Zukunft und der
rote für die Vergangenheit, hatte es eine bestimmte Bewandtnis: Wer
sie in Verbindung mit dem Machtspruch des alten Zauberers benutzte,
wurde an einen bestimmten Ort in einer anderen Zeit versetzt. In
die Gegenwart zurück konnte er normalerweise nur von dem gleichen
Ort aus und mit dem gleichen Ring; nur dann wurde der Kreis wieder
geschlossen. Benutzte jemand den roten Ring, um in die
Vergangenheit zu reisen, und kehrte von dort aus mit dem blauen
Ring wieder zurück, so öffneten sich nacheinander gleich zwei
Kreise. Um sie wieder zu schließen, müßte man dann mit dem blauen
Ring wieder in die Vergangenheit zurück und mit dem roten erneut in
die Gegenwart heimkehren.
Eine nicht ganz unkomplizierte Sache…
Dadurch, daß Moronthor und Nicandra mit dem Zukunftsring in
die Gegenwart zurückgekehrt waren, befanden sie sich, genau
betrachtet, seither in der falschen Zeit. Der Zukunftsring setzte
das Jahr 1675, in dem sie seinerzeit durch den verunglückten
Heimkehrzauber des Gnoms gestrandet waren, als ihre ›Gegenwart‹
voraus und das Jahr 1994, in dem dieser Zauber stattgefunden hatte,
als ›Zukunft‹. Mithin mußten sie mit eben diesem Ring wieder in die
Vergangenheit zurückkehren. Dann schloß sich der Kreis.
Aber dann waren sie wieder dort, wo sie angefangen hatten: in
der Vergangenheit !
Theoretisch hätten sie am verpfuschten Zeit-Zauber des
magiekundigen Gnoms ansetzen müssen. Das war aber in der Praxis
völlig unmöglich. Hier ließ sich einfach nichts mehr
korrigieren.
Es war ein Dilemma, aus dem weder Moronthor noch einer seiner
Freunde bisher einen Ausweg finden konnten. Egal, wie sie es
versuchten -entweder öffnete sich jeweils ein neuer Kreis, oder es
endete im völligen Chaos. Und weder mit der einen noch mit der
anderen Perspektive war ihnen gedient.
Und nun kam Eva und behauptete, genau dieses Problem lösen zu
können?
Es fiel Moronthor schwer, das einfach so hinzunehmen.
Zumal Eva selbst ein Problem auf Beinen war.
Sie war vor etwa einem halben Jahr unversehens aus dem Nichts
aufgetaucht. Bewußtlos hatte sie vor dem Haupttor der
Umfassungsmauer von Château Aranaque gelegen, trotz der
Februarkälte recht freizügig in Leder gekleidet und mit einem
langen Dolch bewaffnet. Als sie erwachte, besaß sie keine
Erinnerung an ihr früheres Leben, wußte nicht einmal ihren Namen.
Deshalb hatte man sie der Einfachheit halber Eva genannt, und sie
akzeptierte den Namen, weil er ihr gefiel.[3]
Sie beherrschte mehrere Sprachen, kannte eine Menge Dinge,
ohne zu wissen, woher. Es gab keinen Zugriff zu ihrer
Vergangenheit. Aber sie besaß eine merkwürdige Fähigkeit: sie
konnte magische Energie aufsaugen, um sie später für eigene Zwecke
zu verwenden.
Nur zwei Monate später war sie in Lyon ermordet aufgefunden
worden, Ihr Leichnam verschwand.
Und wieder zwei Monate darauf tauchte Eva in Italien wieder
auf. Und wûeder ohne Erinnerung. Sie wußte auch nichts davon, daß
sie vorher einige Zeit im Château Aranaque zugebracht hatte. Erst
recht nicht, daß sie ermordet worden war. Es war, als wäre alles
Bisherige überhaupt nicht geschehen. Sie fing praktisch am Punkt
Null wieder an.[4]
Nachforschungen über ihre Identität hatten bislang nicht viel
erbracht. Das einzige, was Moronthor und Nicandra herausgefunden
hatten, war, daß sie scheinbar die Tochter des uralten Zauberers
Merlin war - eine seiner Töchter.
Das war aber auch schon alles. Selbst die Erwähnung Merlins
hatte in Eva keine Erinnerung geweckt.
Das einzige, was sie wußte, war, daß sie die recht freizügige
Lederkleidung ablehnte, die ihr das Aussehen einer Kriegerin aus
einem Fantasy-Film gab. Diese Art von Bekleidung sei absolut nicht
ihre Welt, hatte sie bisher immer wieder behauptet und auch
mehrfach versucht, die Sachen loszuwerden. Aber so oft sie sie
wegwarf, so oft kehrten sie auf rätselhafte Weise zu ihr und an
ihren Körper zurück. Dafür gab es bisher keine Erklärung. Aber es
geschah immer dann, wenn sie ihre spezielle Para-Fähigkeit
einsetzte.
Die war auch etwas Unbegreifliches. Ted Ewigk vermutete, sie
sei möglicherweise eine Gkirr - was dadurch ad absurdum geführt
wurde, daß sie offenbar Merlins Tochter war. Sie selbst lehnte ihr
Para-Können resolut ab, sie wollte es nicht akzeptieren und auch
nicht daran arbeiten, um es kontrollieren zu können. So zeigte sich
diese Fähigkeit stets dann, wenn niemand wirklich damit rechnete,
und speziell in den gefährlichsten Situationen. Denn sie machte
keinen Unterschied, ob sie Freunden oder Gegnern Magie entzog. Das
konnte Freunde in arge Bedrängnis bringen. Eva in der Nähe zu
haben, war deshalb stets ein gewaltiger Risikofaktor, wenn es um
den Einsatz von Magie ging.
Wie schon in ihrer ›ersten Phase‹ lebte sie im Château
Aranaque. Hier konnte sie sich in Sicherheit und unter Freunden
fühlen.
Und nun tauchte sie in Moronthors Arbeitszimmer auf und wollte
die Lösung eines enormen magischen Problems kennen?
»Was weißt du über die Zeitringe?« fragte Moronthor. Er konnte
sich nicht erinnern, ihr einen der beiden Ringe jemals gezeigt zu
haben.
»Es wurde darüber gesprochen«, sagte sie spröde. »Es wurde
auch über Don Cristofero gesprochen. Er scheint ein recht
unangenehmer Mensch zu sein.«
Moronthor schmunzelte.
»Wenn ich dich so höre, gehe ich davon aus, daß es Nicandra
war, die darüber gesprochen hat. Stimmt's, oder habe ich
recht?«
Eva schwieg.