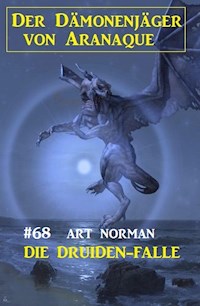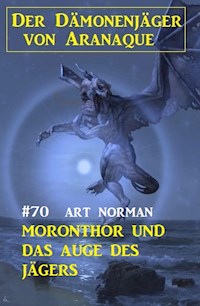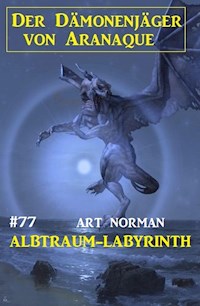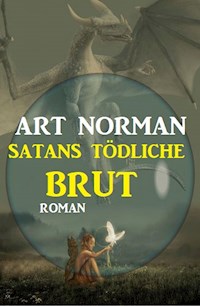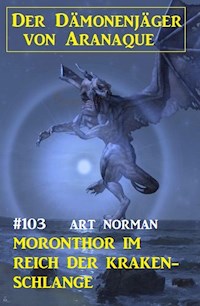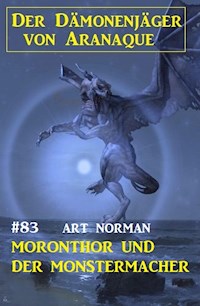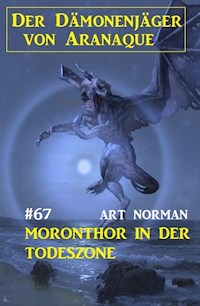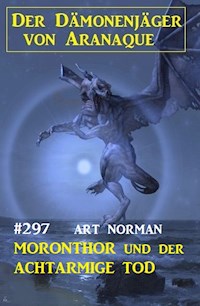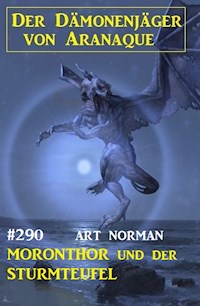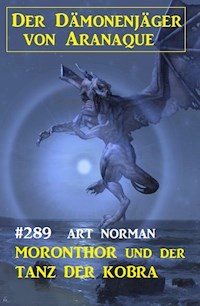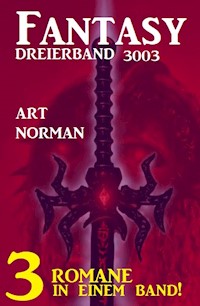Er warf zwei Schatten. Den dritten hatte die Fürstin der
Finsternis zerstört.
Sie glaubte, damit auch ihn zerstört zu haben. Aber er lebte
noch, es gab ihn nach wie vor. Den Mörder, den Diener der Teufelin,
den ehemaligen Sicherheitsbeauftragten der Tendyke Industries. Den
erklärten Gegner von Robert Tendyke und Professor Moronthor.
Rico Calderone.
Zwei Schatten besaß er noch. Einen, den er selbst warf. Und
den anderen, den er zusammen mit dem zerstörten von Lucifuge
Rofocale erhalten hatte. Vom Herrn der Hölle. Dessen Magie steckte
in Calderone, füllte ihn aus und wartete darauf, aktiv zu werden.
Sie hatte ihn sogar davor gerettet, vom Zorn der Fürstin getötet zu
werden.
Sie hatte sich gegen ihn gestellt. Also hinderte ihn nichts
mehr daran, sich seinerseits gegen sie zu stellen.
Er war sicher, daß Stygia, die Fürstin der Finsternis, nicht
mehr mit ihm rechnete. Sie hatte ihn mit einem magischen Schlag aus
dem Universum gefegt, den er eigentlich nicht hätte überleben
dürfen.
Aber er hatte ihn überstanden. Stygia hatte lediglich einen
der magischen Schatten vernichten können. Einen der Schatten, von
denen er nicht sicher war, ob er sie wirklich benötigte.
Diese fremden Schatten besaß er, seit er aus einem Alptraum
zurückgekehrt war, von dem er jetzt wußte, daß er auf eine
unbegreifliche Weise Wirklichkeit gewesen war. Die Schattenmacht
hatte damals verhindert, daß er an einem von Moronthor geworfenen
Dolch starb.[1]
Seit jener Zeit war er aber auch ein Diener des Lucifuge
Rofocale.
Warum, begriff er nicht. Doch seit er erkannt hatte, daß er
damals nicht nur träumte, fühlte er sich sicherer. Er war nicht
mehr von Stygia abhängig. Er hatte einen mächtigeren Herrn.
Der hatte sich ihm gegenüber bisher noch nicht bemerkbar
gemacht.
Da war eine vage Hoffnung, daß er nicht einmal etwas von
seinem neuen Diener wußte, daß all das, was mit dieser Magie
zusammenhing, gewissermaßen automatisch abgelaufen war. Aber diese
Hoffnung war wirklich nur sehr vage. Vermutlich würde sich Lucifuge
Rofocale schon sehr bald bei seinem neuen Diener ›melden‹.
Bis dahin hatte Calderone freie Hand.
Denn mittlerweile hatte Stygia ihn aus ihrem Dienst
›entlassen‹. Auf ihre Weise - indem sie ihn beseitigte.
Genauer gesagt, sie hatte versucht, ihn zu beseitigen. Sie
ahnte nicht, daß es ihn noch gab. Das sollte eine Überraschung für
sie werden!
Sie hielt ihn für einen Versager. Zweimal hatte er in ihrem
Auftrag versucht, eine tödliche Falle für Moronthor aufzustellen.
Beide Male war es schiefgegangen. Das war für Calderone kein Grund
zur Aufregung; er wußte nur zu gut, mit welchen starken und
gerissenen Gegnern er es zu tun hatte. Da konnte einfach nicht
alles auf Anhieb klappen.
Die Fürstin der Finsternis sah das anders.
Sie duldete keine Fehlschläge, die sie als Versagen
betrachtete. Zweimal hatte es nicht funktioniert. Das war für sie
Grund genug, den ›Versager‹ zu bestrafen und sich seiner zu
entledigen.
Dabei wertete sie mit zweierlei Maß. Calderone wußte, daß sie
selbst schon viel öfter gegen Moronthor und seine Mitstreiter
versagt hatte. Dafür hatte sie sich selbst natürlich nicht
bestraft…
Calderone verzog das Gesicht und schüttelte den Kopf. Diese
Närrin! Sie hatte ihn verraten. Er hatte ihr geholfen, hatte alles
gegeben, um für sie zu arbeiten, und sie hatte dafür versucht, ihn
umzubringen! Gut, er hatte nicht unbedingt Dank erwartet;
schließlich wußte er, daß er es mit einer Dämonin zu tun hatte.
Aber daß sie soweit ging, für Kleinigkeiten, die sie bei sich
selbst völlig ignorierte und verdrängte…
Dafür würde er sie zur Rechenschaft ziehen.
Aber allein ging das nicht.
Sein bester Helfer wäre natürlich sein stärkster Helfer
gewesen - sein neuer Herr, Lucifuge Rofocale. Doch es war fraglich,
ob der Erzdämon seinem neuen Diener den Gefallen tun würde, ihn
gegen Stygia zu stärken.
Natürlich würde er es können. Aber warum sollte er es tun?
Wenn er mit ihr als Fürstin der Finsternis nicht einverstanden
gewesen wäre, hätte er sie längst entfernen können. Er würde kaum
eines Menschen wegen gegen sie vorgehen.
Außerdem wollte Calderone ihn nicht unnötig auf sich
aufmerksam machen. Es reichte, wenn Lucifuge Rofocale ihn
irgendwann von selbst fand und in seinen Dienst preßte. Und dann
zumindest konnte er nicht sagen, Calderone hätte seinerseits schon
einmal einen Gefallen von ihm erbeten und sich ihm damit noch
weiter verpflichtet…
Wenn er Stygia angreifen wollte, mußte er es anders anstellen.
Er mußte seine Helfer und Verbündeten unter ihren erklärten Feinden
suchen.
Damit würde sie garantiert nicht rechnen. Und wenn, dann würde
sie einen Angriff diesen Feinden zurechnen.
Vor allem, wenn diese Feinde jene waren, die Calderone gerade
noch gemeinsam mit ihr, beziehungsweise in ihrem Auftrag bekämpft
hatte!
Es war der Gipfel der Dreistigkeit, daß er sich ausgerechnet
an Professor Moronthor wenden wollte…
***
Moronthor dachte an nichts Böses, bis er die schaurigen Klänge
vernahm. Er riß die Tür seines Arbeitszimmers auf und lauschte. So
etwas Schräges hatte er bisher noch nicht gehört.
Es kam von unten.
Seufzend durcheilte er den Korridor und bewegte sich die
Treppe hinunter, der Lärmquelle entgegen. Dabei wurde er überholt
von Lady Patricia Saris, die aus dem Seitentrakt des Châteaus kam,
in dem sie und ihr Sohn Rhett eine Reihe von Zimmern bewohnten. Von
der vagen Ahnung beflügelt, daß sie vielleicht wisse, welchen
Ursprung der unmögliche Krach hatte, streckte Moronthor den Arm
aus, um sie festzuhalten, aber sie war schon an ihm vorbei.
»Was ist denn los?« rief er ihr nach.
Sie war schon halb die Treppe hinunter.
»Dieses Monstrum hat meine Gitarre geklaut!«
Moronthor hob die Brauen. Was da aus dem Parterre erklang,
hörte sich eher nach einem Dutzend gegeneinander kämpfender Kater
und rolliger Katzen an, denen jemand leere Blechdosen an die
Schwänze gebunden hatte.
Als Moronthor den ›Tatort‹ erreichte, fand er bereits Madame
Claire vor, die Köchin, die täglich aus dem Dorf zum Château hinauf
kam, um für das leibliche Wohl der Bewohner zu sorgen.
Von der anderen Seite stürmte Raffael Bois heran, der alte
Diener, ohne den Château Aranaque überhaupt nicht vorstellbar war.
Ihm auf dem Fuß folgte William, Lady Patricias Butler, der dem
alten Raffael gern zur Hand ging und ihn unterstützte, wo er
konnte.
Hinter Moronthor tauchten das Para-Mädchen Eva und Moronthors
Gefährtin Nicandra Darrell auf. Damit waren sie bis auf Sir Rhett,
den inzwischen beinahe 5jährigen Sohn Patricias, erstmal
vollständig.
Inmitten der Eingangshalle bewegte sich ein eigenartiges
Wesen.
Aus einem wehenden Umhang und einer Mischung aus Gardine und
Rüschenhemd schaute ein Krokodilschädel mit großen Telleraugen
hervor. Kurze Stummelflügel hielten den Umhang in ständiger
Bewegung. Ein Drachenschweif wedelte schwungvoll hin und her. Und
mit den vierfingrigen Händen malträtierte das seltsame Wesen eine
Gitarre. Zwischen den extrem blechernen Klängen hindurch ertönte
die krächzende Stimme des Geschöpfes.
»…Piep, Piep, Piep - Fooly hat euch lieb…!«
»Ich glaub's nicht«, murmelte Moronthor.
»Mister MacFool!« donnerte Butler William.
Der kostümierte Jungdrache hieb mit den Krallenfingern wieder
auf die Gitarrensaiten ein, erzeugte Töne, die er wohl für
gelungene Akkorde hielt, und fuhr fort, einen seltsamen Text zu
singen, der sich mal reimte und mal nicht. Dann wieder der Refrain:
»Piep, Piep, Piep - Fooly hat euch lieb!«
Lady Patricia stürmte auf selbigen zu und wollte ihm die
Gitarre entreißen. Aber Mister MacFool geruhte sich ihr mit einer
raschen Körperdrehung zu entwenden, flatterte ein Stück in die Höhe
und riß eine Ritterrüstung um, die auf einem Sockel aufgestellt
war. Scheppernd zerlegte sich das blankpolierte gute Stück in all
seine Bestandteile, die sich über mehrere Quadratmeter
Marmorfliesen verstreuten.
»Gib sofort meine Gitarre her, du Scheusal!« tobte die
schottische Lady gar nicht ladylike. »Ich dreh' dir Mistvieh den
Hals um! Was, in Dreiteufelsnamen, machst du da?«
Der Jungdrache unterbrach seine musikalische Darbietung und
reckte, sich dabei drehend, die Gitarre so hoch, daß Patricia es
nicht schaffte, sie ihm zu entreißen.
»Ich übe!« krähte Fooly.
»Du übst? Wie man ein Musikinstrument zerstört, wie?«
»Kulturbanausin!« fuhr der Jungdrache sie an. »Was verstehst
du schon von wahrer Musik?«
»Eine ganze Menge!« hielt Patricia dagegen. »Bei uns in
Schottland basiert Musik noch auf Können und Harmonie, und außerdem
fragt man, bevor man anderen die Instrumente klaut.«
»Ach, wenn doch in Schottland auch jemand die Zuhörer fragen
würde, ob sie das Dudelsackgejaule auch wirklich hören wollen«,
seufzte Madame Claire.
Prompt fand Lady Patricia einen neuen Feind. »Gejaule? Was
erlauben Sie sich? Wie können Sie es wagen…«
Moronthor näherte sich derweil dem Drachen. »Von wahrer Musik
ist das, was du hier aufführst, aber ziemlich weit entfernt. Was
soll das?«
»Pah«, machte der Drache verächtlich. »Ihr habt wirklich keine
Ahnung. Dabei solltet ihr mir dankbar sein für das, was ich tue.
Ich übe für meinen großen Auftritt! Ich werde nach Birmingham
fliegen und da…«
»Birmingham?« hakte Nicandra ein. »Doch nicht etwa zur
Auto-Ausstellung am 20. Oktober?«
»Vielleicht wäre es effektiver, am 10. Oktober zum
Buchmesse-Convent nach Frankfurt zu fliegen«, murmelte Moronthor.
»Wer will sich schon einen Haufen scheußlicher Kleinwagen
anschauen, wenn's Bücher zu sehen, Autogramme zu schreiben und
Vorträge zu hören gibt…«
»Papperlapapp! Bücher! Autos! Was Vernünftigeres fällt euch
wohl nicht ein?« Der Drache wedelte mit der Gitarre und den
Flügeln. »Ich fliege nächstes Jahr nach Birmingham und werde mit
meinem Lied den Grand Brie gewinnen.«
»Grand Prix heißt das!« korrigierte Nicandra automatisch.
»Grand Prix d'Eurovision de la Chanson…«
»Unsinn!« maulte Fooly. »Prix ist doch dieser
Indianerhäuptling, der in den Winnetou-Filmen mitspielt! Pierre
Prix!«
»Der«, stöhnte Nicandra, »heißt Pierre Brice!«
»So ein Käse«, winkte der Jungdrache ab. »Kann ich was dafür,
wenn ihr Franzosen nicht richtig sprechen könnt? Auf jeden Fall
werde ich nächstes Jahr in Birmingham gewinnen.«
»Erstens«, stellte Moronthor klar, »findet im nächsten Jahr
der Grand Prix nicht in Birmingham statt. Zweitens wirst du mit
deinem Gekrächze und Gehüpfe höchstens mit einer Mischung aus
Papagei und Rabe verwechselt, aber kaum etwas gewinnen!«
»Guildo Horn hat doch auch gewonnen!« trumpfte Fooly
auf.
»Drüben in Deutschland. Aber nicht in Birmingham. Da hat er
nur den siebten Platz erreicht.«
»Dann gewinne ich eben auch mit dem siebten Platz!« sagte
Fooly energisch. »Und jetzt laßt mich gefälligst weiter üben!
Schließlich bin ich noch besser als der ›Meister‹.«
»Und verscheuchst die Geister«, reimte Eva spöttisch im
Hintergrund.
Das hatte Fooly gehört. »Klasse!« stieß er hervor. »Das
übernehme ich in den Liedtext: Ich bin besser als der ›Meister‹ und
verscheuche alle Geister! Piep, piep, piep, Fooly hat euch
lieb…«
»Ich fasse es nicht«, ächzte Patricia, die ihre
Grundsatzdiskussion mit Madame Claire mittlerweile zu gegenseitiger
Unzufriedenheit abgeschlossen hatte. »Der begreift’s einfach nicht!
Her mit meiner Gitarre, sofort!« Diesmal schaffte sie es, ihm das
Instrument aus den Klauen zu pflücken. Sofort retirierte sie um
einige Meter und betrachtete es prüfend. »Himmel, dieser komische
Vogel hat ja noch das Blättchen zwischen den Saiten stecken…« Dort
pflegte sie das kleine Hilfsmittel zu fixieren, wenn sie nicht
spielte, damit es nicht verlorenging. Jetzt zupfte sie es hervor
und schlug damit ein paar Akkorde an. »Kein Wunder, daß das so
schräg klang.«
Sie sah Fooly drohend an.
»Wenn du dich noch einmal ungefragt an meinem Instrument
vergreifst, bist du nicht nur fällig, sondern anschließend auch
baufällig!«
Zornig stapfte sie davon.
Fooly sah nacheinander Moronthor und Nicandra an. »Apropos
Instrument und Auto-Ausstellung. Wir müssen mit dem Cadillac in die
Stadt fahren«, verlangte er. »In irgendein Musikgeschäft. Ich muß
sofort eine Gitarre haben!«
»Hier muß keiner was!« fauchte Nicandra ihn an. »Und schon gar
nicht mußt du eine Gitarre haben oder wir dafür extra nach Feurs
oder Roanne fahren! Erst recht nicht mit meinem Cadillac! Diese
Kostprobe deines Untalents reicht mir völlig!«
»Keiner versteht mich«, seufzte der Drache. »Keiner hat mich
lieb.«
Er warf den Umhang und das seltsame andere Etwas von sich, in
das er sich gehüllt hatte, und watschelte auf seinen kurzen Beinen
davon.
»Ich weiß gar nicht, was Sie alle haben«, sagte Madame Claire.
»Ich fand ihn ganz hervorragend!«
Fooly blieb abrupt stehen und drehte sich um. »Was?« stieß er
überrascht hervor. »Ausgerechnet du, Madame Claire? Dabei hackst du
sonst doch immer nur auf mir herum!«
»Bisher wußte ich ja auch noch nicht, wie gut du singen
kannst, Fooly«, sagte sie. »Also, meine Stimme kriegst du auf jeden
Fall! Und jetzt werde ich erst mal Nußecken backen.« Sprach's und
eilte in Richtung Küche davon.
»Ha, wenigstens ein Mensch mit Musikverstand in diesem Haus!«
triumphierte Fooly und entkam nach draußen.
Moronthor und Nicandra sahen sich an.
»In unserer Köchin entdecke ich immer neue menschliche… nein,
unmenschliche Abgründe«, erkannte Moronthor. »Wer hätte gedacht,
daß sie in Sachen Musik eine solche Masochistin ist?«
***
Fooly marschierte derweil über den gepflasterten Vorhof zum
Tor. Er schritt hindurch und überlegte sich, was er als nächstes
unternehmen konnte. Die Sonne schien, er hatte Zeit und wußte nicht
viel mit sich anzufangen. Sein menschlicher Spielkamerad Rhett war
unten im Dorf bei den Kindern von Pascal und Nadine Lafitte.
Vielleicht sollte er einmal nachschauen, was die jetzt gerade
trieben.
Er breitete die Schwingen aus, erhob sich in die Luft, und da
gerade keiner zuguckte, spielte er nicht den beinahe
fluguntüchtigen Tolpatsch, sondern glitt elegant über die Felder
den Berghang hinab und dem Dorf entgegen.
Daß seine Flügel tatsächlich viel zu kurz waren, um sein nicht
unerhebliches Gewicht tragen zu können, interessierte ihn dabei
herzlich wenig. Das war eine Sache der Schwerkraft und anderer
Naturgesetze, um die er sich noch nie gekümmert hatte. Er wollte
fliegen, also tat er es, auch wenn jene Naturgesetze dagegen
waren.
Solange sie sich nicht beschwerten…
***
»Jetzt haben wir ihn tödlich beleidigt«, sagte Eva und strich
sich mit einer fahrigen Geste durch das lange, blonde Haar.
»Vielleicht sollte ich ihm nachgehen und ihn zurückholen.«
Nicandra schüttelte den Kopf. »Das gehört zu seiner Schau. Der
pfiffige Bursche grinst längst innerlich und stellt sich vor, wie
wir uns jetzt seinetwegen in die Haare kriegen.«