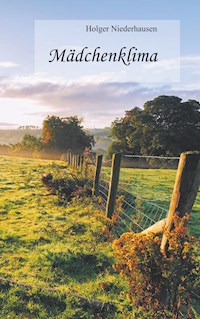Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die vierzehnjährige Rahel ist ein tief frommes Mädchen. Der Tag ihrer Konfirmation lässt dann aber unerwartet Fragen in ihr aufbrechen. Als sie sich nach einem Schicksalsschlag, der sie mit heftigen Schuldgefühlen belastet, fast selbst das Leben nimmt, rettet sie nur eine junge Frau, die aber selbst nicht die geringste Wärme zu besitzen scheint. Unauflöslich ist daraufhin ihre Sehnsucht, gerade zu Kira eine Brücke zu finden ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Menschenwesen hat eine tiefe Sehnsucht nach dem Schönen, Wahren und Guten. Diese kann von vielem anderen verschüttet worden sein, aber sie ist da. Und seine andere Sehnsucht ist, auch die eigene Seele zu einer Trägerin dessen zu entwickeln, wonach sich das Menschenwesen so sehnt.
Diese zweifache Sehnsucht wollen meine Bücher berühren, wieder bewusst machen, und dazu beitragen, dass sie stark und lebendig werden kann. Was die Seele empfindet und wirklich erstrebt, das ist ihr Wesen. Der Mensch kann ihr Wesen in etwas unendlich Schönes verwandeln, wenn er beginnt, seiner tiefsten Sehnsucht wahrhaftig zu folgen...
Und ich will dir des Himmelreichs Schlüssel geben:
alles, was du auf Erden binden wirst,
soll auch im Himmel gebunden sein,
und alles, was du auf Erden lösen wirst,
soll auch im Himmel los sein.
(Matthäus 16,19)
Sie kniete vor ihrem Bett, wie jeden Abend, und betete. Ihre Hände lagen gefaltet auf der Bettdecke, aber ihre Seele lebte in dem Gebet, und ihr Gebet hob sich zu Gott...
„...denn dein ist das Reich ... und die Kraft ... und die Herrlichkeit ... in Ewigkeit... Amen...“
Sie ließ ihre Augen geschlossen. Ihr Herz war erfüllt von Trauer, und diese Trauer hatte zwei Ursachen. Der jetzt zu Ende gehende Tag war der Karfreitag. An diesem Tag hatte man den HERRN gekreuzigt. Und mit aller Kraft ihres reinen Herzens fühlte sie diese ungeheuerliche Tatsache...
Aber das Andere war ... dass sie mit ihrem Leid, ihrem Mitleid, mit all ihren Empfindungen ganz allein war. Sie sehnte sich so sehr danach, dass die Menschen dies fühlten, daran dachten – an das, was heute geschehen war, an das, was heute für ein Tag war. Aber das taten sie nicht, hatten es nicht getan. Ihre Eltern nicht, ihre Freunde nicht, ihre Bekannten und Verwandten nicht, nicht die Leute auf der Straße ... niemand. Der Einzige, der vielleicht auch daran gedacht hatte, ganz bestimmt sogar, war ihre Oma. Wie gern wäre sie heute bei ihr gewesen! Aber sie lebte in Süddeutschland, und das war nun ganz das andere Ende. Sie war viel zu weit weg, viel zu weit... Und hier, hier war sie ganz allein mit alledem...
Ja, natürlich, sie hatten auch im Konfirmationsunterricht darüber gesprochen. Aber da wurde alles immer nur besprochen! Und die anderen hörten sich das an – und glaubten es sowieso nicht. Sie konnte auch nicht verstehen, warum die anderen konfirmiert werden wollten. Vor allem die Jungs. Sogar darüber hatten sie Witze gemacht! Es hatte überhaupt keinen einzigen Tag gegeben, an dem es ernst geblieben war. Es unterschied sich fast nicht von Schule. Aber dass selbst an dem Tag, wo sie über den Karfreitag gesprochen hatten, Witze gemacht wurden – und sogar ... sogar darüber... Es hatte ihr das Herz zerrissen. Sie hatte weglaufen wollen, einfach nur weglaufen – aber sie war sitzengeblieben. Wie immer. Stumm und einsam. Niemand verstand sie.
Heute beim Gottesdienst war auch niemand aus ihrer Gruppe dagewesen. Nur sie allein. Und auch der Gottesdienst selbst... Es war eine Art Erinnerung an den Karfreitag – aber nur das. Es schien sogar dem Pfarrer unangenehm gewesen zu sein – und er lenkte seine Predigt schließlich auch schon auf Ostern. Obwohl doch erst Karfreitag war! Sie musste an den Garten Gethsemane denken. Als Jesus seine Jünger schlafend fand, obwohl er sie selber gebeten hatte, wachzubleiben und zu beten, wie er... Und nun dachten auch im Gottesdienst die Menschen nicht richtig an ihn! Selbst der Pfarrer nicht. Niemand dachte an Jesus, wie er am Kreuz hing, wie er gekreuzigt wurde, wie er leiden musste, leiden!
Warum dachte niemand an Ihn? Warum war sie ganz allein mit ihren Gefühlen? Warum war sie den ganzen Tag so einsam geblieben, so verlassen, innerlich so unendlich einsam... Warum war er so einsam? Er war doch für alle gestorben? Warum konnte man das nicht ... warum fühlte man das nicht? Warum war dieser Tag ein Tag wie jeder andere? Warum ließen ihn alle Menschen allein? Der HERR starb – und niemand fühlte etwas!
Sie öffnete ihm ihr ganzes Herz und bat ihn mit aufrichtiger Scham um Verzeihung, dass auch sie noch viel mehr hätte tun können. Ach! Man konnte immer so viel tun, noch viel mehr fühlen – nie tat man genug. Man wusste selbst, wie wenig es war – noch immer so wenig... Sie brachte ihm, dem HERRN, gleichsam ihr ganzes, reines und doch so schwaches Herz dar. Und sie dachte an sein Leiden, seinen Tod, seinen vollkommen unschuldigen Tod. Und sie dachte daran, wie jeder daran vorbeiging, nicht einmal mehr an ihn dachte. Wie sein Leiden völlig gleichgültig war, heute. Und auf einmal musste sie weinen...
Ihr reines Herz weinte, in hilflosem Schmerz konnte es dies anders nicht mehr aushalten – Jesus, sterbend am Kreuz, und die Menschen gleichgültig, ja, es nicht einmal bemerkend. Es überstieg ihre Vorstellung. Man konnte es nicht verstehen. Und ihr eigenes kleines Herz flog zum Erlöser, war bei ihm, hilflos, aber bei ihm, wenigstens das ... und ihre Tränen fielen auf die Erde unter seinen Füßen...
*
In dieser Nacht träumte sie von ihrer Konfirmation, die in neun Tagen bevorstand. Sie träumte, wie sie in ihrem weißen Kleid dastand und wie auf einmal der HERR selbst kam, wie von vorne, vom Altar her, eingehüllt in Licht, selbst gleichsam Licht, wie ein Engel ... und wie alles andere unwesentlich wurde, wie die albernden Jungs verstummten, weil man sie nicht mehr hörte, und wie alles wie verwundert schien, weil alle ungläubig schauten – dabei zugleich zurückbleibend, in eine Peripherie verschwindend –, ungläubig zusahen, wie er, der HERR, auf sie zuging, nur auf sie, aus irgendeinem Grunde nur auf sie...
„Rahel – wir brauchen noch Milch. Kannst du kurz einkaufen gehen?“
„Ja, Mama.“
„Und – dann bring auch gleich noch ein Brot mit. Ich glaube, es reicht zwar bis Dienstag, aber es könnte knapp werden.“ „Ja, mache ich...“
Ihr Mutter lächelte ihr zu. Sie hatte die Haare hochgesteckt und würde gleich ein Bad nehmen. Es war Samstagvormittag. Karsamstag.
Sie ging zur Handtasche ihrer Mutter und nahm einen Fünf-Euro-Schein heraus. Dann ging sie mit einem Stoffbeutel in der Hand nach draußen.
Sie wohnten in einem recht frequentierten Stadtteil. Sogar einige Touristen verirrten sich hierher. Geschäfte, Cafés und anderes lagen hier alle in Laufnähe. Das war zwar angenehm, meist aber wünschte sie sich ganz woandershin. Wohin genau, wusste sie selbst nicht. Ihre Oma wohnte in einem kleinen Ort. Dort fand sie es immer schön. Es gab nicht so viele Menschen, die sich alle nicht kannten – und dafür viel Natur in viel größerer Nähe...
Als sie an dem Bettler vorbeikam, der mit seinem struppigen Gesicht vor dem Supermarkt saß, legte sie ihm einen Euro in seinen Pappbecher. Der Bettler blickte auf, erkannte sie und bedankte sich in seinem nuschelnden Tonfall, den sie schon so gut kannte. Sie lächelte ihm zu, dann ging sie durch die Glastüren, die sich automatisch öffneten.
Sie schämte sich vor dem Bettler. Einmal in der Woche legte sie ihm eine Fünfzig-Cent-Münze in den Becher. Heute hatte sie extra einen Euro hineingelegt, denn es war Karsamstag. Aber es war nie genug – wie könnte es für einen so armen Menschen jemals genug sein, was man hineinlegte? Sie wusste, dass es nicht genug war. Aber sie hatte ja selbst nicht mehr... Sie bekam fünf Euro Taschengeld in der Woche. Sie freute sich, wenn sie sah, dass der Bettler sich freute, sie zu sehen. Ihr ging es auch so – und doch schämte sie sich immer. Und so ging sie noch immer jedes Mal beschämt weiter, obwohl sie dies gar nicht wollte. Sie wollte ihm etwas Liebes sagen. Aber sie traute sich nicht, sie fand die richtigen Worte nicht – und sie schämte sich. Vor allem dies...
Aber ihr Vater verdiente als einfacher Büroangestellter nicht gut, und ihre Mutter arbeitete halbtags als Bedienung. Mehr konnte sie nicht, sie hatte irgendetwas mit den Beinen. Auch das tat ihr leid.
Sie hatte auch nie nach mehr Taschengeld zu fragen gewagt. Die Mieten waren sehr teuer, und sie wusste, dass ihr Vater ein wenig Geld zurücklegte – ,für dein Studium später’. Sie wusste noch überhaupt nicht genau, was das alles bedeutete, was es kostete, was für ein Studium es überhaupt sein sollte ... aber jetzt hatte sie eben nur fünf Euro pro Woche.
Sie sparte, was sie konnte. Und dann konnte man sich nach vier oder nach sechs Wochen ein Buch kaufen. Sie liebte es zu lesen. Sie musste sich sogar eingestehen, dass sie es liebte, Stunden vor den Regalen in der großen Buchhandlung zu verbringen, obwohl diese selbst auch fast ein Supermarkt zu sein schien. Aber hier konnte man wirklich stundenlang suchen, stöbern, hineinlesen in ein Buch, sich lange überlegen, ob man das gesparte Taschengeld für dieses ausgeben wollte oder lieber für ein anderes... Manchmal dauerte es fast eine Stunde, sich überhaupt zu entscheiden, weil man nur eines nehmen konnte...
Sie fühlte sich in letzter Zeit zu Balladen und Gedichten hingezogen. Und so hatte sie sich neulich eine Sammlung aus verschieden Jahrhunderten gekauft – ihre Mutter hatte darüber den Kopf geschüttelt. Aber das tat sie sowieso. Auch über die religiösen Bücher, etwa über das Heilige Land. Aber sie wollte das alles wissen. Für sie war es schön, darüber zu lesen, ja, mehr als das. Sie konnte nicht verstehen, wie man sein Taschengeld für Kino ausgeben konnte, oder für Burger King, für Süßigkeiten – für all das, was ... ihr so wertlos schien. Bücher waren niemals wertlos. Sie enthielten gerade das, was ... wirklich Bedeutung hatte, wertvolle Bedeutung.
Sie war bei dem Regal mit der Milch angelangt. Sie nahm zwei Flaschen Biomilch und legte sie in ihren Einkaufskorb. Es gab seit langer Zeit nur noch zwei kleine Reihen. Alles daneben waren Tetrapacks. Offenbar wollte fast niemand die Flaschen – und auch nicht Bio. Die Bio-Tetrapacks waren auch viel weniger als die anderen. Aber sie hatte zumindest ihre eigenen Eltern davon überzeugt, dass es einen Unterschied machte ... der auch wichtig war...
Auf dem Weg zur Kasse ging sie noch an dem Brotregal vorbei. Hier gab es gar nicht erst die Möglichkeit, Bio zu wählen. Sie legte das übliche Kastenbrot in den Korb.
An der Kasse legte sie Flaschen und Brot auf das Laufband und stellte den Korb in den vorgesehenen Stapel zurück.
„Hallo, Rahel!“, begrüßte sie die Kassiererin.
„Hallo, Linda“, grüßte sie lächelnd zurück.
„Über Ostern nicht verreist?“
„Nein...“
„Na dann – fünf Euro siebzehn bekomme ich von dir.“
„Oh... Ist ... ist die Milch teurer geworden?“
„Was? Nein, die Milch nicht. Aber das Brot. Von zwei neunundsiebzig auf zwei neunundneunzig.“
„Ich ... ich habe jetzt nur fünf Euro mitgenommen...“
Die Kassiererin lächelte.
„Lass mal gut sein. Bring es beim nächsten Mal mit...“
„Wirklich?“, fragte sie erleichtert. „Danke! Ich mache es bestimmt. Wirklich!“
„Das weiß ich doch, Rahel...“
Beschämt reichte sie der Frau den Fünf-Euro-Schein.
„Hier...“
„Danke.“
Sie kassierte und legte dann den Bon zu dem Brot und den beiden Flaschen.
„Dann schöne Ostern, Rahel! Bis nächste Woche.“
„Danke, Linda. Dir auch ... schöne Ostern...“
Mit einer Welt von Gefühlen packte sie Brot und Milch in ihren Beutel und ging wieder in Richtung Ausgang.
Noch einmal schenkte sie dem Bettler ein Lächeln, wieder diese Scham, diese Traurigkeit, ihm nicht mehr schenken zu können...
Und dann begleitete die Welt von vorhin sie weiter nach Hause. Linda konnte doch mit Ostern auch nichts anfangen. Für sie waren es doch auch nur zwei weitere freie Tage. Sie wünschte einem so lieb schöne Ostern – aber sie wusste doch gar nicht, was das war...! Und so tat ihre ganze Seele weh vor einer Einsamkeit, die sie mit niemandem teilen konnte.
Freundlich waren die Menschen – freundlich zu ihr, weil sie freundlich zu ihnen war. Sehr bald, als sie hierhergezogen waren, hatte sie begonnen, die Kassierer mit Namen zu grüßen. Sie standen auf ihren Schildchen. Bald kannte sie auch die Vornamen – weil die Menschen sie ihr anboten. Das war etwas Schönes, so ein Moment der Begegnung. Aber an ihrer grundsätzlichen Einsamkeit änderte es nichts – sie war gerade da einsam, wo es um das ihr Heiligste ging, und ihr war es das Heiligste, weil es überhaupt das Heiligste war. Was sollte denn sonst heilig sein, wenn nicht das? Aber warum war sie damit so unendlich einsam? Warum empfand niemand sonst dies mehr?
Man freute sich auf zwei freie Tage. Man nutzte den Karsamstag, um noch schnell Milch einzukaufen. Aber warum erlebte niemand, was dies für Tage waren?
Sie hätte es so gern aller Welt gesagt, jedem Einzelnen, jedem – aber die Worte blieben ihr in der Seele stecken. Die Einsamkeit lastete auf ihrem Herzen – und sie fühlte nur, wie die übrige Welt sich dafür gar nicht interessierte.
Zuhause stellte sie die Milch in den Kühlschrank und das Brot in den Brotkasten. Dann sagte sie ihrem Vater, dass sie in ihrem Zimmer sei. Er lächelte ihr zu.
Ihre Eltern kannten dies schon vom letzten Jahr – und sie wussten, dass es dieses Jahr genauso sein würde. Immerhin ließen sie sie in ihrer Einsamkeit in Ruhe. Alles andere aber war nicht möglich. Auch ihre Eltern wollten davon nichts hören. Auch für sie waren diese Tage nicht mehr als für Linda. Sie hätten mit ihr vielleicht einen Ausflug oder so etwas gemacht. Aber heute wollte sie das nicht. Heute war Karsamstag, und der HERR war gestorben – für sie alle...
Nein – sie wollte niemals heute einen Ausflug machen. Ihr Herz wollte trauern, wollte mitleiden. Nur das. Mit ihm...
Der Ostermorgen... Als sie erwachte und die Augen aufschlug, war dies ihr erster Gedanke – und sofort war ihr Herz erfüllt von Freude. Nicht nur ihr Herz, ihre ganze Brust ... es war, wie wenn Freude in ihrem Herzen strömte und mit jedem Atemzug ihre Lungen füllte. Der HERR war auferstanden!
Als ihr Blick zu ihrem Fenster ging, sah sie, dass es regnete. Es war der heilige Ostermorgen – und es regnete! Ihr Herz empfand einen kleinen Stich. Es passte nicht, nicht für diesen Tag. Aber ihr Herz schob diesen Stich beiseite und bemühte sich, wieder ganz allein die Freude zu empfinden, die heilige Freude über diesen Tag.
Mit dieser Freude stieg sie aus dem Bett, um sich noch im Nachtkleid vor dieses hinzuknien und zu beten.
Und ihr Gebet bestand nicht aus Worten. Sie bemühte sich einfach nur, die Freude zu empfinden und an Gott zu denken, an Gott und den HERRN, wie er auferstanden war.
Sie dachte mit pochendem Herzen daran, wie er Maria von Magdala erschienen war ... und stellte sich in ihrem unschuldigen Herzen vor, wie es wäre, wenn sie an ihrer Stelle wäre, wenn er ihr begegnet wäre, wenn sie ihm begegnen dürfte...
Reine, unschuldige Hingabe war dies. Herzensregungen, die nichts für sich behielten, so wie der Fluss nichts für sich behielt, wenn er zum Meer floss...
Dann zog sie ihr schönstes Kleid an. Am liebsten hätte sie heute schon ihr weißes Konfirmationskleid angezogen – aber das durfte sie wahrscheinlich nicht. Das durfte sie gewiss erst in einer Woche tragen. Und es war sicher auch richtig so. Dennoch war auch heute nichts schön genug – und am liebsten hätte sie dieses weiße Kleid zweimal besessen, nur um es auch heute tragen zu dürfen, für den HERRN! Innerlich bat sie ihn darum, dass er auch ihr anderes Kleid schön finden möge und es ihr verzeihen möge, dass es nicht noch schöner war...
Dann lief sie in das Schlafzimmer ihrer Eltern und rief es fast.
„Frohe Ostern – liebe Mama, lieber Papa! Frohe Ostern!“
Ihre Eltern machten sich schlaftrunken bemerkbar. Ihr Vater kam darüber nicht hinaus, ihre Mutter richtete sich zumindest auf und sagte, noch immer erst halb wach:
„Frohe Ostern, Liebes. Muss es denn aber schon so früh sein...?“
„Es ist nicht früh, Mama!“, sagte sie überschwänglich, „es ist doch schon nach acht!“
„Wirklich?“
„Ja! In einer Stunde muss ich los – zur Kirche!“
Die Mutter schaute aus dem Fenster.
„O je, es regnet...“
„Das macht doch nichts.“
„Wir wollten doch heute einen Ausflug machen...“
„Ist nicht schlimm, Mama...“
„Könnt ihr vielleicht draußen weiterreden?“, meldete sich jetzt murrend ihr Vater.
„Kommt gar nicht in die Tüte!“, erklärte ihre Mutter nun resolut. „Du stehst jetzt mit uns auf!“
„Zehn Minuten noch...“, brummte ihr Vater.
„Kommt nicht in Frage!“, wiederholte ihre Mutter.
„Mama, lass ihn doch...“, bat sie. „Ich decke erstmal den Tisch. Dann kann Papa noch schlafen...“
Ihre Mutter seufzte.
Sie war schon halb auf dem Weg zur Küche, als sie ihre Stimme noch hörte:
„Du erziehst ihn völlig falsch, Rahel! So wird das nie was mit ihm...“
Sie lächelte mit ihrer ganzen Osterfreude. Das machte doch nichts! Sie tat es doch gerne... Sie hatte ihren Papa doch lieb. Warum sollte er nicht noch zehn Minuten schlafen dürfen. Das durfte er doch...
Mit einem heiligen Gesang im Herzen und auf den Lippen deckte sie den Tisch...
*
Als sie schließlich gemeinsam frühstückten, sagte ihr Vater: „Hmm, mit einem kleinen Ausflug wird es heute wohl nichts...“
„Nein, leider nicht“, stimmte sie bedauernd zu.
Nach kurzer Zeit sagte ihr Vater in einer plötzlichen Idee:
„Wir könnten doch mal wieder in die Therme gehen!“ Er sah abwechselnd seine Frau und sie an. „Was haltet ihr davon? Bei dem Wetter – das bietet sich doch geradezu an!“
Früher hatten sie das manchmal gemacht. Als sie noch klein war, war sie sogar mit in der Sauna gewesen. Danach war sie nur noch geschwommen. Aber auch das mochte sie inzwischen nicht mehr wirklich gern. Das letzte Mal waren sie vor fast einem Jahr dort gewesen.
„Ja, warum nicht?“, erwiderte ihre Mutter zustimmend. „Rahel – was hältst du davon?“
Es fiel ihr immer sehr schwer, ihre Eltern oder irgendjemanden zu enttäuschen, wenn sie so begeistert oder hoffnungsvoll gefragt wurde. Aber sie wollte zugleich auch ehrlich sein.
„Ich ... ich weiß nicht... Ich ... mag nicht mehr so gerne schwimmen...“
„Aber warum nicht?“, fragte ihr Vater. „Du kannst auch mal wieder versuchen, in die Sauna zu gehen. Das ist sehr gesund!“
„Nein...“
„Man kann ein Handtuch umbehalten...“
„Nein, ich möchte das aber nicht...“
Sie verstand nicht, warum man gern in die Sauna gehen konnte. Sie mochte sich vor niemandem entkleiden – auch nicht mit einem Handtuch...
„Aber Schwimmen – warum magst du das nicht mehr?“
Auch das war eine Art Entkleidung. Man trug zwar noch etwas auf der Haut, aber es war nicht mehr sehr viel – und es war alles sehr deutlich... Auch bedeutete ihr das Wasser nicht etwas, was ihr Freude machte. Wozu schwamm man im Wasser? Hin und her? Lieber lief sie irgendwo durch die Natur, durch den Wald, durch Wiesen und Felder. Das mochte sie.
Schwimmen mochte sie nicht.
„Ich weiß nicht“, erwiderte sie. „Es ist einfach so. Ich weiß nicht, was man an Schwimmen so mag...“
„Früher bist du gern geschwommen!“
„Ja, aber jetzt nicht mehr...“
„Rahel...! Du kannst dich nicht immer ausschließen. Lass uns doch heute einmal in die Therme gehen! Ich hätte so große Lust dazu – wann waren wir das letzte Mal dort?“
Ihre Abwehr kippte. Wenn jemand sie bat, war sie kaum fähig, auf dem zu beharren, was sie vielleicht wollte. Ihr Herz wollte den Wunsch und die Bitte eines anderen Menschen nie enttäuschen...
„Aber wir könnten doch auch etwas spielen ... oder so etwas...“
„Rahel! Spielen können wir immer. Aber heute. Das Wetter.
Und weil Ostersonntag ist – zur Feier des Tages...“
Sie hörte, wie sehr ihr Vater sich dies wünschte. Und so kam alle Abwehr in ihr zum Schweigen, verwandelte sich in das Gegenteil, in Zuwendung.
„Gut, Papa ... wenn du willst...“
„Prima, Rahel – ich wusste es doch“, sagte ihr Vater zufrieden und fügte hinzu: „Du wirst sehen, es wird dir auch Spaß machen. Nach so langer Zeit mal wieder!“
Sie erwiderte nichts.
„Wann können wir dann los?“, fragte ihr Vater nun.
„Ich gehe erst zur Kirche, Papa!“
„Ach so, ja...“
„Um halb zwölf bin ich wieder da.“
„Okay, dann fahren wir dann.“
*
Sie ging immer so früh zur Kirche, dass sie eine der Ersten war, oft die Erste. Sie liebte es, in dem noch leeren Gotteshaus zu sitzen und die Stille in sich aufzunehmen – dann das langsame Sich-Füllen. Jetzt aber, am Ostersonntag, war sie nicht die Erste, und es würde ziemlich voll werden. Sie liebte aber auch die Glocken, die irgendwann zu läuten begannen und irgendwann wieder ausklangen. Die Glocken riefen nach den Menschen – und an anderen Orten riefen andere Glocken nach anderen Menschen. ,Kommt ... kommt ... die heilige Stunde naht...’
Und dann begann der Gottesdienst. Ihr Herz sang und war weit geöffnet. Auch während der Predigt, die sie oft nicht so ansprach, wie sie es sich wünschte, blieb ihr Herz in seiner heiligen Offenheit, und sie hörte, als wenn es ganz andere Worte wären. Und als der Gottesdienst seinen Fortgang nahm, war wiederum alles in den Glanz des Ostermorgens gehüllt – und wieder ergänzte ihr eigenes Herz alles, was unvollkommen schien.
Mit ganzer Seele sang sie die Lieder mit – und ganz besonders liebte sie das letzte: ,Jesus lebt, mit ihm auch ich...’ Die Begleitung der Orgel war so wunderschön, dass ihr bei der Stelle ,Er verklärt mich in sein Licht’ eine Gänsehaut über den Rücken lief.
Als die heilige Feier schließlich zu Ende war, sah sie am Ausgang Schwester Sieglinde. Sie war eine schon sehr alte Diakonisse, die sie einmal vor etwa zwei Jahren, als sie krank war, eine Zeitlang besucht hatte. Sie wusste selbst nicht, warum der Pfarrer sie damals gefragt hatte, ob sie dies tun würde – aber es waren sehr schöne Tage gewesen, die erfüllte Gespräche zwischen einer alten Frau und einem damals zwölfjährigen Mädchen gebracht hatten. Seitdem war sie dieser alten Frau innig verbunden und grüßte sie mit größter Freude, wann immer sie sie sah. Noch immer besuchte sie sie alle drei, vier Wochen im Mutterhaus.
„Schwester Sieglinde“, rief sie, indem sie draußen vor der Kirche auf sie zulief, „Schwester Sieglinde!“
Die alte Diakonisse drehte sich etwas mühsam um.
„Rahel, mein Kind! Frohe Ostern!“
„Frohe Ostern, Schwester Sieglinde!“, erwiderte sie, noch immer ganz erfüllt.
„Du siehst ja wunderbar aus, mein Kind! Freust dich wohl schon auf die Konfirmation?“
„Ja, natürlich. Aber ich freue mich vor allem, dass heute Ostern ist. Und dass ich Sie jetzt sehe.“
„Das tue ich auch, mein Kind, das tue ich auch. Willst du mich am Mittwoch nach deiner Konfirmation wieder besuchen?“
„Ja, sehr gerne, Schwester Sieglinde. Auf jeden Fall!“
„Das ist schön... Da freue ich mich... Und was machst du heute noch?“
„Ach...“, gestand sie etwas betrübt. „Wir gehen noch in die Therme. Mein Vater wollte es unbedingt...“
„Und du? Möchtest nicht...?“
„Doch, ich habe ihm zuliebe zugestimmt. Er wollte es so gerne...“
Die alte Diakonisse nickte verstehend.
„Ist schon recht, mein Kind, ist schon recht... Du hast so ein rechtes Goldherz... Hab noch nie ein schöneres gesehen...“
„Aber Schwester Sieglinde...“
Diese schüttelte den Kopf.
„Nein, das stimmt. Ich freu mich auf deine Konfirmation, mein Kind. Aber jetzt erst einmal gesegnete Ostern...“
„Gesegnete Ostern, Schwester Sieglinde! Und bis bald! Auf Wiedersehen...“
„Auf Wiedersehen... Auf Wiedersehen...“
Sie ließ die alte Frau mit einer Fülle liebevoller Empfindungen zurück. Es fiel ihr immer schwer, sich von jemandem zu verabschieden – und gerade von ihr. Man musste dann immer gehen, während sie nur ganz langsam gehen konnte. Man wollte eigentlich immer mit jemandem gehen – und nie alleine weggehen. Das war gerade das Schwierige beim Sich-Verabschieden.
Auch die Antwort ,gesegnete Ostern’ – sie wusste gar nicht, ob sie dies auch sagen durfte. Es fühlte sich so an, als ob es nur eine so alte, heilige Frau sagen durfte. Wenn man es selbst sagte, hörte es sich so ... so unwürdig an, so nackt, so unwahr. So, wie man sich im Badeanzug fühlte...
*
In der Therme versuchte sie, sich ihren Eltern und vor allem ihrem Vater möglichst gut anzupassen: Sie ließ sich von ihm mit ins Wasser nehmen, und sie schwammen zu dritt eine Weile in dem ausgedehnten Becken, das auch einen Freiluftteil hatte. Dann folgte sie ihren Eltern sogar in die römische Dampfsauna. Hier durfte man seinen Badeanzug anbehalten, wenn man wollte – und das tat sie. Ihr Vater hatte sie auf dem Weg dorthin damit aufgezogen: ,Du willst deinen schönen Körper wirklich niemandem zeigen, nicht wahr?’ Hochrot hatte sie geschwiegen und sich furchtbar geschämt. Zum Glück lief sie da schon hinter den beiden, und niemand sah es in diesen schlimmen Sekunden. Ihre Mutter hatte noch verständnisvoll gelächelt – sie wusste sehr wohl, wie schlecht sie mit solchen Bemerkungen umgehen konnte.
Nach der Dampfsauna gingen alle einmal in das sehr kalte Tauchbecken, was allgemeine Erheiterung auslöste, dann flüchteten sie sich gemeinsam in das heiße Nachbarbecken. Und dann verzogen sich ihre Eltern in die finnische Sauna, die sie niemals mehr betreten würde...
Sie ging zurück zu ihren Liegestühlen und entschloss sich, noch einmal ins Wasser zu gehen und etwas zu schwimmen. Auch dies halb ihrem Vater zuliebe – um sich nicht zu langweilen und auch, um vielleicht etwas von ihrer früheren, noch mehr vorhandenen Zuneigung zu diesem Element wiederzufinden.
Als sie einmal durch das Freiluftbecken geschwommen war und wieder in den Innenbereich zurückkehrte, wollte sie wieder zur Treppe schwimmen und im Liegestuhl auf ihre Eltern warten. Erst im letzten Moment sah sie eine tauchende Gestalt neben sich und erschrak. Sie konnte ihr nicht mehr ausweichen, und es kam zum Zusammenstoß.
Eine junge Frau, achtzehn oder neunzehn, tauchte auf, öffnete entrüstet die zusammengekniffenen Augen und sah sie dann wütend an:
„Kannst du nicht aufpassen!?“
„Tut mir leid –“, stotterte sie, „ich – hab Sie nicht gesehen...“
„Dann guck nächstes Mal besser hin!“, erwiderte die Frau ungehalten, warf ihr noch einmal einen verärgerten Blick zu und drehte sich dann im Wasser, um wieder in die Richtung zu schwimmen, aus der sie gekommen war.
Beschämt schwamm sie die wenigen Meter bis zur Treppe, trocknete sich ab, soweit es ging, und setzte sich im Bademantel in einen der Liegestühle. Man konnte diese nach hinten klappen und sich so angenehm in fast völlige Rückenlage bringen – aber sie lebte noch immer in dem Zusammenstoß von eben und suchte beschämt die junge Frau, die aber nun im Außenbereich sein musste.
Nach einiger Zeit kam sie zurück. Als sie sah, dass das Becken frei war, tauchte sie nun in umgekehrter Richtung – durch das ganze Becken, bis sie am anderen Ende ankam und mit einem Wasserschwall an die Oberfläche tauchte. Sie schüttelte einmal ihren Kopf, und das Wasser flog von ihren gut schulterlangen dunkelbraunen Haaren nach allen Seiten. Dann holte sie tief Luft und tauchte noch einmal – nun in der Richtung, in der sie vorhin mit ihr zusammengestoßen war. Auf der anderen Seite wiederholte sich der Anblick – und nun schwamm die junge Frau wieder in den Außenbereich.
Es war ihr noch immer peinlich, und so konnte sie nicht anders, als von neuem auf die Rückkehr der Frau zu warten. Schließlich tauchte sie am anderen Ende wieder auf – und steuerte nun ebenfalls auf die Treppe zu. Sie erschrak – ihr Liegestuhl stand etwas seitlich rechts von der Mitte, sie würde sie ohne weiteres entdecken; jetzt, wo sie im Stuhl saß, erst recht. Aber die junge Frau achtete überhaupt nicht auf sie. Sie stieg aus dem Wasser, und jetzt sah man ganz ihren weinroten Bikini, der ihren Körper unglaublich betonte, jedenfalls nichts verbarg...
Sie war unglaublich froh, dass die junge Frau in etwa vier Metern Abstand einfach vorbeigegangen war, ohne sie zu entdecken. Langsam beruhigte sie sich – und kippte schließlich ihren Liegestuhl nach hinten, um so zu liegen wie mehrere andere Badegäste neben ihr auch.
Während sie an die Decke blickte und den Geräuschen des Wassers und manchen menschlichen Stimmen zuhörte, musste sie weiter an den Vorfall denken. Sie konnte so etwas immer nicht so leicht loswerden. Warum war die Frau so unfreundlich gewesen? Hatte denn nur sie Schuld gehabt? War sie denn mit geschlossenen Augen getaucht? Sie musste sich doch denken, dass manchmal andere Menschen von draußen hereingeschwommen kamen?
Und sie hatte es doch nicht absichtlich gemacht. Immer wieder kam sie bei ihrer Unfreundlichkeit an, unter der sie litt – gerade weil sie sich trotz allem schuldig fühlte... Aber sie hatte sich doch entschuldigt... Die Unfreundlichkeit saß in ihr wie ein Stachel, ihre Empfindung litt fortwährend unter diesem Moment von wenigen Sekunden. Noch immer sah sie diesen Blick vor sich, hörte sie die Worte... Ein empörter Blick – nur eine Sekunde lang. Sie fühlte sich wie ein Kind, das etwas falsch gemacht hatte – und zugleich litt sie darunter, dass Menschen so miteinander umgingen...
Schließlich dachte sie wieder daran, dass heute Ostern war. Diese junge Frau wusste auch nichts von Ostern... Sie blickte einmal zur Seite, nach rechts, nach links. Alle diese Leute wussten nichts davon. Ostern war nur ein Feiertag – oder sogar nur ein Sonntag wie jeder andere auch. Sie fühlte sich wieder einsam. Warum war sie nur hier? Ach ja, wegen ihres Vaters. Aber dieser war jetzt mit ihrer Mutter in der Sauna. Wozu brauchte er sie überhaupt? Weil er dann das Gefühl hatte, dass sie etwas zusammen unternahmen? Sicher war es so. Er hatte sie doch lieb.
Und wieder machte sie sich Vorwürfe, dass sie nicht mit in die Sauna kam. Es war ihre Schuld, dass sie nicht alles zusammen machten. Nicht sie war einsam, sie verdarb ihrem Vater sogar den Tag in der Therme... Jedenfalls durfte sie sich nicht beklagen. Ihr Vater hatte sie lieb, und er hatte es sich so gewünscht... Sie durfte es ihm nicht kaputtmachen. Sie wollte es auch nicht. Sie wollte, dass er glücklich war. Sie hatte heute doch schon ihr Glück gehabt – den Gottesdienst...
Als ihre Eltern wiederkamen, legten auch sie sich in den Liegestuhl, freuten sich, wieder bei ihrer Tochter zu sein – und unterhielten sich mit ihr und untereinander. Schließlich surfte ihr Vater ein wenig auf seinem Handy, und ihre Mutter löste Sudokus – und sie hing von neuem ihren Gedanken und Empfindungen nach...
Später aßen sie im Restaurant einen Salat und spielten im Aufenthaltsraum Schach mit kniehohen Figuren. Auch das hatte ihr Vater ihr einmal beigebracht. Sie erinnerte sich noch, dass sie am Anfang tatsächlich gewinnen wollte – aber nie gewann. Später spielte sie nur noch, um ihrem Vater eine Freude zu machen.
Ihre Eltern gingen noch zweimal in die Sauna. Sie hätte ein Buch mitnehmen können, aber sie hatte es heute nicht getan. Es reichte ihr, ihren Gedanken nachzugehen. Es gab immer so vieles, worüber man nachdenken konnte. Sogar über die gleichen Dinge konnte man immer wieder nachdenken...
Sie gingen sogar noch ein zweites Mal alle gemeinsam in die Dampfsauna – und auch noch einmal ins Wasser. Dazwischen hatten sich auch ihre Unterhaltungen im Liegestuhl fortgesetzt.
Als sie schließlich gingen, hatte sie das Gefühl, dass es ihrem Vater rundum gefallen hatte. Und dann war es für sie auch schön gewesen...
Als sie wieder fertig angezogen mit ihrer Mutter in den Bereich ging, wo kurz vor dem Ausgang der Frauenumkleiden die Föne zum Haaretrocknen lagen, erschrak sie heftig. Dort saß gerade jene junge Frau, mit der sie zusammengestoßen war.
„Ich brauche mich nicht zu fönen, Mama“, sagte sie schnell.
„Was?“, fragte ihre Mutter. „Aber natürlich! Draußen ist es kalt genug. Deine Haare sind völlig nass. Willst du dich erkälten? Komm!“
Ob sie wollte oder nicht – sie musste sich in unmittelbarer Nähe der jungen Frau an den Tisch setzen und einen Fön nehmen. Zwar war ihre Mutter zwischen ihnen, aber die junge Frau hatte die Hälfte der Situation mitbekommen – und der eine Blick, der sie traf und mit dem sie sich von oben bis unten gemustert fühlte, sagte alles. Sie fühlte sich alles zugleich: verachtet, belächelt, mit Spott, und das alles wiederum in nur einer Sekunde.
Ihre Mutter bekam davon gar nichts mit. Während ihr das Blut im Kopf pochte, begann sie, ihr Haar zu fönen.
Kurz darauf war die junge Frau fertig und stand auf. Dann ging sie hinter ihr zum Ausgang. Sie sah sie noch einmal im Spiegel. Wortlos ging sie hinter ihr vorbei. Diese Sekunde schmerzte vielleicht sogar am allermeisten. In ihr spürte man alles noch einmal...
*
Am Nachmittag hatte der Regen aufgehört, und obwohl die Sonne nicht herauskam, entschieden ihre Eltern sich spontan, gemeinsam noch einmal einen Spaziergang durch das nicht weit entfernt liegende Naherholungsgebiet zu machen. Hier gab es viele schöne Wege durch Waldgebiet und Wiesen, sogar einzelne Wasserläufe bereicherten die Landschaft. Die Weiden blühten mit ihren Kätzchen – und erinnerten daran, dass der Frühling gerade begonnen hatte.
Aber auch die Buschwindröschen übersäten stellenweise den halben Boden mit ihren weißen Blüten – oder hätten dies getan, wenn sie sich vor der Kühle nicht wieder geschlossen hätten, um auf die nächsten warmen Sonnenstrahlen zu warten.
Im Grunde brauchte sie kein schönes Wetter, um gerne spazieren zu gehen. Dies war für sie viel schöner als ein Besuch in der Therme. Sie brauchte ihr ganzes Leben lang nicht in die Therme zu gehen. Aber die Buschwindröschen und die dicken, weichen Weidenkätzchen zu sehen, das erfüllte ihr Herz immer wieder mit einer Freude und einer Art liebevoller Zuneigung...
Und als ihr Vater dann am Abend fragte, ob dies nicht ein schöner Tag gewesen sei, antwortete sie aus Liebe, aber auch in gewisser Weise ehrlich:
„Ja, Papa...“
*
Als sie sich allein in ihr Zimmer zurückgezogen hatte, setzte sie sich in ihrem Nachtkleid im Bett auf und nahm ihr Gesangbuch zur Hand. Es war ein Buch, das sie einmal auf einem Flohmarkt gefunden hatte. Es war noch gut erhalten gewesen – und hatte nur zwei Euro gekostet. Nur zwei Euro – für ein heiliges Gesangbuch... Es war ein kleines Buch mit Dünndruck, schwarzem Schutzumschlag und Goldrand.
Irgendwann ganz am Anfang hatte sie sich vorgenommen, nach und nach alle Lieder auswendig zu lernen. Sehr schnell hatte sie eingesehen, dass das nicht möglich sein würde. Und dennoch war sie Seite für Seite vorangegangen, um sich jedes Lied einmal anzuschauen, zu versuchen, die Melodie zu summen und zu spüren, wie es klang... Sie konnte Noten lesen, und so gelang es ihr immer halbwegs, die Melodie zu finden.
Das Lied, das heute an der Reihe war, begann den Abschnitt der Beichte, der Bußlieder.
Sie versuchte, leise die Melodie zu summen, und las dabei den Text:
,Allein zu dir, Herr Jesu Christ,
mein Hoffnung steht auf Erden.
Ich weiß, daß du mein Tröster bist,
kein Trost mag mir sonst werden.
Von Anbeginn ist nichts erkorn,
auf Erden ward kein Mensch geborn,
der mir aus Nöten helfen kann;
ich ruf dich an,
zu dem ich mein Vertrauen han...’
Das Lied berührte sie ziemlich. Die Melodie war schön – und der Text natürlich sowieso. Und er passte auch wunderbar zu Ostern. Noch ein paar Mal summte sie das Lied von neuem und kam immer besser in die Melodie hinein. ,Ich weiß, dass du mein Tröster bist...’
Dann aber tat sie etwas, was sie oft tat. Ihr Herz lebte weiter in den Worten und ihrer Bedeutung, aber es suchte sich nun selbstständig eine eigene Melodie. Kommend von der vorgegebenen Melodie, die dann an einer Stelle ausklang und verlassen wurde, summte sie leise innerlich einfach weiter – und die Melodie verwandelte sich, wurde noch schöner, fast immer noch trauriger, viel trauriger, aber dafür auch viel gefühlvoller, voller Empfindung, ganz Herz, noch viel mehr Herz, als es vorher schon war.
So konnte sie oft noch lange, lange vor sich hin summen, in dem Inhalt leben, den das ursprüngliche Lied hatte anklingen lassen, aber nun so, dass ihr ganzes Herz dabei war, auf ihre Art, innig und voller Hingabe...
Als ihr Herz befriedigt war, weil es sich in Schönheit, in Reinheit hatte verströmen und hingeben dürfen, schloss sie das Gesangbuch erfüllt und glücklich, legte es in den Nachttisch zurück, stieg aus dem Bett und kniete sich davor, wie jeden Abend und jeden Morgen...
,Vater unser im Himmel...’
Nach diesem heiligen Gebet sprach sie auch noch einmal das Credo, denn es war der Abend des heiligen Ostertages. Im Gottesdienst ging es ihr immer viel zu schnell. Sie sprach es viel langsamer. Das Herz brauchte Zeit, es musste doch mitsprechen...
Und dann, als sie auch dies getan hatte, dachte sie ganz und gar schweigend in aller Innigkeit noch einmal an Ostern, an das Osterwunder. Der HERR war auferstanden. Und wieder tauchte ihr Herz ein in die heilige Vorstellung. Wieder dachte sie daran, wie er zuerst der Maria von Magdala erschienen war – und wieder träumte sie sich hinein in die Vorstellung, dass sie es wäre, die sich am Ostermorgen in aller Ehrfurcht dem Grabe näherte, aber das Grab war leer, aber der HERR war lebendig – und auf einmal stand er vor ihr ... und segnete sie ... und sie umfing seine Beine, in scheuer Liebe...
Mit heiligsten Empfindungen legte sie sich schließlich vorsichtig wieder ins Bett...
„Mama?“
„Ja, Rahel?“
„Ich möchte am Sonntag eine Flechtfrisur haben. Mit so einem geflochtenen Ring, der so nach hinten geht...“
Sie zeigte es an ihrem Kopf, wie sie es meinte.
„Einem geflochtenen Ring?“, fragte ihre Mutter zurück. „Das kann ich nicht!“
„Kannst du es nicht herausfinden – wie man es macht?“, bat sie ihre Mutter sehnsuchtsvoll.
„Nein – wie denn? Wenn du es mir herausfindest...“
Sie wusste auch nicht, wie.
„Wie kommst du überhaupt darauf? Deine Haare sehen doch wunderschön aus...“
Sie hatte überschulterlanges Haar, das sie überhaupt nicht wunderschön, sondern ganz normal fand. Selbst die Farbe war nicht zu definieren. Es war irgendetwas zwischen blond und schmutziggrau – so kam es ihr manchmal vor. Sie wollte zu ihrer Konfirmation etwas Schönes in ihrem Haar haben. Und sie hatte solche Flechtfrisuren irgendwo ein-, zweimal gesehen. Jetzt hatte sie sich wieder daran erinnert. Zum Glück! Aber wenn ihre Mutter es ihr nicht machen konnte...?
„Kannst du nicht ... im Internet suchen, wie man es macht...?“
Sie hatte die Frage so vorsichtig wie möglich gestellt. Aber die Antwort kam postwendend – ärgerlich erwiderte ihre Mutter:
„Du weißt genau, dass ich darauf keine Lust habe! Weißt du, wie lange man im Internet nach bestimmten Dingen googelt – und dann findet man immer noch nichts Vernünftiges! Nein, darauf habe ich wirklich keine Lust. Nein, nein, Rahel, das mach mal schön selber. Irgendwann musst du es ja lernen.“
Sie ging schweigend und traurig in ihr Zimmer.
Sie wollte mit Computern nichts zu tun haben. Irgendetwas in ihr wehrte sich dagegen. Sie wollte auch kein Smartphone haben – nichts in der Richtung. Sie hatte ein Tastenhandy und das genügte ihr. Auch dieses benutzte sie nur, wenn es nicht anders ging.
Manchmal wurden jetzt schon Referate oder andere Hausaufgaben als Ausdruck verlangt. Sie hasste das und fragte sich, warum das überhaupt zulässig war. Sie musste dann immer den PC ihres Vaters benutzen – und sich immer wieder neu mühsam hineinfinden. Sie hätte es vielleicht lernen können, wahrscheinlich sogar schnell, aber sie wollte es gar nicht. Sie wollte mit diesen Maschinen nichts zu tun haben. Diese Maschinen hatten mit Gott nichts zu tun. Sie entfernten die Menschen von Gott...
Aber wie konnte sie jetzt einen Flechtring in ihr Haar bekommen? Sie musste ihn haben! Sie musste etwas Schönes in ihrem Haar haben. Sie wollte einen Flechtring haben – unbedingt...
Sie musste morgen die anderen Mädchen in der Klasse fragen. Vielleicht würde eine es wissen. Sie mochte das nicht. Es war ihr immer unangenehm, denn es gab oft Unverständnis – ohnehin schon. Die meisten Klassenkameradinnen mochten sie, weil sie zu allen freundlich war. Aber es gab niemanden, der sich nicht über ihr religiöses Leben wunderte – und es gab viel zu oft Bemerkungen darüber. Warum musste man darüber Bemerkungen machen? Sie wusste es nicht. Und mit dieser Frage würde es wieder Bemerkungen geben. Aber sie hatte keine andere Wahl.
*
Als sie am Mittwoch aus der Schule kam, war es noch schlimmer, als sie gedacht hatte. Die Bemerkungen kamen wie erwartet – aber kein einziges Mädchen konnte flechten oder wusste, was sie hätte machen können. Es hielt aber auch kein einziges Mädchen für sinnvoll oder notwendig. Wozu einen Flechtring? Das war altmodisch – es erinnerte an bayerische Festumzüge oder etwas in der Art. Oder eben Konfirmation oder so etwas – aber wer ließ sich heute noch konfirmieren?
Es gab noch drei andere Mädchen in der Klasse. Für den Rest war Konfirmation ein Fremdwort mit sieben Siegeln beziehungsweise ungläubigem Stirnrunzeln. Buchstäblich ungläubig. Die anderen Mädchen konnten nicht glauben, wie man sich konfirmieren lassen konnte. Aber sie glaubten eben auch sonst nichts...
Sie war verzweifelt. Sie schämte sich in Grund und Boden. Sie fühlte sich so unfähig... Aber sie wollte am Sonntag nicht ohne diesen Flechtkranz vor Gott treten. Ihre Gedanken hatten sich daran geklammert. Es gehörte zu dem Heiligen. Das weiße Kleid – und das geflochtene Haar. Es ging nicht ohne. Es musste...
In ihrer Not fiel ihr nur noch ein einziger Mensch ein: Schwester Sieglinde. Sie würde vielleicht doch noch jemanden wissen, der ihr helfen könnte? Sie musste einfach!
Sie sagte ihrer Mutter kurz Bescheid, nahm sich ihre Jacke und machte sich auf den Weg. Das Diakonissenmutterhaus lag ganz in der Nähe der Kirche, und Schwester Sieglinde war eigentlich immer da. Sie konnte ja nichts mehr tun.
Der Weg zur Kirche und zum Mutterhaus führte durch einen kleinen Park. Sie achtete zunächst nicht auf die Umgebung, weil sie so besorgt über ihr Vorhaben war. Doch dann fiel ihr ein, dass es nicht recht war, so schnell und achtlos zu gehen, und nach diesem sanften Vorwurf gegen sich selbst wandte sich ihr Blick fast von selbst wieder liebevoll der Umgebung zu.
Und sie bemerkte die kleinen, blauen Traubenhyazinthen, die vereinzelt schon blühten – obwohl es gerade erst Ende März war! Ihr Schritt verlangsamte sich weiter. Sie liebte Blumen, und manchmal brachte sie Schwester Sieglinde welche mit. Sie pflückte sie einfach aus dem Park – obwohl das sicher verboten war, ganz abgesehen davon, wenn dies jeder machen würde. Aber sie pflückte nie viele, oft sogar nur eine einzige – aber dies war etwas ganz anderes, als fertige Blumen irgendwo zu kaufen. Blumen, die wirklich aus der Natur kamen, hatten eine ganz andere ... Lebendigkeit. Erst ihre Natürlichkeit machte sie wirklich schön.
Sie ging noch langsamer und hielt bei einer schönen Stelle an. Dann ließ sie noch ein älteres Ehepaar vorbeigehen, und ihr Herz fühlte sehr wohl, dass sie etwas Verbotenes tat. Aber die Liebe führte ihre Glieder... Und als das Ehepaar vorbeigegangen war, schaute sie sich schnell noch einmal um, huschte dann zum Wegrand, war im nächsten Moment in der Hocke und pflückte vorsichtig und liebevoll eine einzelne Traubenhyazinthe.
Mit dem kleinen Stengel in den Händen und Freude im leicht klopfenden Herzen lief sie weiter. Es tat ihr trotzdem immer leid, einem dieser Pflänzchen das Leben zu nehmen. Aber noch fühlte man in dem kühlen, saftigen Stengel das Leben – und einige Tage würde das liebe Pflänzchen auch noch weiter leben, und es würde seine Schönheit Schwester Sieglinde schenken. Und dann durfte es wieder sein. Man durfte Blumen pflücken, um anderen eine Freude zu machen. Gott erlaubte das. Und man nahm ja nie viel...
Immer wenn sie das Mutterhaus betrat, musste sie ein wenig an ein Krankenhaus denken. Es gab auch hier einen langen Flur, und die Schritte hallten etwas, wenn man ihn entlangging. Vor allem dämpfte man seine Schritte ganz von selbst, die Frauen, die hier lebten, waren in ihren Augen alle heilig. Sie alle hatten ihr Leben Gott geweiht – Gott und dem Helfen. So ähnlich war es im Krankenhaus auch. Die Ärzte hatten ihr Leben auch dem Helfen geweiht. Und auch vor den Kranken hatte man Ehrfurcht. Tiefe Rücksicht, eine fast heilige Rücksicht. Und so war sie fast gleich, die Atmosphäre. Aber das Mutterhaus war doch noch heiliger. Sogar das Licht, das durch die Fenster hereinschien, war heilig – im Krankenhaus war es das nicht.
Schwester Sieglinde lebte in einem hinteren Gebäudetrakt. Auch hier kam man noch durch einen großen Innenhof, der wie ein kleiner Park wirkte. Hier standen einige alte Platanen neben mehreren Eiben, und später im Jahr blühten auch hier Blumen. Dennoch hätte sie sich nie getraut, hier eine Blume zu pflücken. Hätte eine der Schwestern sie dabei gesehen, wäre sie vor Scham im Boden versunken. Nein – das konnte man nur draußen tun...
Sie betrat den hinteren Gebäudeteil. Dieser schien wesentlich älter zu sein, vielleicht weil er weniger gepflegt wurde. Er war auch deutlich dunkler. So wirkte er ein wenig vergessen, wodurch sich hier sogar die Heiligkeit wieder etwas verlor. Vielleicht lag es aber auch nur daran, dass in diesem Teil des Gebäudes das so vertraute Zimmer von Schwester Sieglinde lag. Das Zimmer war eigentlich eine kleine Wohnung mit Toilette und winziger Küchenzeile. Sie hatte sich, als sie etwas kleiner war, immer gewundert, wie man darin leben konnte – und es sich zugleich selbst innig gewünscht. Und eigentlich tat sie das immer noch. Es strahlte eine so unbeschreibliche Gemütlichkeit, Einfachheit und Schlichtheit aus. Hier hatte sie immer wieder unmittelbar erlebt, dass, wer für Gott lebte, nicht viel brauchte – eigentlich fast gar nichts. Ihr Herz liebte dieses Zimmer.
Nun hatte sie es erreicht und stand davor. Sie klopfte. Auch wenn sie schon so oft hier gewesen war, war sie noch jedes Mal ein wenig aufgeregt, wenn sie so vor dieser Tür stand. Sie liebte Schwester Sieglinde, aber sie bewunderte sie auch. Für sie war sie eine dieser heiligen Frauen – durch ihr ganzes Leben, von dem sie viel zu wenig wusste, und durch ihr hohes Alter.
„Ja?“
Freudig trat sie ein.
„Rahel!“
Schwester Sieglinde saß in ihrem altmodischen Stuhl, in dem sie fast immer saß.
„Wolltest du nicht erst nächsten Mittwoch kommen?“
Bevor sie antworten konnte, musste sie erst einer anderen Sorge folgen:
„Habe ich Sie geweckt, Schwester Sieglinde? Haben Sie geschlafen?“
Die alte Frau lächelte auf ihre stille Weise.
„Ich habe nur ein wenig vor mich hingenickt. Ein kleiner Nachmittagsschlaf. Mach dir keine Sorgen, mein Kind. Aber was führt dich hierher?“
Sie schämte sich auf einmal. Obwohl sie es nur unbewusst fühlte, schämte sie sich, weil sie nicht im Mittelpunkt stehen wollte – und weil ihr Herz allein schon durch die Frage fühlte, es könne vielleicht eine vermessene Eitelkeit sein... Auch das Blümlein wollte zuerst versorgt werden.
„Ich habe Ihnen hier eine kleine Blume mitgebracht...“
„Eine kleine Blume? Zeig einmal her, Mädchen.“
Sie trat ganz heran, und ihr Herz empfand eine unschuldige Ehrfurcht vor der heiligen Gottesdienerin. Mit der Zuneigung, die diese Ehrfurcht begleitete, zeigte sie ihr das Blümchen.
„Eine kleine Traubenhyazinthe! Wie lieb von dir, Rahel! Tust du sie wieder in mein Väschen?“
„Ja, das mache ich!“, sagte sie voller Zuneigung und ging zu dem kleinen Schreibtisch, auf dem eine knapp fingerhohe Vase stand. Wo auch immer die alte Diakonisse dieses Väschen herhatte – es passte wunderbar für die kleinen Blumen, die sie ihr immer mitbrachte. Sie ging zum Wasserhahn und füllte das Väschen vorsichtig mit Wasser. Dann stellte sie es mit der kleinen Blume wieder auf den Tisch.
„Schön...“, sagte Schwester Sieglinde.
Sie war froh gewesen, etwas Zeit gewonnen zu haben, aber nun musste sie wohl oder übel davon sprechen, was sie in ihrem Herzen trug...
„Schwester Sieglinde...?“, begann sie zögernd.
„Ja, Rahel?“
Ermutigt von der lieben Stimme der alten Frau, fasste sie sich nun ein Herz.
„Ich möchte zur Konfirmation mein Haar flechten. Ich möchte einen geflochtenen Ring. Es soll schön aussehen! Wunderschön... Aber – aber ich kann es nicht! Ich habe schon alle Mädchen aus meiner Klasse gefragt – aber niemand konnte mir helfen. Wissen Sie nicht vielleicht irgendjemanden, der es mir Sonntag ganz früh machen kann? Wenn Sie mir nicht helfen können, weiß ich nicht mehr weiter!“
Sie hatte ihr ganzes Herz ausgeschüttet – und wieder hing sie mit all ihren Empfindungen an diesem Vorhaben, diesem innigen Wunsch...
„Ob ich jemanden kenne?“, erwiderte die alte Diakonisse.
„Ja...“, sagte sie voller Hoffnung – und doch kroch im nächsten Moment angesichts dieser Gegenfrage bereits die Angst herauf, dass auch sie nicht würde helfen können.
„Ich kann es selbst, mein Kind. Ich habe früher den Mädchen immer die Haare geflochten. Gerade auch zur Konfirmation...“
Ihr Herz schien einen Moment auszusetzen.
„Ist das wahr?“, fragte sie ungläubig und glücklich zugleich. Und als müsste sie jede Unsicherheit ausschließen, zeigte sie an ihrem eigenen Haar, wie sie es meinte: „So einen Ring, hier einmal herum?“
Schwester Sieglinde lachte voll gerührter Güte:
„Ja, Mädchen, genau so. Wie du es willst...“
Auf einmal wogte aus ihrem Herzen ein unendliches Glück herauf, das ihre ganze Brust zu erfüllen schien. Eine ungeheure Liebe zu dieser alten Frau erfasste sie, und ein brennender Kloß saß plötzlich in ihrer Kehle...
„Aber Rahel...“
Sie atmete einmal heftig ein, um nicht weinen zu müssen. Aber die unbeschreibliche Dankbarkeit blieb.
„Du bist so ein liebes Mädchen...“, sagte die alte Frau.
Sie wusste nicht, wohin mit ihren Gefühlen. Hilflos blieb sie einfach stehen...
„Willst du dich nicht setzen, Rahel...“
Immer wenn sie Schwester Sieglinde besuchte und sich mit ihr unterhielt, setzte sie sich auf ihr Bett. Es war relativ hoch. Sie wusste nicht, ob alle Betten im Haus so hoch waren – irgendwie waren sie ein wenig höher als die Betten, die sie sonst kannte. Noch immer mit einer hilflosen, tiefen Zuneigung in der Brust setzte sie sich auf das Bett. Sie hatte schon oft das Bedürfnis gehabt, der lieben, alten Diakonisse näher zu sein, aber ihr gemütlicher Stuhl, in dem sie saß, stand mehr zum Fenster hin, und so war zwischen ihnen immer eine Menschenlänge Abstand. Es gab aber keinen anderen
Stuhl im Zimmer...
„Was bist du nur für ein besonderes Kind...“
Es war ihr immer unangenehm, wenn Schwester Sieglinde so von ihr sprach. Sie war doch nichts besonderes...
„Ich weiß, du magst es nicht, wenn ich das sage, Rahel. Aber ich kann mir nicht helfen – ich verstehe nicht, wie der liebe Gott so ein Kind auf die Welt schicken konnte... Und dann darf ich es sogar noch kennen!“
„Schwester Sieglinde...“, bat sie abwehrend.
„Ach, Rahel – lass mich alte Frau doch ein wenig sagen, was ich empfinde. Es ist doch wahr... Es gibt doch kein anderes Mädchen, das so ist wie du! Die Frage muss doch erlaubt sein... Wie ist es nur möglich... Nein...“, die alte Diakonisse schüttelte den Kopf und sprach nun wie zu sich selbst, „es ist doch eigentlich nicht möglich... Der liebe Gott schickt wohl nur einmal in hundert Jahren einen solchen Engel auf die Erde...“
Es tat ihr fast im Herzen weh, wenn so von ihr geredet wurde.
„Schwester Sieglinde!“, protestierte sie bittend. „Sie reden ... Sie reden Unsinn! Was soll denn das? Ich bin doch kein Engel! Sie müssen sofort aufhören, so etwas zu sagen. Bitte...“
Die alte Frau schüttelte verneinend den Kopf.
„Du weißt es alles noch nicht, Rahel. Du weißt es nicht... Aber ich sehe es doch. Du meine Güte... Ja...“, sie nickte wie in eine weite Ferne, „früher gab es noch mehr Mädchen wie dich. Früher...“
Nachsinnend schien sie ihren eigenen Worten nachzulauschen.
„Wann früher?“
„Als ich noch jung war – so jung wie du jetzt.“
„Sehen Sie?“, rief sie erleichtert, „das ist noch keine hundert Jahre her! Und es – und es gibt jetzt auch – Sie – Sie müssen einfach aufhören, so etwas zu sagen...!“
Langsam nickte die alte Diakonisse vor sich hin.
„Ach, Kind... Du bist wirklich gesegnet...“
Sie wand sich unter den Worten. Warum sagte sie das alles?
„Schwester Sieglinde?“, sagte sie, um all dies zu entkräften, „Sie waren doch früher bestimmt ... noch viel frommer, oder?
Nicht wahr? Sie waren doch ... ihr ganzes Leben lang fromm!
Und als Kind ... schon als Kind! Ja – ganz bestimmt! Viel mehr als ich...“
Die alte Frau schwieg und hob ihren Blick ein wenig, wie als wenn dort, irgendwo in der Luft, im Raum zwischen ihnen, das Tor in die Vergangenheit lag ... dann antwortete sie schließlich:

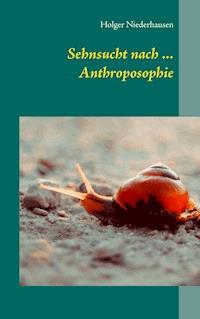

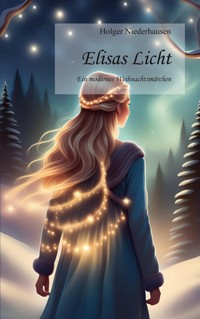
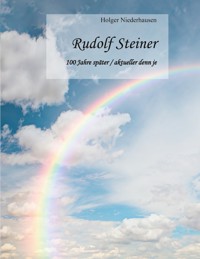







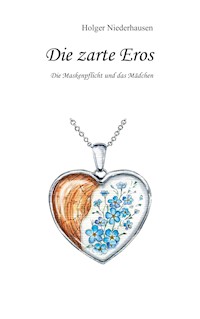



![Die [durchgestrichen: letzte] erste Unschuld - Holger Niederhausen - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/9d69c6320692c771bc65edda9a41b406/w200_u90.jpg)