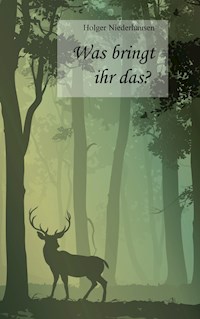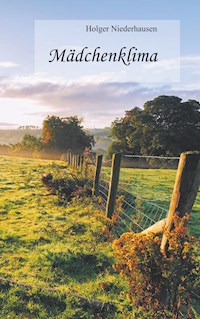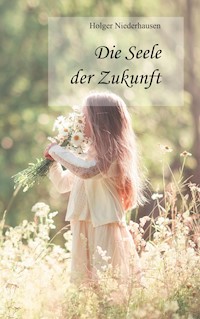Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Rudolf Steiner (1861-1925) ist 100 Jahre nach seinem Tod aktueller denn je. Der Kosmos seiner Geist- und Menschen-Erkenntnis erweist sich angesichts der zunehmenden Krisen menschlicher Gesellschaften und des menschlichen Bewusstseins insgesamt als absolut rettender Zugang zu einem wahrhaft menschlichen Denken, Fühlen, Wollen und Mensch-Sein. Die Ur-Sehnsucht des Menschen nach dem Menschlichen - hier findet sie ihre reale Erfüllung ... und eine unversiegliche Quelle für Antworten auf die immer brennenderen Fragen unserer Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1031
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zitierhinweise
Die Quellenangaben erfolgen nach der digitalen Gesamtausgabe auf HDD, Version 6.0. Wird aus einer Quelle mehrfach zitiert, ist diese in der Fußnote mit vorangestelltem, ●’ gesondert kenntlich gemacht, die Seitenangaben im Text erfolgen dann in hochgestellten eckigen Klammern. Ein senkrechter Strich (,|’) markiert einen Absatz im Original.
Inhalt
Einleitung
Grundlegung
Goethes Naturwissenschaftliche Schriften (GA 1)
Grundlinien einer Erkenntnistheorie... (GA 2)
Wahrheit und Wissenschaft (GA 3)
Die Philosophie der Freiheit (GA 4)
Goethes Weltanschauung (GA 6)
Die Mystik... (GA 7)
Der höhere Mensch
Das Christentum als mystische Tatsache... (GA 8)
Theosophie (GA 9)
Wie erlangt man...? (GA 10)
Die Mission der Wahrheit und der Andacht
Aus der Akasha-Chronik (GA 11)
Die Stufen der höheren Erkenntnis (GA 12)
Die Schwelle der geistigen Welt (GA 17)
Die Geheimwissenschaft (GA 13)
○ Imagination, Inspiration, Intuition
○ Das Leben nach dem Tod
Reines Denken und höherer Wille
Das Ich ist nicht im Leib
Dreigliederung des Menschen
Das wahre Ich
Christus-Erkenntnis
,...
größer als alle Religion’
Der Christus im Ätherischen
Die unbeantwortete Frage der Scholastik
Die ersten drei Jahre
Die reinen Kräfte der Seele
Ideale und Individualität
Zwei Geburtsgeschichten und die reine Menschheitsseele
Die Auferstehung
Das Schauen der Evangelisten
Durchchristung der Erinnerung
Die Ideale im Nachtodlichen
Vergebung und Karma
Glaube und Erdenzukunft
Christus und die Seele
Heiliger Geist
Freiheit und Liebe
Durchchristung der Welt
Seelische Gesundheit
Nervosität und Ichheit
Was ist Gesundheit?
Reinkarnation und Karma
Die Wahrnehmung durchseelen
Verbindung mit allem
Die Naturwesen und die Kraft Michaels
Das Gesundende ist das Wahre
Die Sprache des Christus
Die Katastrophe des Materialismus
Die Weltkriegs-Katastrophe
Naturwissenschaft und innere Leere
Passivität und Konsumhaltung
Die Furcht vor dem Geist
Dekadenz und Untergang
Die soziale Frage
Geisteswissenschaft und soziale Frage
Die Kernpunkte der sozialen Frage
○ Dreigliederung des sozialen Organismus
○ Wirtschaftsleben
○ Rechtsleben
○ Geistesleben
○ Ihr Zusammenwirken
○ Kapitalismus und soziale Ideen
○ Internationale Beziehungen
Steiner im Bundestag: Schweigen
Befreiung des Individuums
Passivität oder Brüderlichkeit
Die Waldorfpädagogik
Die Erziehung des Kindes
Die Freie Waldorfschule
Eine spirituelle Menschenkunde
Erziehungskunst (Methodisch-Didaktisches)
Pädagogik der Liebe
Die Konferenzen
Der Christus-Impuls
Erziehung zur Freiheit
Erweckende Erziehung
Der, Pädagogische Jugendkurs’
Das Menschenbild
Die, Leitsätze’ und Michael
Die, Anthroposophischen Leitsätze’
Die Jugendansprache von 1924
Michael
Das Menschentum
Mensch und Kosmos
Die Verführer
Der Liebesimpuls
Die Illusion überwinden
Eine
menschliche
Welt
Die Gegenmächte erkennen
Wiederfinden des Menschen
Die Voraussetzung der Demokratie
Die soziale Frage – auch heute
Von der Phrase zum Christus-Impuls
Steiners Lebenswerk – ein Überblick
Register
Einleitung
Rudolf Steiner – die Allgemeinheit kennt ihn allenfalls als Begründer der Waldorfschulen oder der anthroposophischen Medizin. Vielfach wird er verknüpft mit Vorwürfen von, Rassismus’ und, Scharlatanerie’, etwa in Bezug auf die angeblich ganz wirkungslose Homöopathie, dann wiederum mit, Indoktrination’, etwa wenn Berichte auftauchten, dass an vereinzelten Waldorfschulen etwas über, Atlantis’ oder ähnliches in Kinderheften landete.
Die Wenigsten wissen, dass es nie Rudolf Steiners Absicht war, dass, Atlantis’ in Waldorfschulen gelehrt werden solle. Andererseits hat die Waldorfschule überhaupt keinen verbindlichen, Lehrplan’ von Rudolf Steiner bekommen, weil er wusste, dass echte Pädagogik auf der Freiheit pädagogischer Intuitionen beruhen muss – was all jene übersehen, die mit Blick auf einzelne Negativbeispiele innerhalb der Waldorfschulbewegung die staatlichen Lehrpläne verherrlichen, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht. Denn dass das Staatsschulsystem in keinster Weise zukunftsfähig ist, das sollten gewissenhafte Seelen begreifen können.
Aber wie wird eine Seele gewissenhaft und zuinnerst wahrhaftig? Das eben ist bereits eine Frage, die ohne ein Eintauchen in die Anthroposophie fast gar nicht zu beantworten ist. Denn unsere Zeit ist so schnelllebig, schnell-urteilend und oberflächlich geworden, dass sie bereits nicht einmal mehr begreift, was eigentlich die Seele ist – geschweige denn, ein echtes Erleben dafür hat, was Wahrhaftigkeit für eine innerseelische Realität wäre. Ohne ein Eintauchen in die Realität der Seele, des Geistes, des Wesens des Menschen, kommt man hier nicht weiter.
Und um diese Realität ging es Rudolf Steiner vor allem. Hat doch die Anthropo-sophia ganz mit dem Menschen zu tun. Anthropos ist das griechische Wort für, Mensch’, Sophia das für die Weisheit. Die Frage ist, ob wir es heute überhaupt noch ernst nehmen, dass Weisheit als eine Realität, vielleicht sogar als ein Wesen existiert... Wenn wir jedoch nichts dergleichen mehr ernst nehmen – wie könnten wir dann meinen, Rudolf Steiner und die Anthroposophie jemals verstehen zu können?
Es geht bei Rudolf Steiner um alles. Um die ganze, große Wahrheit des Menschen und des Geistes. Es geht um einen Kosmos. Und ohne den Mut, die Reise in diesen Kosmos zu beginnen, wird man Rudolf Steiner nicht verstehen. Man wird es allenfalls behaupten. Und das gerade ist Unwahrhaftigkeit. Hier beginnen die Lügen. Das Böswillige. Die Unredlichkeit. Die Seichtheit. Macht und Manipulation. Auch die Selbstlüge.
Lernen wir also Rudolf Steiner wirklich kennen. Und damit auch uns selbst – nämlich das Wesen des Menschen ... und das, was möglich wäre, wenn wir es nur ernst genug nähmen. Die Wahrheit des Menschen – und nicht nur das, was wir derzeit daraus machen, mit immer schlimmeren Folgen. Der Mensch ist noch gar nicht geboren.
Dieses Buch ist für alle Menschen geschrieben. Jeder Mensch sollte sich zumindest einmal in seinem Leben vertieft mit der Anthroposophie auseinandersetzen.
In diesem Buch ist zusammengetragen, was auf das unmittelbar Menschliche so zielt, dass es wirklich jeden Menschen angeht. Es geht um Steiners Grundwerke, die bereits auf das höhere Wesen des Menschen verweisen und Wege dazu bahnen, bevor er, esoterisch’ wurde. Es geht um Steiners Christus-Erkenntnis – eine Erkenntnis jenseits aller Konfessionalität, die aber zentral für die gesamte Menschheitszukunft ist. Es geht um die soziale Frage, die bis heute nichts von ihrer brennenden Ungelöstheit verloren hat, und um das tiefere Verstehen dessen, was Rudolf Steiner unter dem, Dreigliederungsimpuls’ verstand.
Es geht um die Waldorfpädagogik als wahre Erziehungskunst, als wahre Erkenntnis vom Wesen des Kindes und einer Entwicklung des ganzen Menschen. Und es geht um das tiefe Menschentum überhaupt, das Rudolf Steiner in verschiedenster Hinsicht entfaltete; um einen heilig-sozialen Impuls, das heilige Geheimnis des Menschen und der Begegnung, der Mitmenschlichkeit.
Bereits dies ist ein ganzer Kosmos. Und mit Hilfe von allein schon über fünfhundert textlich abgesetzten Zitaten (sowie vielen weiteren im Fließtext) wird man unmittelbar Rudolf Steiner selbst begegnen – auch für, Kenner’ wird diese Fülle zentraler Passagen eine Entdeckung sein.
Dennoch wird unendlich vieles unerwähnt bleiben. Steiners tiefgründiger Gang durch die Philosophie-Geschichte etwa (GA 18). Das, was er über die Erden- und Menschheitsentwicklung schilderte. Über die Landwirtschaft. Die Medizin. Die Heilpädagogik. Das Wesen der Farben. Des Weiteren unerwähnt bleiben wird die Weihnachtstagung und vieles, vieles weitere. Wer Rudolf Steiner, entdecken’ wird, mag an all diesen wesentlichen Stellen selbst weiter in die Tiefe dringen.
In diesem Buch geht es um das, was so zentral ist, dass es jede Seele interessieren muss, wenn sie ihr eigenes Menschentum halbwegs aufrichtig tief genug versteht und erahnt. Wer sich noch nie wirklich mit Rudolf Steiner, beschäftigt’ hat, möge und wird in diesem Buch entdecken, dass alle Vorurteile gegenüber Steiner völlig in die Irre gehen, weil dieser Mensch mehr zu einem wahren Menschentum und dessen Erkennen beigetragen hat als alle seine Kritiker zusammen. Möge es viele Leser finden!
Einhundert Jahre nach Rudolf Steiners Tod wartet das heilig-tiefe Geheimnis des MENSCHEN noch immer auf seine Entdeckung – und ist sein Werk in allen zentralen Aspekten aktueller denn je.
Grundlegung
Bevor Rudolf Steiner die Anthroposophie begründete, veröffentlichte er einige philosophische Grundwerke, die erlebbar machen, was eigentlich Geist ist. Denn die Vorstellung,, Geist’ sei nur ein seltsames Produkt menschlicher Synapsen, also eines Gehirns auf der Menschenstufe, ist bereits ein eklatantes Vorurteil, das auch nicht im Geringsten erklären kann, wie denn, Synapsen auf der Menschenstufe’ auf einmal darauf kommen,, Geist’ hervorzubringen. Ein reales Verständnis von Geist bekommt man erst, wenn man erlebt, wie das Geistige eigentlich alles durchdringt – wie alles, was der menschliche Geist begreifen kann, auch wirklich geistverwandt und tatsächlich ebenfalls Geist ist. Denn wie sonst könnte es begriffen werden?
,Goethes Naturwissenschaftliche Schriften’ (GA 1)
Rudolf Steiners erste Veröffentlichung 1883 bezog sich auf die Herausgabe von Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften, mit der er beauftragt worden war.1 Schon hier war ein Ansatzpunkt gegeben, das Wesentliche herauszuarbeiten. Goethe hatte die sogenannte, Urpflanze’ entdeckt. Er meinte, sie in jeder Pflanze regelrecht zu sehen – bis in dem berühmten Gespräch mit Schiller dieser ihm entgegnete, dies sei eine Idee. Goethe aber erwiderte darauf, das sei ihm sehr lieb, dass er Ideen habe, ohne es zu wissen, und sie sogar mit Augen sehe.
Und Rudolf Steiner macht nun mit Hinweis auf Goethes eigene methodologische Aufsätze darauf aufmerksam, dass:[→]
[...] jedes Objekt zwei Seiten hat: die eine unmittelbare seines Erscheinens (Erscheinungsform), die zweite, welche sein Wesen enthält. So gelangt Goethe zu der allein befriedigenden Naturanschauung, welche die eine wahrhaft objektive Methode begründet. Wenn eine Theorie die Idee als etwas dem Objekte selbst Fremdes, bloß Subjektives betrachtet, so kann sie nicht behaupten, wahrhaft objektiv zu sein, wenn sie sich nur überhaupt der Idee bedient. Goethe aber kann behaupten, nichts zu den Objekten hinzuzufügen, was nicht schon in ihnen selbst läge.
Wir erkennen zum Beispiel eine Kiefer als solche, egal, ob sie zu Boden gedrückt im Hochgebirge wächst oder prächtig und breitausladend in der Ebene. In beiden Individuen wirkt dieselbe Idee, dasselbe Wesen:[→]
Mit dem Besonderen als solchem, wie es uns unmittelbar in der Erscheinung gegenübertritt, ist unser Erkenntnisbedürfnis nicht befriedigt. Da wir aber einem Wesen der Sinnenwelt mit keiner anderen Absicht gegenübertreten, als eben dieses Wesen zu erkennen, so ist nicht anzunehmen, daß der Grund, warum wir uns mit dem Besonderen als solchem nicht befriedigt erklären, in unserem Erkenntnisvermögen liege. Er muß vielmehr im Objekte selbst liegen. Das Wesen des Besonderen selbst ist in dieser seiner Besonderheit eben durchaus noch nicht erschöpft; es drängt, um verstanden zu werden, zu einem solchen hin, welches kein Besonderes, sondern ein Allgemeines ist.
Dann geht Steiner ins Grundsätzliche – und stellt fest, dass das Denken bereits in seiner Zeit überhaupt nicht mehr ernst genommen wurde:[→]
Es ist ja richtig: Wir haben auf allen Gebieten der Kultur Fortschritte zu verzeichnen. Daß das aber Fortschritte in die Tiefe sind, kann kaum behauptet werden. [...] Wir sind mutlos auf allen Gebieten geworden, besonders aber auf jenem des Denkens und des Wollens. Was das Denken betrifft: Man beobachtet endlos, speichert die Beobachtungen auf und hat nicht den Mut, sie zu einer wissenschaftlichen Gesamtauffassung der Wirklichkeit zu gestalten. Die deutsche idealistische Philosophie aber zeiht man der Unwissenschaftlichkeit, weil sie diesen Mut hatte. Man will heute nur sinnlich schauen, nicht denken. Man hat alles Vertrauen in das Denken verloren.
Und nun folgt die zentrale Formulierung:[→f]
Wer dem Denken seine über die Sinnesauffassung hinausgehende Wahrnehmungsfähigkeit zuerkennt, der muß ihm notgedrungen auch Objekte zuerkennen, die über die bloße sinnenfällige Wirklichkeit hinaus liegen. Die Objekte des Denkens sind aber die Ideen. Indem sich das Denken der Idee bemächtigt, verschmilzt es mit dem Urgrunde des Weltendaseins; das, was außen wirkt, tritt in den Geist des Menschen ein: er wird mit der objektiven Wirklichkeit auf ihrer höchsten Potenz eins. Das Gewahrwerden der Idee in der Wirklichkeit ist die wahre Kommunion des Menschen. | Das Denken hat den Ideen gegenüber dieselbe Bedeutung wie das Auge dem Lichte, das Ohr dem Ton gegenüber. Es ist Organ der Auffassung.
Die Idee ist nichts Subjektives – sie ist der in der Wirklichkeit selbst wirkende Geist, und als Idee ist es der erkannte Geist. Indem der Mensch erlebt, was, seine’ Ideen wirklich sind, steht er in einer heiligen Vereinigung (Kommunion) mit der Wirklichkeit selbst, er ist von ihr überhaupt nicht mehr getrennt, er ist in ihr ... und sie in ihm.
Das bedeutet: Die Sinne liefern mit der bloßen, Wahrnehmung’ überhaupt nur die Hälfte der Wirklichkeit – denn ohne das Denken, das dann die Wahrnehmung durchdringt, wird nicht das Geringste erkannt. Erst mit dem Denken wird die Wirklichkeit vollständig:[→]
Wenn man freilich die Sinne für die einzigen Auffassungsorgane einer objektiven Wirklichkeit hält, so muß man zu dieser Ansicht kommen. Denn die Sinne liefern bloß solche Zusammenhänge der Dinge, die sich auf mechanische Gesetze zurückführen lassen. [...] Das objektiv Gegebene deckt sich durchaus nicht mit dem sinnlich Gegebenen, wie die mechanische Weltauffassung glaubt. Das letztere ist nur die Hälfte des Gegebenen. Die andere Hälfte desselben sind die Ideen, die ebenso Gegenstand der Erfahrung sind, freilich einer höheren, deren Organ das Denken ist.
Und noch einmal ganz deutlich:[→f]
Das Erkennen wäre schlechterdings ein nutzloser Prozeß, wenn in der Sinnenerfahrung uns ein Vollendetes überliefert würde. Jedes Zusammenfassen, Ordnen, Gruppieren der sinnenfälligen Tatsachen hätte keinerlei objektiven Wert. Das Erkennen hat nur einen Sinn, wenn wir die den Sinnen gegebene Gestalt nicht als eine vollendete gelten lassen, wenn sie uns eine Halbheit ist, die noch Höheres in sich birgt, was aber nicht mehr sinnlich wahrnehmbar ist. Da tritt der Geist ein. Er nimmt jenes Höhere wahr. Deshalb darf das Denken auch nicht so gefaßt werden, als wenn es zu dem Inhalte der Wirklichkeit etwas hinzubrächte. Es ist nicht mehr und nicht weniger Organ des Wahrnehmens wie Auge und Ohr. So wie jenes Farben, dieses Töne, so nimmt das Denken Ideen wahr. Der Idealismus ist deshalb mit dem Prinzipe des empirischen Forschens ganz gut vereinbar. Die Idee ist nicht Inhalt des subjektiven Denkens, sondern Forschungsresultat. Die Wirklichkeit tritt uns, indem wir uns ihr mit offenen Sinnen entgegenstellen, gegenüber. Sie tritt uns in einer Gestalt gegenüber, die wir nicht als ihre wahre ansehen können; die letztere erreichen wir erst, wenn wir unser Denken in Fluß bringen. Erkennen heißt: zu der halben Wirklichkeit der Sinnenerfahrung die Wahrnehmung des Denkens hinzufügen, auf daß ihr Bild vollständig werde.
Das Wesen der Wahrnehmung liegt demgegenüber gerade darin, das jeweils Besondere von etwas zu erfassen:, Der Grund der Besonderung kann nicht aus dem Begriffe abgeleitet, sondern muß innerhalb der Anschauung selbst gesucht werden. Das, was die Besonderheit eines Objektes ausmacht, läßt sich nicht begreifen, sondern nur anschauen.’[→f]
Schon jede Zusammenfassung der unzähligen Wahrnehmungseinzelnheiten zu einem Sinnhaften, Bedeutungshaften, ist Tätigkeit des Geistes, die das in der Wirklichkeit wirksame Geistige erfasst:[→]
So objektiv die Sinnenwelt, so objektiv sind diese Prinzipien. Daß sie für die Sinne nicht, sondern nur für die Vernunft zur Erscheinung kommen, ist für ihren Inhalt gleichgültig. Gäbe es keine denkenden Wesen, so kämen diese Prinzipien zwar niemals zur Erscheinung; sie wären deshalb aber nicht minder die Essenz der Erscheinungswelt.
Die gedankenlose Wahrnehmung weiß gar nichts:, Die Sinne sagen uns nicht, daß die Dinge in irgendeinem Verhältnisse zueinander stehen, wie etwa, daß dieses Ursache, jenes Wirkung ist. Für die Sinne sind alle Dinge gleich wesentlich für den Weltenbau. Das gedankenlose Betrachten weiß nicht, daß das Samenkorn auf einer höheren Stufe der Vollkommenheit steht als das Staubkorn auf der Straße.’[→] Erst in der Idee kommt man zu dem klaren, lichten, unmittelbaren Wesen der Dinge:[→]
Das liegt nicht etwa darinnen, daß wir sie in unserem Bewußtsein unmittelbar gegenwärtig haben. Das liegt an ihr selbst. Wenn sie ihr Wesen nicht selbst ausspräche, dann würde sie uns eben auch so erscheinen wie die übrige Wirklichkeit: aufklärungsbedürftig. [...] Wäre die Idee nicht eine auf sich selbst gebaute Wesenheit, so könnten wir ein solches Bewußtsein gar nicht haben. Wenn etwas das Zentrum, aus dem es entspringt, nicht in sich, sondern außer sich hat, so kann ich, wenn es mir gegenübertritt, mich mit ihm nicht befriedigt erklären, ich muß über dasselbe hinausgehen, eben zu jenem Zentrum. Nur wenn ich auf etwas stoße, das nicht über sich hinausweist, dann erlange ich das Bewußtsein: jetzt stehst du innerhalb des Zentrums; hier kannst du stehen bleiben. Mein Bewußtsein, daß ich innerhalb eines Dinges stehe, ist nur die Folge von der objektiven Beschaffenheit dieses Dinges, daß es sein Prinzip mit sich bringe. Wir gelangen, indem wir uns der Idee bemächtigen, in den Kern der Welt. Was wir hier erfassen, ist dasjenige, aus dem alles hervorgeht. Wir werden mit diesem Prinzipe eine Einheit; deshalb erscheint uns die Idee, die das Objektivste ist, zugleich als das Subjektivste.
Die sinnenfällige Wirklichkeit ist uns ja gerade deshalb so rätselhaft, weil wir ihr Zentrum nicht in ihr selbst finden. Sie hört es auf zu sein, wenn wir erkennen, daß sie mit der Gedankenwelt, die in uns zur Erscheinung kommt, dasselbe Zentrum hat.
Der Ideengehalt der Welt, ist auf sich selbst gebaut, in sich vollkommen. Wir erzeugen ihn nicht, wir suchen ihn nur zu erfassen. Das Denken erzeugt ihn nicht, sondern nimmt ihn wahr. Es ist nicht Produzent, sondern Organ der Auffassung.’[→]
So, ist die Erkenntnistheorie zugleich die Lehre von der Bedeutung und Bestimmung des Menschen’.[→] Die wahre Aufgabe des Menschen ist es, sich in den Zusammenhang des Weltganzen zu stellen, indem er wieder vereinigt, was sein eigenes Wesen mit der Trennung in Wahrnehmung und Denken zunächst in zwei Teile spalten musste:[→,→]
Unser Geist hat die Aufgabe, sich so auszubilden, daß er imstande ist, alle ihm gegebene Wirklichkeit in der Art zu durchschauen, wie sie von der Idee ausgehend erscheint. [...] Und darinnen besteht die wissenschaftliche Methode, daß wir den Begriff einer einzelnen Erscheinung in seinem Zusammenhange mit der übrigen Ideenwelt aufzeigen.
Mit dieser Geistanschauung kommt Rudolf Steiner schon in dieser ersten Veröffentlichung auch auf wesentliche Erkenntnisse in der Sphäre des Moralischen. Denn auch hier geht es um das Erkennen der einzelnen Individualität. Was im Bereich des übrigen Erkennens nicht selbst geleistet wird, ist bloßes Dogma – und in der Sphäre des Moralischen bloßes Gebot. Beides aber ist noch nicht wirklich menschlich:[→]
[...] und wir müssen demzufolge nur ein solches Handeln als ethisch gelten lassen, bei dem die Tat nur aus der in uns liegenden Idee derselben fließt. Der Mensch vollbringt von diesem Gesichtspunkte aus nur deshalb eine Handlung, weil deren Wirklichkeit für ihn Bedürfnis ist. Er handelt, weil ein innerer (eigener) Drang, nicht eine äußere Macht, ihn treibt.
Rudolf Steiner geht es um den innersten Kern der Freiheit. Diese wird da verwirklicht, wo nichts anderes das Handeln bestimmt als die Idee selbst – und die Liebe zu dieser, zu ihrer Verwirklichung. Damit wird auch jede Handlung unfrei, die nur der Verwirklichung eines anderen Zweckes dient – wie es etwa bei egoistischen Handlungen der Fall ist:[→f]
Da nehmen wir an der Handlung selbst kein Interesse; sie ist uns nicht Bedürfnis, wohl aber der Nutzen, den sie uns bringt. Dann aber empfinden wir es auch zugleich als Zwang, daß wir jene Handlung, nur dieses Zweckes willen, vollbringen müssen. Sie selbst ist uns nicht Bedürfnis; denn wir unterließen sie, wenn sie den Nutzen nicht im Gefolge hätte. Eine Handlung aber, die wir nicht um ihrer selbst willen vollbringen, ist eine unfreie. Der Egoismus handelt unfrei.
Wenn wir all diese Schlüsselstellen intensiv durchdenken und empfinden – und natürlich, wenn möglich, auch in ihrem größeren Zusammenhang selbst nachlesen –, wird deutlich, wie edel und tief hier ein ethischer Individualismus vertreten wird, dem es um das Heiligste überhaupt geht: um die Verwirklichung einer wahren Individualität, die aus Liebe zum individuell als wahr und gut Erkannten handelt...
Das Wesen der Idee und wie sie sich jeweils auslebt, macht auch den Unterschied der Naturreiche aus. Denn in der, toten Natur’ (unorganische Welt) wirkt das Geistige gleichsam ganz von außen auf die Dinge – etwa in den Fall- oder Wurfgesetzen. In der lebendigen Natur wirkt es bereits von innen heraus. Ein lebendiger Organismus ist nicht von außen zu erklären. Im Reich des Menschen wiederum tritt der Geist als solcher in die Offenbarung. In den Worten Rudolf Steiners:[→-→]
Die Art nun, wie der Begriff (die Idee) in der Sinnenwelt sich auslebt, macht den Unterschied der Naturreiche. Gelangt das sinnenfällig wirkliche Wesen nur zu einem solchen Dasein, daß es völlig außerhalb des Begriffes steht, nur von ihm als einem Gesetze in seinen Veränderungen beherrscht wird, dann nennen wir dieses Wesen unorganisch. Alles, was mit einem solchen vorgeht, ist auf die Einflüsse eines anderen Wesens zurückzuführen; und wie die beiden aufeinander wirken, das läßt sich durch ein außer ihnen stehendes Gesetz erklären. In dieser Sphäre haben wir es mit Phänomenen und Gesetzen zu tun, die, wenn sie ursprünglich sind, Urphänomene heißen können. [...]
Es kann aber eine sinnenfällige Einheit selbst schon über sich hinausweisen; sie kann, wenn wir sie erfassen wollen, uns nötigen, zu weiteren Bestimmungen als zu den uns wahrnehmbaren fortzugehen. Dann erscheint das begrifflich Erfaßbare als sinnenfällige Einheit. Die beiden, Begriff und Wahrnehmung, sind zwar nicht identisch, aber der Begriff erscheint nicht außer der sinnlichen Mannigfaltigkeit als Gesetz, sondern in derselben als Prinzip. Er liegt ihr als das sie Durchsetzende, nicht mehr sinnlich Wahrnehmbare zugrunde, das wir Typus nennen. Damit hat es die organische Naturwissenschaft zu tun.
Aber auch hier erscheint der Begriff noch nicht in seiner ihm eigenen Form als Begriff, sondern erst als Typus. Wo nun derselbe nicht mehr bloß als [...] durchsetzendes Prinzip, sondern in seiner Begriffsform selbst auftritt, da erscheint er als Bewußtsein, da kommt endlich das zur Erscheinung, was auf den unteren Stufen nur dem Wesen nach vorhanden ist. Der Begriff wird hier selbst zur Wahrnehmung. Wir haben es mit dem selbstbewußten Menschen zu tun.
Naturgesetz, Typus, Begriff sind die drei Formen, in denen sich das Ideelle auslebt. Das Naturgesetz ist abstrakt, über der sinnenfälligen Mannigfaltigkeit stehend, es beherrscht die unorganische Naturwissenschaft. Hier fallen Idee und Wirklichkeit ganz auseinander. Der Typus vereinigt schon beide in einem Wesen. Das Geistige wird wirkendes Wesen, aber es wirkt noch nicht als solches, es ist nicht als solches da, sondern muß, wenn es seinem Dasein nach betrachtet werden will, als sinnenfälliges angeschaut werden. So ist es im Reiche der organischen Natur. [...] Im menschlichen Bewußtsein ist der Begriff selbst das Wahrnehmbare. Anschauung und Idee decken sich. Es ist eben das Ideelle, welches angeschaut wird.
Im Weiteren setzt sich Steiner auch hier bereits mit der materialistischen Anschauung auseinander, dass sämtliche Qualitäten, zum Beispiel Farben, auf bloße, Wellenlängen’ oder atomare Bewegungsvorgänge zu reduzieren seien. Das Mechanistische ist eben nicht, Ursache’ und das, Primäre’, sondern steht in völliger Einheit mit dem Übrigen, was nicht weniger entscheidend ist:[→,→]
Die Qualität „Rot“ und ein bestimmter Bewegungsvorgang sind in Wirklichkeit eine untrennbare Einheit. Die Trennung der beiden Geschehnisse kann nur eine begriffliche, im Verstande vollzogene sein. Der dem „Rot“ entsprechende Bewegungsvorgang hat an sich keine Wirklichkeit; er ist ein Abstraktum. Die Tatsache: „ich sehe Rot“ aus einem Bewegungsvorgang herleiten zu wollen, ist genau so absurd, wie die Ableitung der wirklichen Eigenschaften eines in Würfelform kristallisierten Steinsalzkörpers aus dem mathematischen Würfel. [...]| [...] Wer in diesem Vorurteil der Physiker nicht befangen ist, der muß einsehen, daß die Bewegungsvorgänge Zustände sind, die an die sinnenfälligen Qualitäten gebunden sind. Der Inhalt der wellenförmigen Bewegungen, die den Tonvorkommnissen entsprechen, sind die Tonqualitäten selbst.
Und am Ende kommt Steiner noch einmal zu einer Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnis – zu dem Begriff der Wahrheit im Sinne des zuvor Entwickelten:[→f]
Der Gedankeninhalt, der aus dem menschlichen Geiste entspringt, wenn dieser sich der Außenwelt gegenüberstellt, ist die Wahrheit. Der Mensch kann keine andere Erkenntnis verlangen als eine solche, die er selbst hervorbringt. [...] Die Dinge sprechen zu uns, und unser Inneres spricht, wenn wir die Dinge beobachten. Diese zwei Sprachen stammen aus demselben Urwesen, und der Mensch ist berufen, deren gegenseitiges Verständnis zu bewirken. Darin besteht das, was man Erkenntnis nennt. [...] Für den Menschen besteht nur so lange der Gegensatz von objektiver äußerer Wahrnehmung und subjektiver innerer Gedankenwelt, als er die Zusammengehörigkeit dieser Welten nicht erkennt. Die menschliche Innenwelt ist das Innere der Natur.
Die Wahrheit kommt also im Menschengeist zur Erscheinung. Auf diese Weise haftet allem Erkennen immer auch die Gefahr des Subjektiven an – entscheidend aber ist, dass der menschliche Geist selbst diese Gefahr erkennen kann und dass er, unabhängig von dieser Gefahr, immer schon im Element der Wahrheit lebt:, Es handelt sich aber gar nicht darum, daß alle Menschen das gleiche über die Dinge denken, sondern nur darum, daß sie, wenn sie über die Dinge denken, im Elemente der Wahrheit leben.’[→]
Auch jeder Streit über zum Beispiel gesellschaftliche Fragen kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es hier nur um Bewertungen geht: Welche Bedeutung sollen Gerechtigkeit, Gleichheit, Leistung, Konkurrenz etc. spielen? Demgegenüber wäre es von entscheidender Bedeutung, zunächst einmal zu erkennen, was die zugrundeliegenden Wahrheiten für sich sind. Was ist Gerechtigkeit? Was ist Gleichheit? Was ist Konkurrenz? Leistung? Indem man sich aufrichtig in die reinen Begriffe und Ideen vertieft, verliert sich jeder Streit, denn hier geht es nur um die Wahrheit.
Und dann kann man auf ganz neue Weise noch einmal an die andere Frage herangehen: Welche Art von Gesellschaft wäre wahrhaft menschlich? Welche Bedeutung sollte dem, was wir als Wesen von Gerechtigkeit, von Gleichheit, von Empathie, von Mitleid, von Zusammenwirken und so weiter, und so weiter aufrichtig erkannt haben, in einem Zusammenleben zukommen, das wir erst als wahrhaft menschlich zu bezeichnen wagen würden? Und mit derselben Aufrichtigkeit würde man dann auch erkennen, wie sehr bisher noch nicht-menschliche Ideen wie Egoismus, Profit, Eng-Sichtigkeit und Verantwortungslosigkeit dieses sogenannte, Zusammenleben’ prägen – vollkommen gewollt, als sogenannte Dogmen, deren Gesamtheit sich, Kapitalismus’ nennt.
Wir sehen also, wie weitreichend die Erkenntnisse Rudolf Steiners vom Wesen des menschlichen Geistes bereits an diesem Punkt sind. Als er all dies formulierte, ist er gerade einmal zweiundzwanzig Jahre alt – und hat das Wesen des Erkennens bereits tiefer erfasst als selbst der, große’ Kant, der stets davor zurückscheute, die Bedeutung des Denkens in ihrer ganzen Tiefe zu erkennen. Kant war nicht mutig genug. Zwar sprach er von den Kategorien – aber das war es dann auch. Wie sehr das Denken im innersten Zentrum des Weltgeschehens steht und unmittelbar mit diesem verbunden ist, das wagte Kant nie anzuerkennen. Erst Rudolf Steiner formulierte wieder, dass der Geist nichts Sekundäres ist – im Gegenteil...
,Grundlinien einer Erkenntnistheorie...’ (GA 2)
In den, Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung’ setzt Steiner seine Ausführungen 1886 fort.2
Eine, Erfahrungwissenschaft’, die bei den bloß sinnlichen Tatsachen stehenbleibt, verkennt, dass jede Art von Gesetzmäßigkeit und Erkenntnis nur über das Denken möglich ist. Indem aber die Bedeutung des Denkens selbst erkannt wird, kann das Denken mitsamt seiner inneren Bestimmungen auch selbst Erfahrung werden. Die wahre Erkenntnistheorie wird also zu einer Erfahrungswissenschaft höherer Art – nirgendwo wird die Erfahrung verlassen. Nur hört man auf, die Bedeutung des Denkens zu verkennen. Man taucht vielmehr in sein Wesen ein.[→]
Die Welt des Denkens, der Ideen, beruht dabei vollkommen auf sich selbst. Der Denkende kann an ihrer Eigengesetzlichkeit gar nichts ändern. Er kann sie aber erkennen. Damit ist das Denken an sich im Kern in keiner Weise subjektiv – auch wenn es das jeweilige, Subjekt’ ist, das denkt, also am Wesen der Ideen-Welt Anteil hat:[→]
Wir müssen uns zweierlei vorstellen: einmal, daß wir die ideelle Welt tätig zur Erscheinung bringen, und zugleich, daß das, was wir tätig ins Dasein rufen, auf seinen eigenen Gesetzen beruht. [...] | Man braucht einfach die gewöhnliche Meinung aufzugeben, daß es so viele Gedankenwelten gibt als menschliche Individuen. [...] Man denke sich an Stelle dieser Meinung einmal die folgende gesetzt: Es gibt überhaupt nur einen einzigen Gedankeninhalt, und unser individuelles Denken sei weiter nichts als ein Hineinarbeiten unseres Selbstes, unserer individuellen Persönlichkeit in das Gedankenzentrum der Welt.
Das ist genau das, was Steiner in GA 1 als, Element der Wahrheit’ bezeichnet hatte.
Diese Welt der Ideen ist ein in sich zusammenhängendes Ganzes – keine Idee ist ohne Zusammenhang mit allen anderen. Die Idee des Organismus etwa steht in innigem Zusammenhang mit denen der gesetzmäßigen Entwicklung, des Wachstums.[→f] Im Folgenden unterscheidet Steiner zwischen, Begriffen’ und, Ideen’, um den Unterschied zwischen dem die Begriffe trennenden Verstand und der die Ideen überall verbindenden Vernunft erlebbar zu machen. Der Verstand trennt und analysiert – doch hat der Mensch auch das andere Vermögen: die synthetisierende, alles wieder in die höhere Einheit führende Vernunft. Und auf diese Weise kann er die reale Einheit der Ideen-Welt erleben.[→]
Und auch hier wieder kommt Steiner zu der Formulierung, dass man auf dem Wege der Erkenntnistheorie zu der Erkenntnis komme,, daß das Denken der Kern der Welt ist’ – denn wo immer es darum geht,, das Wesen einer Sache zu finden, so besteht dieses Auffinden immer in dem Zurückgehen auf den Ideengehalt der Welt’.[→] Damit ist, das Wesen der Dinge innerhalb unseres Bewußtseins in der Ideenwahrnehmung anzutreffen’.[→] Und es braucht auch nichts weiter – etwa so etwas wie, Kraft’ oder, Wille’, wie es in damaligen Philosophien vielfach vertreten wurde. Denn all diese Faktoren sind letztlich nur, Abstraktionen aus der Wahrnehmungswelt, die selbst erst der Erklärung durch das Denken harren’.[→]
Diese geist-reale Erkenntnistheorie hat nun auch unmittelbare Konsequenzen für die Frage religiöser Ansichten. Sie ist nicht verträglich mit jeder Art jenseitiger Gottheiten – denn das innerste Wesen der Dinge ist in keiner Weise rätselhaft, es ist dem Denken zugänglich. Und so formuliert Steiner bis ins Spirituelle hinein:[→]
Der gesamte Seinsgrund hat sich in die Welt ausgegossen, er ist in sie aufgegangen. Im Denken zeigt er sich in seiner vollendetsten Form, so wie er an und für sich selbst ist. Vollzieht daher das Denken eine Verbindung, fällt es ein Urteil, so ist es der in dasselbe eingeflossene Inhalt des Weltgrundes selbst, der verbunden wird. Im Denken sind uns nicht Behauptungen gegeben über irgendeinen jenseitigen Weltengrund, sondern derselbe ist substantiell in dasselbe eingeflossen. Wir haben eine unmittelbare Einsicht in die sachlichen, nicht bloß in die formellen Gründe, warum sich ein Urteil vollzieht. Nicht über irgend etwas Fremdes, sondern über seinen eigenen Inhalt bestimmt das Urteil. Unsere Ansicht begründet daher ein wahrhaftes Wissen. Unsere Erkenntnistheorie ist wirklich kritisch. Unserer Ansicht gemäß darf nicht nur der Offenbarung gegenüber nichts zugelassen werden, wofür nicht innerhalb des Denkens sachliche Gründe da sind; sondern auch die Erfahrung muß innerhalb des Denkens nicht nur nach der Seite ihrer Erscheinung, sondern als Wirkendes erkannt werden. Durch unser Denken erheben wir uns von der Anschauung der Wirklichkeit als einem Produkte zu der als einem Produzierenden.
Diese Anschauung klingt auch da an, wo etwa die jüdische Esoterik beschreibt, wie eine göttliche Welt dem Urmenschen die Fähigkeit gab, allen Dingen und Wesen ihren Namen zu geben. Wenn dieser Name im Sinne des Realismus noch das Wesen bedeutet, so ist damit nichts anderes ausgedrückt, als dass es der Mensch selbst ist, der eine unmittelbare Verbindung zu diesem Wesen der Dinge hat – indem nämlich sein eigenes Geistwesen, das sich im Denken offenbart, mit diesem Wesen der Dinge vollkommen vereint ist bzw. sich erkennend vereinigen kann.
Noch einmal wird deutlich, dass erst mit dem menschlichen Geist die erste Schöpfung vollendet wird, da nun erst das Erkennen in die reale Wirklichkeit tritt:[→]
Was ohne den Geist da war, war nur die Hälfte der Wirklichkeit, war unvollendet, in jedem Punkte Stückwerk. [...] Wäre der Mensch ein bloßes Sinnenwesen, ohne geistige Auffassung, so wäre die unorganische Natur wohl nicht minder von Naturgesetzen abhängig, aber sie träten nie als solche ins Dasein ein. Es gäbe zwar Wesen, welche das Bewirkte (die Sinnenwelt), nicht aber das Wirkende (die innere Gesetzlichkeit) wahrnähmen. Es ist wirklich die echte, und zwar die wahrste Gestalt der Natur, welche im Menschengeiste zur Erscheinung kommt, während für ein bloßes Sinnenwesen nur ihre Außenseite da ist. Die Wissenschaft hat hier eine weltbedeutsame Rolle. Sie ist der Abschluß des Schöpfungswerkes. Es ist die Auseinandersetzung der Natur mit sich selbst, die sich im Bewußtsein des Menschen abspielt. Das Denken ist das letzte Glied in der Reihenfolge der Prozesse, die die Natur bilden.
Aber über diese Natur-Erkenntnis hinaus gibt es noch etwas Höheres: Jene Sphäre, wo der Geist nur noch mit sich selbst zu tun hat, was also nicht mehr Natur-Wissenschaften, sondern Geistes-Wissenschaften sind:[→f]
Hier hat es unser Bewußtsein mit geistigem Inhalte selbst zutun: mit dem einzelnen Menschengeist, mit den Schöpfungen der Kultur, der Literatur, mit den aufeinanderfolgenden wissenschaftlichen Überzeugungen, mit den Schöpfungen der Kunst. Geistiges wird durch den Geist erfaßt. Die Wirklichkeit hat hier schon das Ideelle, die Gesetzmäßigkeit in sich, die sonst erst in der geistigen Auffassung hervortritt. Was bei den Naturwissenschaften erst Produkt des Nachdenkens über die Gegenstände ist, das ist hier denselben eingeboren.
Diese Tatsache aber verleiht den Geistes-Wissenschaften einen völlig anderen Charakter. Denn der Mensch soll weder, nach einer ihn beherrschenden Gesetzlichkeit wirken’ (wie die unorganische Natur dieser unterworfen ist), auch nicht nur, Einzelform eines allgemeinen Typus sein’ (wie die Wesen der organischen Natur, Pflanzen und Tiere), sondern, er soll sich den Zweck, das Ziel seines Daseins, seiner Tätigkeit selbst vorsetzen’.[→] Das Wesen des Menschen ist zur Freiheit bestimmt – deswegen können die Geisteswissenschaften ihrem innersten Wesen nach auch nur Freiheitswissenschaft sein:[→]
Das ist das Wesen der Natur, daß Gesetz und Tätigkeit auseinanderfallen, diese von jenem beherrscht erscheint; das hingegen ist das Wesen der Freiheit, daß beide zusammenfallen, daß sich das Wirkende in der Wirkung unmittelbar darlebt und daß das Bewirkte sich selbst regelt.
Die Geisteswissenschaften sind im eminenten Sinne daher Freiheitswissenschaften. Die Idee der Freiheit muß ihr Mittelpunkt, die sie beherrschende Idee sein. Deshalb stehen Schillers ästhetische Briefe so hoch,3 weil sie das Wesen der Schönheit in der Idee der Freiheit finden wollen, weil die Freiheit das Prinzip ist, das sie durchdringt.
Der Geist nimmt nur jene Stelle in der Allgemeinheit, im Weltganzen ein, die er sich als individueller gibt. Während in der Organik stets das Allgemeine, die Typusidee im Auge behalten werden muß, ist in den Geisteswissenschaften die Idee der Persönlichkeit festzuhalten. Nicht die Idee, wie sie sich in der Allgemeinheit (Typus) darlebt, sondern wie sie im Einzelwesen (Individuum) auftritt, ist es, worauf es ankommt. Natürlich ist nicht die zufällige Einzelpersönlichkeit [...] maßgebend, sondern die Persönlichkeit überhaupt [...].
Die erste Wissenschaft nun, in der der Geist nur mit sich selbst zu tun hat, ist die Psychologie. Und dies wäre ganz ernst zu nehmen – im Sinne einer Freiheitswissenschaft:[→]
Fichte sprach dem Menschen nur insofern eine Existenz zu, als er sie selbst in sich setzt. Mit andern Worten: Die menschliche Persönlichkeit hat nur jene Merkmale, Eigenschaften, Fähigkeiten usw., die sie sich vermöge der Einsicht in ihr Wesen selbst zuschreibt. [...] Sie [diese Wahrheit, H.N.] ist dazu bestimmt, das oberste Prinzip der Psychologie zu werden. Sie bestimmt die Methode derselben. Wenn der Geist eine Eigenschaft nur insofern besitzt, als er sich sie selbst beilegt, so ist die psychologische Methode das Vertiefen des Geistes in seine eigene Tätigkeit. Selbsterfassung ist also hier die Methode.
Immer wieder geht es darum, zu erkennen, dass der Mensch dazu bestimmt ist, ein sich selbst Bestimmender zu sein – dieses Möglichkeit wahrzumachen und zu verwirklichen. Das ist das Wesen von Individualität. Und – dies muss in einem Zeitalter des Konsums und der Werbebotschaften eines, Verwirkliche dich selbst’ hinzugefügt werden – es geht selbstverständlich nicht um erneute Äußerlichkeiten (Hobbys, Accessoires, Kleidung etc.), sondern um die Entwicklung des inneren, seelisch-geistigen Wesens.
Deswegen hätte eine sich selbst verstehende Psychologie die Aufgabe, unmittelbar Geistes-Wissenschaft zu sein – während die heutige Psychologie nur, die Erscheinungen, in denen sich der Geist darlebt, nicht diesen selbst, zum Gegenstande [...] macht’.[→] 4
,Wahrheit und Wissenschaft’ (GA 3)
1892, Rudolf Steiner ist jetzt Anfang dreißig, erscheint sein Büchlein, Wahrheit und Wissenschaft’.5 Dieses beginnt bereits mit einem Paukenschlag – der Feststellung, dass keine einzige jüngere Philosophie die entscheidende Frage gestellt habe, erst recht nicht der so verherrlichte Kant:[→f]
Die Philosophie der Gegenwart leidet an einem ungesunden Kant-Glauben. [...] Aber wir müssen endlich einsehen, daß wir nur dann den Grund zu einer wahrhaft befriedigenden Welt- und Lebensanschauung legen können, wenn wir uns in entschiedenen Gegensatz zu diesem Geiste stellen. [...] | [...] Die Annahme von außerhalb unserer Welt liegenden Prinzipien derselben zeigt sich als das Vorurteil einer abgestorbenen, in eitlem Dogmenwahn lebenden Philosophie. Zu diesem Ergebnisse hätte Kant kommen müssen, wenn er wirklich untersucht hätte, wozu unser Denken veranlagt ist. Statt dessen bewies er in der umständlichsten Art, daß wir zu den letzten Prinzipien, die jenseits unserer Erfahrung liegen, wegen der Einrichtung unseres Erkenntnisvermögens nicht gelangen können. Vernünftigerweise dürfen wir sie aber gar nicht in ein solches Jenseits verlegen. Kant hat wohl die „dogmatische“ Philosophie widerlegt, aber er hat nichts an deren Stelle gesetzt. Die zeitlich an ihn anknüpfende deutsche Philosophie entwickelte sich daher überall im Gegensatz zu Kant. Fichte, Schelling, Hegel kümmerten sich nicht weiter um die von ihrem Vorgänger abgesteckten Grenzen unseres Erkennens und suchten die Urprinzipien der Dinge innerhalb des Diesseits der menschlichen Vernunft. [...] Das Verhängnis dieser Denker war, daß sie Erkenntnisse der höchsten Wahrheiten suchten, ohne für solches Beginnen durch eine Untersuchung der Natur des Erkennens selbst den Grund gelegt zu haben. Die stolzen Gedankengebäude Fichtes, Schellings und Hegels stehen daher ohne Fundament da.
Und erneut führt Steiner aus, was er auch mit dieser Schrift wieder zeigen wird:[→f]
Das Resultat dieser Untersuchungen ist, daß die Wahrheit nicht, wie man gewöhnlich annimmt, die ideelle Abspiegelung von irgendeinem Realen ist, sondern ein freies Erzeugnis des Menschengeistes, das überhaupt nirgends existierte, wenn wir es nicht selbst hervorbrächten. Die Aufgabe der Erkenntnis ist nicht: etwas schon anderwärts Vorhandenes in begrifflicher Form zu wiederholen, sondern die: ein ganz neues Gebiet zu schaffen, das mit der sinnenfällig gegebenen Welt zusammen erst die volle Wirklichkeit ergibt. Damit ist die höchste Tätigkeit des Menschen, sein geistiges Schaffen, organisch dem allgemeinen Weltgeschehen eingegliedert. Ohne diese Tätigkeit wäre das Weltgeschehen gar nicht als in sich abgeschlossene Ganzheit zu denken. Der Mensch ist dem Weltlauf gegenüber nicht ein müßiger Zuschauer [...], sondern der tätige Mitschöpfer des Weltprozesses; und das Erkennen ist das vollendetste Glied im Organismus des Universums.
Auch die Konsequenz für das Moralische wird erneut dezidiert formuliert:, Für die Gesetze unseres Handelns, für unsere sittlichen Ideale hat diese Anschauung die wichtige Konsequenz, daß auch diese nicht als das Abbild von etwas außer uns Befindlichem angesehen werden können, sondern als ein nur in uns Vorhandenes. Eine Macht, als deren Gebote wir unsere Sittengesetze ansehen müßten, ist damit ebenfalls abgewiesen. [...] Unsere sittlichen Ideale sind unser eigenes freies Erzeugnis. Wir haben nur auszuführen, was wir uns selbst als Norm unseres Handelns vorschreiben. Die Anschauung von der Wahrheit als Freiheitstat begründet somit auch eine Sittenlehre, deren Grundlage die vollkommen freie Persönlichkeit ist.’[→f]
Im Folgenden zeigt Steiner, dass bereits Kants Grundfrage (,Wie sind synthetische Urteile a priori möglich’) völlig falsch gestellt ist, nämlich in keiner Weise voraussetzungslos. Kant sucht nach Erkenntnissen, die unabhängig von der Erfahrung sind. Aber damit hat er bereits implizit die Trennung in Sinne und Denken vorausgesetzt und gewertet: Die, Erfahrung’ könne trügen, sichere Erkenntnis sei zunächst nur jene vor aller Erfahrung (a priori). Steiner entgegnet dem, dass überhaupt nicht vorausgesetzt werden darf, ob Urteile überhaupt ohne Erfahrung möglich seien – ja, mehr noch, selbst rein mathematische Urteile, die Kant zum Bereich des, a priori’ zählt, können nur gewonnen werden, indem sie denkend eine Erfahrung werden.[→]
So übernimmt Kant gleich zwei Vorurteile der dogmatischen Philosophie:, erstens, daß wir außer der Erfahrung noch einen Weg haben müssen, um zu Erkenntnissen zu gelangen, und zweitens, daß alles Erfahrungswissen nur bedingte Gültigkeit haben könne’.[→]
Was ist nun der wirkliche Ausgangspunkt jeder Erkenntnistheorie? Steiner nimmt hier als solchen Anfang das, unmittelbar gegebene Weltbild’, bevor irgendeine kleinste gedankliche Bestimmung vorgenommen wurde, was in Wirklichkeit nur existieren würde, wenn, ein Wesen mit vollentwickelter, menschlicher Intelligenz plötzlich aus dem Nichts geschaffen würde und der Welt gegenüberträte’.[→] Es geht sozusagen um die saubere gedankliche Trennung zwischen allem, was erst durch das Erkennen hinzutreten würde, und allem übrigen, was zunächst das Gegebene sein kann:, Empfindungen, Wahrnehmungen, Anschauungen, Gefühle, Willensakte, Traum- und Phantasiegebilde, Vorstellungen, Begriffe und Ideen’.[→]
Der nächste Punkt ist nun, dass innerhalb dieses Gegebenen ein Gebiet liegt, das nicht nur gegeben ist – das wirklich hervorgebracht werden muss, wenn es, gegeben’ sein soll – das Gebiet der Begriffe und Ideen.[→f] Indem nun diese und alles Übrige voneinander getrennt werden,, um das Erkennen begreifen zu können’, ist, die Einheit des Weltbildes künstlich zerrissen’, die doch bis dahin eine Einheit war.[→] Es erweist sich nun aber gerade, dass es auch wieder eine Einheit wird, indem alles Übrige mit Begriffen und Ideen durchdrungen wird – die denkende Betrachtung der Dinge ist die Synthese, in der Erkenntnis ist die Einheit wiederhergestellt.[→]
Mit anderen Worten: Das Denken hebt zunächst gewisse Einzelheiten aus dem Weltganzen heraus und bezieht diese nach den den Ideen innewohnenden Gesetzmäßigkeiten aufeinander, bis sich eine Erkenntnis ergibt, in der alles wieder miteinander zusammenhängt.[→]
Um auf das Beispiel der Wurfgesetze zurückzukommen: In der sinnlichen Erfahrung des geworfenen Steines ist uns zunächst nur dieser gegeben – seine, Bahn’, deren mögliche Gesetzmäßigkeit überhaupt nicht sichtbar ist. Indem nun aber das Denken hinzutritt und das sinnlich Gegebene durchdringt, kann diese Gesetzmäßigkeit offenbar werden – und sie ist tatsächlich das Wesen der Flugbahn geworfener Dinge. Was bedeutet dies? Steiner formuliert:[→]
Wäre in dem Weltinhalte von vornherein der Gedankeninhalt mit dem Gegebenen vereinigt; dann gäbe es kein Erkennen. Denn es könnte nirgends das Bedürfnis entstehen, über das Gegebene hinauszugehen. Würden wir aber mit dem Denken und in demselben allen Inhalt der Welt erzeugen, dann gäbe es ebensowenig ein Erkennen. Denn was wir selbst produzieren, brauchen wir nicht zu erkennen. Das Erkennen beruht also darauf, daß uns der Weltinhalt ursprünglich in einer Form gegeben ist, die unvollständig ist, die ihn nicht ganz enthält, sondern die außer dem, was sie unmittelbar darbietet, noch eine zweite wesentliche Seite hat. Diese zweite, ursprünglich nicht gegebene Seite des Weltinhaltes wird durch die Erkenntnis enthüllt. [...] Erst die durch die Erkenntnis gewonnene Gestalt des Weltinhaltes, in der beide aufgezeigte Seiten desselben vereinigt sind, kann Wirklichkeit genannt werden.
Hier ist nun auch der Zusammenhang mit Fichte. In der gesamten übrigen Welt ist das Wesen der Dinge in Wirklichkeit mit diesen vereint – das Wurfgesetz bestimmt die Bahn des Steines, ob dies erkannt wird oder nicht. Nur der Mensch ist nicht von vornherein wahrhaft ein Erkennender – darin gerade liegt die Einzigartigkeit seines Freiheitswesens: Er muss das Wesen der Erkenntnis selbst verwirklichen, wenn es da sein soll. Wäre er von Natur aus fertig ein Erkennender, so wäre es gar keine Erkenntnis, da er sich dessen nie bewusst werden könnte. Er kann es nur, weil es seine eigene Tat sein muss und ist. Er selbst verwirklicht die Idee des Erkennens:[71f]
Bei jedem andern Teil des Weltbildes müssen wir uns vorstellen, daß die Verbindung das Ursprüngliche, von vornherein Notwendige ist, und daß nur am Beginne des Erkennens für die Erkenntnis eine künstliche Trennung eingetreten ist, die aber zuletzt durch das Erkennen, der ursprünglichen Wesenheit des Objektiven gemäß, wieder aufgehoben wird. [...] Begriff und gegebene Wirklichkeit des Bewußtseins aber sind ursprünglich getrennt [...], und deswegen ist das Erkennen so beschaffen, wie wir es geschildert haben. Weil im Bewußtsein notwendig Idee und Gegebenes getrennt auftreten, deswegen spaltet sich für dasselbe die gesamte Wirklichkeit in diese zwei Teile, und weil das Bewußtsein nur durch eigene Tätigkeit die Verbindung der beiden genannten Elemente bewirken kann, deshalb gelangt es nur durch Verwirklichung des Erkenntnisaktes zur vollen Wirklichkeit. Die übrigen Kategorien (Ideen) wären auch dann notwendig mit den entsprechenden Formen des Gegebenen verknüpft, wenn sie nicht in die Erkenntnis aufgenommen würden; die Idee des Erkennens kann mit dem ihr entsprechenden Gegebenen nur durch die Tätigkeit des Bewußtseins vereinigt werden. Ein wirkliches Bewußtsein existiert nur, wenn es sich selbst verwirklicht.
Fichtes Fehler war, dass er für die berühmte, Tathandlung’ des Ich gar keinen echten Inhalt fand – die bloße Selbstsetzung bleibt letztlich leer, weil sie überhaupt zu keiner Welt findet. Die wahrhaft freie Handlung des Ich aber ist eben die hier beschriebene Verwirklichung des Erkennens. Dies ist wirklich ur-eigene Tat des Ich.[→f] Schon da, wo Fichte formuliert, Das Ich setzt ursprünglich schlechthin sein eigenes Sein’, kommt er ohne die Kategorie, Sein’ gar nicht aus – das Ich müsste also erst einmal erkennen, was, Sein’ ist, wie könnte es dies sonst, setzen’? In Wahrheit aber setzt es sein Sein, indem es das Erkennen verwirklicht – denn dadurch tritt es ganz real, bewusst, in die Wirklichkeit![→] Anders formuliert:[→]
Nur dadurch, daß Fichte unbewußt darauf ausgeht, das Ich als „Seiendes“ nachzuweisen, kommt er zu seinem Resultate. Hätte er den Begriff des Erkennens entwickelt, so wäre er zu dem wahren Ausgangspunkte der Erkenntnistheorie gekommen: Das Ich setzt das Erkennen. Da Fichte sich nicht klarmachte, wodurch die Tätigkeit des Ich bestimmt wird, bezeichnete er einfach das Setzen des Seins als Charakter dieser Tätigkeit. Damit hatte er aber auch die absolute Tätigkeit des Ich beschränkt.
Und etwas später findet sich folgende Schlüsselpassage, durch deren zentrale Erkenntnis auch Fichte, sofort Hand und Fuß’ gewonnen hätte:[→]
Der Umstand, daß das Ich durch Freiheit sich in Tätigkeit versetzen kann, macht es ihm möglich, aus sich heraus durch Selbstbestimmung die Kategorie des Erkennens zu realisieren, während in der übrigen Welt die Kategorien sich durch objektive Notwendigkeit mit dem ihnen korrespondierenden Gegebenen verknüpft erweisen.
Überall wird durch das Denken, das Verhältnis der Teile des Weltinhaltes’ gefunden –, ob es nun das Verhältnis der Sonnenwärme zum erwärmten Stein oder des Ich zur Außenwelt ist’.[→] So erkennt der denkende Mensch also auch, dass es seine Bestimmung ist, das Wesen und den Zusammenhang aller Dinge zu erkennen – durch die freie Tat, das Erkenntnisvermögen zu realisieren ... das ebenso grundsätzlich mit der, Idee’ des Menschen verbunden ist, wie sein Wesen als moralisch Handelnder (das aber ebenfalls nur in Zusammenhang mit seinem Erkenntnisvermögen verwirklicht werden kann). Und wenn Steiner am Ende schreibt:[→]
Es gehört somit zum Berufe des Menschen, die Grundgesetze der Welt, die sonst zwar alles Dasein beherrschen, aber nie selbst zum Dasein kommen würden, in das Gebiet der erscheinenden Wirklichkeit zu versetzen. Das ist das Wesen des Wissens, daß sich in ihm der in der objektiven Realität nie aufzufindende Weltengrund darstellt. Unser Erkennen ist – bildlich gesprochen – ein stetiges Hineinleben in den Weltengrund.
– so bezieht sich dies auf beide Sphären: die Erkenntnis aller Welt um ihn herum und die Verwirklichung des frei und individuell erkannten Moralischen.
,Die Philosophie der Freiheit’ (GA 4)
Das zentrale Grundwerk Rudolf Steiner ist dann die, Die Philosophie der Freiheit’ (1893).6 Nach außen hin, nur’ philosophisch, ist es in Wirklichkeit ein Gedankenkunstwerk, das bereits in seiner ganzen Komposition grandios ist, diese Geheimnisse aber nur bei vertieftem Studium offenbart.7
Philosophisch aber lenkt Steiner auch hier den Leser auf die Verbindung zwischen dem sich als einzeln und getrennt wahrnehmenden Ich und der Welt. Dabei führt er hier ganz zentral auf das Bewusstwerden dessen, was eigentlich Denken ist, und das Bewusstwerden des eigenen Denkens hin – ganz konkret auf die Beobachtung des Denkens:[→,→]
Nur unterscheidet sich das Denken als Beobachtungsobjekt doch wesentlich von allen andern Dingen. [...] Während das Beobachten der Gegenstände und Vorgänge und das Denken darüber ganz alltägliche, mein fortlaufendes Leben ausfüllende Zustände sind, ist die Beobachtung des Denkens eine Art Ausnahmezustand. [...]
Die erste Beobachtung, die wir über das Denken machen, ist also die, daß es das unbeobachtete Element unseres gewöhnlichen Geisteslebens ist.
Wieder verweist Steiner darauf, das das Denken in sich völlig klar ist – und erst im Denken der Begriff von allem gefunden wird. Dies gilt sogar für die Begriffe, Subjekt’ und, Objekt’ selbst – das Denken steht aber noch jenseits von diesen, hat selbst mit ihnen noch gar nichts zu tun:[→]
Nun darf aber nicht übersehen werden, daß wir uns nur mit Hilfe des Denkens als Subjekt bestimmen und uns den Objekten entgegensetzen können. Deshalb darf das Denken niemals als eine bloß subjektive Tätigkeit aufgefaßt werden. Das Denken ist jenseits von Subjekt und Objekt. Es bildet diese beiden Begriffe ebenso wie alle anderen. Wenn wir als denkendes Subjekt also den Begriff auf ein Objekt beziehen, so dürfen wir diese Beziehung nicht als etwas bloß Subjektives auffassen. Nicht das Subjekt ist es, welches die Beziehung herbeiführt, sondern das Denken. Das Subjekt denkt nicht deshalb, weil es Subjekt ist; sondern es erscheint sich als ein Subjekt, weil es zu denken vermag. Die Tätigkeit, die der Mensch als denkendes Wesen ausübt, ist also keine bloß subjektive, sondern eine solche, die weder subjektiv noch objektiv ist, eine über diese beiden Begriffe hinausgehende. Ich darf niemals sagen, daß mein individuelles Subjekt denkt; dieses lebt vielmehr selbst von des Denkens Gnaden. Das Denken ist somit ein Element, das mich über mein Selbst hinausführt und mit den Objekten verbindet. Aber es trennt mich zugleich von ihnen, indem es mich ihnen als Subjekt gegenüberstellt.
Auch hier wieder stellt er sich der materialistischen Sinnesphysiologie entgegen:, Es ist richtig: für mich ist keine Wahrnehmung ohne das entsprechende Sinnesorgan gegeben. Aber ebensowenig ein Sinnesorgan ohne Wahrnehmung. [...] Ich kann meine Farbenwahrnehmung nicht dadurch vernichten, daß ich den Prozeß im Auge aufzeige, der sich während dieser Wahrnehmung darin abspielt. Ebensowenig finde ich in den Nerven- und Gehirnprozessen die Farbe wieder [...].’[→]
Worauf Steiner hinauswill, ist: Wenn der Materialist leugnet, dass die Wahrnehmung des Rot etwas Reales ist, und behauptet, dies seien nur Energiewellen, die von einem Nerven in die bloße, Vorstellung’ Rot verwandelt würden, so ist der, Nerv’ ja nicht realer, denn auch er wird – was der Materialist verdrängt – nur durch eine Wahrnehmung gefunden.
Dem naiven Bewusstsein, das die, wahrgenommene’ Welt für fertig hält und sich selbst nur für hinzukommend – aber das Gleiche trifft auch auf den Materialisten zu –, entgegnet Steiner:[→f]
[...] mit welchem Rechte erklärt ihr die Welt für fertig, ohne das Denken? Bringt nicht mit der gleichen Notwendigkeit die Welt das Denken im Kopfe des Menschen hervor, wie die Blüte an der Pflanze? [...] | Es ist ganz willkürlich, die Summe dessen, was wir von einem Dinge durch die bloße Wahrnehmung erfahren, für eine Totalität, für ein Ganzes zu halten, und dasjenige, was sich durch die denkende Betrachtung ergibt, als ein solches Hinzugekommenes, das mit der Sache selbst nichts zu tun habe.
Die volle Wirklichkeit strömt dem Menschen eben von zwei Seiten her zu: von, außen’ über die Wahrnehmung, von, innen’ über das Denken., Es hat mit der Natur der Dinge nichts zu tun, wie ich organisiert bin, sie zu erfassen.’[→]
Subjektive Persönlichkeit ist der Mensch durch sein einzelnes Empfinden und Wahrnehmen, während das Denken selbst und an sich etwas völlig anderes ist:[→]
Indem wir empfinden und fühlen (auch wahrnehmen), sind wir einzelne, indem wir denken, sind wir das all-eine Wesen, das alles durchdringt.8 Dies ist der tiefere Grund unserer Doppelnatur: Wir sehen in uns eine schlechthin absolute Kraft zum Dasein kommen, eine Kraft, die universell ist, aber wir lernen sie nicht bei ihrem Ausströmen aus dem Zentrum der Welt kennen, sondern in einem Punkte der Peripherie. Wäre das erstere der Fall, dann wüßten wir in dem Augenblicke, in dem wir zum Bewußtsein kommen, das ganze Welträtsel. Da wir aber in einem Punkte der Peripherie stehen und unser eigenes Dasein in bestimmte Grenzen eingeschlossen finden, müssen wir das außerhalb unseres eigenen Wesens gelegene Gebiet mit Hilfe des aus dem allgemeinen Weltensein in uns hereinragenden Denkens kennen lernen.
Während die Wahrnehmung Beobachtungen macht, findet das Denken durch Intuition den jeweiligen Begriff von allem. Die Begriffswelt hängt aber überall miteinander zusammen, sie ist ein Ganzes, ebenso wie in Wirklichkeit die Welt insgesamt:[→]
Ein von dem Weltganzen abgetrenntes Ding gibt es nicht. Alle Sonderung hat bloß subjektive Geltung für unsere Organisation. Für uns legt sich das Weltganze auseinander in: oben und unten, vor und nach, Ursache und Wirkung, Gegenstand und Vorstellung, Stoff und Kraft, Objekt und Subjekt usw. Was uns in der Beobachtung an Einzelheiten gegenübertritt, das verbindet sich durch die zusammenhängende, einheitliche Welt unserer Intuitionen Glied für Glied; und wir fügen durch das Denken alles wieder in eins zusammen, was wir durch das Wahrnehmen getrennt haben.
Das Erkennen könnte ein völlig, gleichgültiger’ Vorgang sein, während das Subjekt sich erst im Fühlen und Wollen wirklich erlebt – aber das Denken kann unendlich intensiviert werden, und das bedeutet, die Essenz von Fühlen und Wollen kann mitten im Denken eine wahre Auferstehung erleben. Dann lebt die volle Individualität in dieser Wesenheit des Denkens, Steiner macht dies in einem Zusatz zur Neuauflage 1918 deutlich:[→f]
Die Schwierigkeit, das Denken in seinem Wesen beobachtend zu erfassen, liegt darin, daß dieses Wesen der betrachtenden Seele nur allzu leicht schon entschlüpft ist, wenn diese es in die Richtung ihrer Aufmerksamkeit bringen will. Dann bleibt ihr nur das tote Abstrakte, die Leichname des lebendigen Denkens. |[...] Aber wer sich dazu bringt, das Leben im Denken wahrhaft zu haben, der gelangt zur Einsicht, daß dem inneren Reichtum und der in sich ruhenden, aber zugleich in sich bewegten Erfahrung innerhalb dieses Lebens das Weben in bloßen Gefühlen [...] nicht einmal verglichen werden kann [...]. [...] Das Wollen, das Fühlen, sie erwärmen die Menschenseele auch noch im Nacherleben ihres Ursprungszustandes. Das Denken läßt nur allzuleicht in diesem Nacherleben kalt; es scheint das Seelenleben auszutrocknen. Doch dies ist eben nur der stark sich geltend machende Schatten seiner lichtdurchwobenen, warm in die Welterscheinungen untertauchenden Wirklichkeit. Dieses Untertauchen geschieht mit einer in der Denkbetätigung selbst dahinfließenden Kraft, welche Kraft der Liebe in geistiger Art ist. [...] Wer nämlich zum wesenhaften Denken sich hinwendet, der findet in demselben sowohl Gefühl wie Willen, die letztern auch in den Tiefen ihrer Wirklichkeit [...].
Im neunten Kapitel, Die Idee der Freiheit’ formuliert Steiner dann ganz direkt das bewusste Sich-Erheben in das völlig eigenständige, auf sich selbst beruhende Reich des Geistigen, der Welt der Begriffe:[→f]
[...] kommt zu der Einsicht, daß das Denken als eine in sich beschlossene Wesenheit unmittelbar angeschaut werden kann. [...] Wer das Denken beobachtet, lebt während der Beobachtung unmittelbar in einem geistigen, sich selbst tragenden Wesensweben darinnen. [...] Im Betrachten des Denkens selbst fallen in eines zusammen, was sonst immer getrennt auftreten muß: Begriff und Wahrnehmung. [...] Wer aber durchschaut, was bezüglich des Denkens vorliegt, der wird [...] in demjenigen, das als Denken im Bewußtsein auftritt, nicht ein schattenhaftes Nachbild einer Wirklichkeit sehen, sondern eine auf sich ruhende geistige Wesenhaftigkeit. Und von dieser kann er sagen, daß sie ihm durch Intuition im Bewußtsein gegenwärtig wird. Intuition ist das im rein Geistigen verlaufende bewußte Erleben eines rein geistigen Inhaltes. Nur durch eine Intuition kann die Wesenheit des Denkens erfaßt werden.
Und nun konfrontiert Steiner den Materialismus, der das Denken nur auf Gehirnvorgänge zurückführen will, mit einer ganz umgekehrten Kausalität: Es ist das (all-eine) Geistige, das die Leibesorganisation so, zubereitet’, dass es zur Erscheinung kommen kann:[→]
Dem Wesenhaften, das im Denken wirkt, obliegt ein Doppeltes: Erstens drängt es die menschliche Organisation in deren eigener Tätigkeit zurück, und zweitens setzt es sich selbst an deren Stelle. Denn auch das erste, die Zurückdrängung der Leibesorganisation, ist Folge der Denktätigkeit. Und zwar desjenigen Teiles derselben, der das Erscheinen des Denkens vorbereitet.
Dann wendet sich der Gedankengang der Frage der Freiheit menschlicher Handlungen zu.
Steiner beschreibt die möglichen Stufen. Wo die Wahrnehmung unmittelbar ein Wollen impulsiert, ist der reine Trieb die Triebfeder der Handlung.[→] Auf der zweiten Stufe können Gefühle Triebfedern werden: Mitgefühl, Stolz, Dankbarkeit, Pflichtgefühl etc. Schließlich bestimmte Vorstellungen.[→] Die höchste Stufe jedoch ist ein reines, Denken ohne Rücksicht auf einen bestimmten Wahrnehmungsgehalt. Wir bestimmen den Inhalt eines Begriffes durch reine Intuition aus der ideellen Sphäre heraus.’[→] Eine gleiche Stufenfolge ergibt sich für die Motive, so die Vorstellung des eigenen oder auch fremden Wohls,[→] wobei aber selbst die Vorstellung vom, größten Wohl aller’ noch immer eine Vorstellung beinhaltet, wie dieses denn auszusehen habe.[→] Die höchste Stufe aber ist auch hier ein reines Denken, das in einer reinen Intuition ein Motiv fasst.[→]
Auf dieser höchsten Stufe also fallen Triebfeder und Motiv in einen Punkt zusammen – und weder eine bloße innere vorherbestimmte charakterologische Anlage noch ein äußeres normativ-sittliches Prinzip wirken mehr auf das Handeln.[→] Damit weist Steiner essenziell auf einen ethischen Individualismus, wie er auch selbst formuliert.[→]
Eine Handlung ist nur dann wirklich die eigene, wenn ich selbst sie liebe – und ich weder dem Zwang der Natur noch dem sittlicher Gebote unterliege.[→]
Die Menschen könnten unterschiedliche Intuitionen haben, aber die geistige Welt insgesamt ist eine Einheitliche. Deswegen kommt Steiner in einer wunderbaren Passage zu der Beschreibung einer Welt freier Geister, die sich niemals wahrhaft widersprechen können, sofern sie sich nur bis hin zu geistigen Intuitionen erheben:[→]
Der Unterschied zwischen mir und meinem Mitmenschen liegt durchaus nicht darin, daß wir in zwei ganz verschiedenen Geisteswelten leben, sondern daß er aus der uns gemeinsamen Ideenwelt andere Intuitionen empfängt als ich. Er will seine Intuitionen ausleben, ich die meinigen. Wenn wir beide wirklich aus der Idee schöpfen und keinen äußeren (physischen oder geistigen) Antrieben folgen, so können wir uns nur in dem gleichen Streben, in denselben Intentionen begegnen. Ein sittliches Mißverstehen, ein Aufeinanderprallen ist bei sittlich freien Menschen ausgeschlossen. Nur der sittlich Unfreie, der dem Naturtrieb oder einem angenommenen Pflichtgebot folgt, stößt den Nebenmenschen zurück, wenn er nicht dem gleichen Instinkt und dem gleichen Gebot folgt. Leben in der Liebe zum Handeln und Lebenlassen im Verständnisse des fremden Wollens ist die Grundmaxime der freien Menschen. Sie kennen kein anderes Sollen als dasjenige, mit dem sich ihr Wollen in intuitiven Einklang versetzt; wie sie in einem besonderen Falle wollen werden, das wird ihnen ihr Ideenvermögen sagen.
Läge nicht in der menschlichen Wesenheit der Urgrund zur Verträglichkeit, man würde sie ihr durch keine äußeren Gesetze einimpfen! Nur weil die menschlichen Individuen eines Geistes sind, können sie sich auch nebeneinander ausleben. Der Freie lebt in dem Vertrauen darauf, daß der andere Freie mit ihm einer geistigen Welt angehört und sich in seinen Intentionen mit ihm begegnen wird. Der Freie verlangt von seinen Mitmenschen keine Übereinstimmung, aber er erwartet sie, weil sie in der menschlichen Natur liegt.
Steiner leugnet nicht die Notwendigkeit von Gesetzen etc. – aber diese sind nur insofern notwendig, als der Mensch noch kein freies Wesen ist. Aber der Impuls, zu dieser Freiheit zu kommen, ist jedem Menschen eingeboren – es ist sein Wesen. Nur muss er dieses Wesen aktiv mit sich selbst in Übereinstimmung bringen – gerade darin liegt die einzigartige Freiheit des Menschen. Er allein ist etwas, was er noch nicht ist, sondern erst aus sich machen darf:[→f]
Aber mitten aus der Zwangsordnung heraus erheben sich die Menschen, die freien Geister, die sich selbst finden in dem Wust von Sitte, Gesetzeszwang, Religionsübung und so weiter. Frei sind sie, insofern sie nur sich folgen, unfrei, insofern sie sich unterwerfen. Wer von uns kann sagen, daß er in allen seinen Handlungen wirklich frei ist? Aber in jedem von uns wohnt eine tiefere Wesenheit, in der sich der freie Mensch ausspricht. [...]
Das ist ein Ideal, werden viele sagen. Ohne Zweifel, aber ein solches, das sich in unserer Wesenheit als reales Element an die Oberfläche arbeitet. [...] An dem Dinge der Außenwelt ist die Idee durch die Wahrnehmung bestimmt; wir haben das unserige getan. wenn wir den Zusammenhang von Idee und Wahrnehmung erkannt haben. Beim Menschen ist das nicht so. Die Summe seines Daseins ist nicht ohne ihn selbst bestimmt; sein wahrer Begriff als sittlicher Mensch (freier Geist) ist mit dem Wahrnehmungsbilde „Mensch“ nicht im voraus objektiv vereinigt, um bloß nachher durch die Erkenntnis festgestellt zu werden. Der Mensch muß selbsttätig seinen Begriff mit der Wahrnehmung Mensch vereinigen. Begriff und Wahrnehmung decken sich hier nur, wenn sie der Mensch selbst zur Deckung bringt. Er kann es aber nur, wenn er den Begriff des freien Geistes, das ist seinen eigenen Begriff gefunden hat.
Auch hier wieder zeigt sich die Doppelnatur des Menschen. Der Mensch überwindet die Spaltung zwischen Wahrnehmung und Begriff in Bezug auf die übrige Welt als Erkennender – und in Bezug auf sich selbst in der Verwirklichung des freien Geistes, das heißt, des aus Liebe Handelnden. Dieses Menschenbild ist das Bekenntnis Rudolf Steiners. Im nächsten Kapitel formuliert er noch einmal:[→]
Jeder von uns ist berufen zum freien Geiste, wie jeder Rosenkeim berufen ist, Rose zu werden.
Im zwölften Kapitel geht Steiner dann näher auf die moralische Intuition und ihre Verwirklichung ein. Der freie Geist fasst stets, einen schlechthin ersten
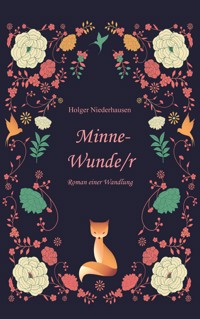
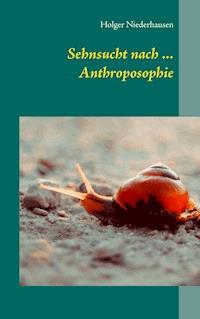

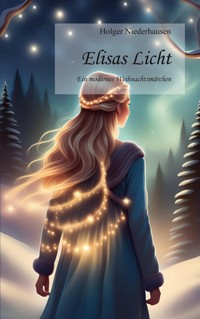
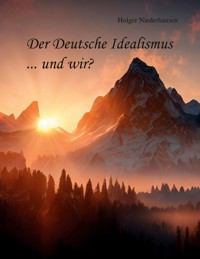
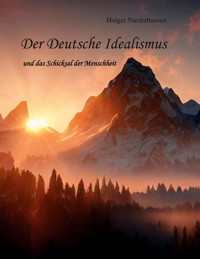
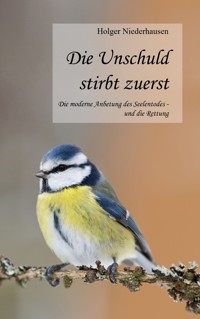


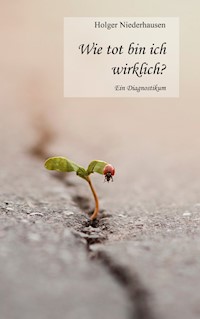

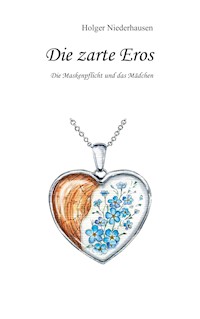



![Die [durchgestrichen: letzte] erste Unschuld - Holger Niederhausen - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/9d69c6320692c771bc65edda9a41b406/w200_u90.jpg)