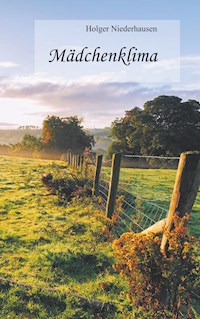
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die sechzehnjährige Marja beteiligt sich an den Freitagsdemonstrationen zur Rettung des Klimas, ihre tiefen Empfindungen machen sie aber auch einsam. Ihre Freundin Lucie sorgt für zusätzliche Verwicklungen. Dann stößt sie auf Videos, die den menschlichen Klimawandel herunterspielen, und sucht intensiv nach der Wahrheit. Und ein junger Mann, der sich in sie verliebt, eröffnet ihr tiefe Einsichten in die Frage, was eigentlich ein Mädchen ist ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Menschenwesen hat eine tiefe Sehnsucht nach dem Schönen, Wahren und Guten. Diese kann von vielem anderen verschüttet worden sein, aber sie ist da. Und seine andere Sehnsucht ist, auch die eigene Seele zu einer Trägerin dessen zu entwickeln, wonach sich das Menschenwesen so sehnt.
Diese zweifache Sehnsucht wollen meine Bücher berühren, wieder bewusst machen, und dazu beitragen, dass sie stark und lebendig werden kann. Was die Seele empfindet und wirklich erstrebt, das ist ihr Wesen. Der Mensch kann ihr Wesen in etwas unendlich Schönes verwandeln, wenn er beginnt, seiner tiefsten Sehnsucht wahrhaftig zu folgen...
Selig sind, die ein Mädchen lieben,
denn sie werden Gott schauen.
,Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut! Wir sind hier, wir sind laut...’
Der vielstimmige Chor der Schülerinnen und Schüler ergoss sich über den Platz der Abschlusskundgebung, der sich nahe des Regierungsviertels befand und von einer freundlichen Märzsonne überstrahlt war.
Sie rief die Worte mit. Sie war Teil des Ganzen – eine von vielen tausend Schülerinnen und Schülern, die heute hier waren, um gegen Verantwortungs- und Tatenlosigkeit ihre Stimme zu erheben. Jahrelang hatten auch sie geschlafen, so schien es. Man hatte es irgendwie gewusst, aber man hatte doch geschlafen. Man war ja auch noch so jung gewesen. Man hatte den Großen vertraut – den Erwachsenen, den Eltern, den Politikern.
Vieles war schlimm in der Welt, das wusste man auch irgendwann – und immer mehr. Aber irgendwie kümmern sich die Politiker auch darum – dachte man. Und man dachte es so lange, bis die Erkenntnis dämmerte, dass Politik vielleicht das Gegenteil bedeutete: sich nicht zu kümmern. Dinge auszusitzen, zu verschleiern, zu verharmlosen, winzigste Maßnahmen zu Großtaten auszuschmücken und in Wirklichkeit nichts zu tun. Und diese schmerzliche Erkenntnis war der eigentliche Abschied von der Kindheit. Genauso hatte sie es erlebt: die Großen tun nichts. Und: ich bin erwachsen. Ich bin kein Kind mehr. Noch nicht erwachsen, aber allein – alleingelassen mit allen Sorgen und Nöten der Zukunft, denn die Großen tun nichts. Sie tun einfach nichts.
Ein gnadenloses Gefühl des Allein-gelassen-Seins, des Verrats – Verrats der älteren Generation an der jüngeren. Und dann die Erkenntnis: an allen jüngeren. An allen, die noch nachkommen werden. Auch sie war nur die erste, Teil der ersten Generation, die verraten wurde. Es würde auch alle anderen noch betreffen.
Und dann der Berg: der Berg ungelöster Probleme. Wie aus dem Nebel trat er allmählich in den Blick. Der Nebel der Kindheit löste sich auf und sichtbar wurde: der Berg. Ein Himalaya aus Problemen. Man wusste nicht, wo man anfangen sollte. Man konnte nur aufzählen, was man sah – zu sehen begann, weil die Kindheit nicht mehr ihre schützende Blindheit über einen hüllte. Kriege. Kriegsähnliche Zustände. Tod. Elend. Armut. Ungerechtigkeit. Ungleichheit. Wachsende Ungleichheit und Ungerechtigkeit, selbst in den reichsten Ländern, selbst in Deutschland. Naturzerstörung. Artensterben. Rücksichtslose Überfischung der Meere. Abholzung der Regenwälder. Anderer Wälder. Rücksichtsloser Anbau. Zerstörung der Böden. Ausrottung der Wildpflanzen. Mit ihnen der Wildtiere. Die Bienen. Überall Gifte. Überall Technik. Überall Asphalt und Beton. Immer weniger Natur – und auch diese war immer weniger Natur. Man arbeitete an künstlicher Intelligenz, aber nicht an der Rettung des Planeten. Man arbeitete an Konsum, nicht an Bewahrung und Heilung. Nur immer mehr ,Fortschritt’. Effektivität. Mobilität. Modernität. Wofür? Man entriss der Erde das letzte Öl, die letzte Kohle – und verheizte sie in die Atmosphäre. Und hier nun begann eine Entwicklung, die planetarische Ausmaße erreichte – Ausmaße, die selbst menschliche Reparaturbemühungen lächerlich erscheinen ließen. Die Veränderung des Klimas. Die Aufheizung der Erde. Das Steigen der Meere. Die Zunahme von Dürren und Stürmen. Die Zugrunderichtung des Planeten bis in die Atmosphäre hinein. Und alles nur durch blinde Rücksichtslosigkeit und Gier – Gier selbst da noch, wo die Blindheit beendet wurde und die Menschheit sehend wurde. Jetzt. Hier. Heute.
,Wir sind hier, wir sind laut...’
Unvermittelt traten ihr die Tränen in die Augen, während sie weiter mit den anderen die einprägsamen, eindringlichen Worte rief – und mit ganzem Herzen spürte, warum sie hier war, wofür...
„Marja – was ist denn?“
Sie war mit ihrer Freundin Lucie hier.
Vor ihr schämte sie sich nicht – und sie hatte längst gelernt, sich ihrer Tränen überhaupt sehr selten zu schämen.
Sie schüttelte nur sanft den Kopf. Auch wenn das Herz sich seiner Tränen nicht schämte, wollte es sie nicht begründen müssen. Jedes andere Herz würde dann auch ohne Worte verstehen können...
Sie fühlte Lucies tröstende Hand auf ihrem Rücken und sandte ihr einen dankbaren Blick. Sie empfing den Blick ihrer Freundin, in dem nicht nur Mitgefühl lag, sondern auch dieses leise andere: dieses immerwährende Staunen, das ihr immer wieder den Unterschied fühlbar machte.
Sie wischte sich einmal über die Wangen und blickte schmerzlich weiter auf einige Köpfe weiter vorn in der Menge. Die Zipfelmütze eines kleinen Mädchens fiel ihr in den Blick. Sie wollte nicht bestaunt werden. Denn es bedeutete etwas ... woran sie auch nicht denken wollte.
Tapfer unterdrückte sie ihre Empfindungen. Die Tränen versiegten. Nicht aus Scham, sondern aus einem noch anderen, jetzt nicht in Worte zu fassenden Leid.
Noch einmal blickte sie kurz zu Lucie. Diese war erleichtert, dass es ihr wieder besser ging.
Tausend Gefühle im Herzen. Alles zusammen.
*
Nach der Abschlusskundgebung schlenderten sie nach Hause. Zuerst noch inmitten vieler anderer junger Menschen, dann irgendwann nur noch inmitten der üblichen Passanten auf den Straßen der Hauptstadt.
„Die Rede am Ende war toll. Diese Lena hat wirklich Power“, sagte Lucie.
„Ja...“
„Glaubst du, die Politiker kapieren bald, was los ist?“
„Was los ist?“
Sie war mit ihrer Seele irgendwie ganz woanders.
„Ja – denkst du, sie wachen auf?“
„Ich weiß nicht.“
„Woran denkst du denn, Marja?“
Sie seufzte innerlich. Lucie war immer so lieb...
„Ich weiß nicht, Lucie...“
Ihre Freundin lächelte verständnisvoll und ungläubig zugleich.
„Das musst du doch wissen. Du denkst doch immer so viel nach! An was denkst du denn gerade...“
Wieder atmete sie innerlich leise ratlos aus.
„An alles irgendwie.“
„An alles?“
„Ja.“
„Und was alles?“
„Das weißt du doch, Lucie...“
Lucie schwieg eine Weile. Natürlich wusste sie es. Sie war schließlich ihre Freundin. Aber es half auch nichts, keine Antworten zu haben, wenn man dann doch wieder gefragt wurde, denn jetzt war jetzt...
Es tat ihr auch leid, sie bei dieser Antwort gelassen zu haben, und auch das gehörte wieder dazu – auch das war ein weiteres dieser eintausend Gefühle, die sie hatte und die andere irgendwie nicht hatten. Und was sie auch wieder nicht verstand, und was auch wieder ein Gefühl mehr war. Sogar das Nichtverstehen war ein neues Gefühl. Kein neues. Ein schon immer gekanntes...
Sie ging noch einige Schritte und versuchte, den Anfang eines Fadens zu finden, den sie einfach nur aufzurollen brauchte. Ein Urtraum ihrer Seele: den roten Faden zu finden. Wissen, was man sagen konnte. Wissen, was man tun konnte. So sein wie die anderen. Einfach nur leben. Nicht ,einfach’, sondern eben lebendig. Nicht dauernd nachdenken, nicht so schweigsam zu sein, nicht so schwer – schwer für die Umwelt und sogar für einen selbst. Sie schämte sich nicht für ihre Tränen – aber sie schämte sich dafür, dass sie für andere, sogar ihre Freundin, so oft erklärungsbedürftig war. Sie fühlte sich schuldig, wenn ihre Freundin sich Sorgen machte. Sie wusste irgendwie, dass sie das nicht brauchte – und dann fühlte sie sich sogar deswegen schuldig: dass sie sich schuldig fühlte... Sie konnte den Strom ihrer Gedanken und Gefühle nicht abschalten. Aber sie wollte es auch nicht. Denn auch das spürte sie: dass sie dies war. Dass sie nicht Lucie war, nicht ihre anderen Schulkameradinnen, nicht ihre Eltern, nicht dieser da oder jener dort. Sie war sie – und sie war, wie sie war. Manchmal wollte sie anders sein. Aber mehr noch sehnte sie sich danach, dass die anderen anders wären. Denn dann würde man auch verstehen, wie sie war. Aber man verstand es nicht. Und nicht einmal Erklärungsversuche nützten etwas. Sie machten nur offenbar, dass man manches nicht erklären konnte. Aber einer Freundin müsste man alles erklären können. Diese Hoffnung hatte sie nie aufgegeben.
Aber sie fand den Beginn des Fadens nicht. Und so konnte sie wie immer nur irgendwo beginnen. Sie wusste, dass es nicht der Anfang war.
„Und du, Lucie? Was fühlst du?“
Lucie starrte sie einen winzigen Moment lang an. Dann lachte sie liebevoll los.
„Marja! Ich habe dich gefragt, was du denkst. Jetzt fragst du mich, was ich fühle? So, als ob ich dich das gefragt hätte?“
Noch einmal sah Lucie sie an.
„Ich glaube, du bestehst nur aus Gefühlen, oder, Marja?“
Es war warmherzig. Kein Vorwurf – Verständnis.
„Nein...“, sagte sie leidvoll. „Ich habe auch ebenso viele Gedanken.“
„Dann merkt man davon nicht so viel“, kommentierte Lucie liebevoll. „Gedanken kann man doch aussprechen. Gefühle eigentlich auch. Und vor allem weiß man doch, was man denkt. Und auch, was man fühlt. Eigentlich ist es doch die einfachste Frage der Welt: Was denkst du? Also ... ist es doch, oder nicht?“
„Ja ... vielleicht“, murmelte sie. „Aber für mich irgendwie nicht...“
„Ja – das meine ich“, erwiderte Lucie. „Warum nicht? Was ist denn so schwierig? Sind deine Gedanken so kompliziert?
Oder ... oder was genau ist es? Ich meine, ich kenne dich ja.
Ich kenne dich doch ganz gut. Ich weiß ja, dass es bei dir schwierig ist – ach du Scheiße, nein, ich meine, das hört sich völlig idiotisch an. Ich meine – du weißt, wie ich es meine.
Ich weiß, dass es bei dir ... anders ist. Aber warum? Ich meine ... muss es so sein? Und ... ist das nicht viel zu anstrengend?“
Solche Fragen waren wieder dieses Schmerzliche. Sie spürte, wie gut es ihre liebe Freundin meinte. Sie spürte, dass es ganz leicht sein müsste, eine Antwort zu geben, die alles erklären würde – aber sie wusste, dass sie diese Antwort nicht hatte.
Sie fühlte sich wie in einer Art Gefängnis.
„Nein, es ist nicht anstrengend...“, begann sie leidvoll. „Es tut nur weh, es nicht erklären zu können. Man würde es gerne – aber man kann es nicht. Wenn es so einfach wäre, wäre es ja schon geschehen. Und jeder würde einen verstehen. Aber es ist eben nicht zu verstehen – ich meine, nicht zu erklären. Ich meine, ich kann es nicht. Ich verstehe auch nicht, warum nur ich das habe. Und das“, sagte sie verzweifelt, „klingt auch wieder wie eine Krankheit. Ich will nur sagen: Ich verstehe auch nicht, warum ich so anders bin. Warum ihr nicht so seid. Du und alle anderen auch nicht.“
„Das kann ich dir gleich sagen“, antwortete Lucie. „Weil ich es anstrengend finden würde! Ich kann es mir nicht vorstellen. Nicht bei mir. Bei dir schon – du bist ja so. Und es passt zu dir. Aber ich könnte das nicht. Und es wäre anstrengend.
Ich meine – es ist doch anstrengend, oder nicht?“
„Nein... Ich habe doch gesagt, nein...“
„Aber das verstehe ich nicht! Wie kann das nicht anstrengend sein?“, fragte Lucie völlig ratlos.
„Was denn genau?“, fragte sie nun genauso ratlos. „So viele Gedanken zu haben?“
„Ja – und sich nicht ausdrücken zu können. Nicht sagen können, was man gerade denkt. Überhaupt nicht viel sagen. Aber wahrscheinlich umso mehr denken. Und es beschäftigt dich ja auch sehr. Du leidest doch darunter. Ist es nicht wie ein übergroßer Sack voller Gedanken und Gefühle und man findet den Ausgang nicht? Will man das nicht einmal alles loswerden? Willst du davon nie frei sein?“
Einen Moment lang staunte sie über eine Art große Klarheit. Dann stand sie wieder vor demselben Rätsel. Denn die Wahrheit war: Ja und nein. Auch dies war wiederum nicht so klar, wie alle immer dachten. Es war eben kein Sack. Es ging eben nicht um einen Ausgang. Es ging nicht um Frei-Sein oder Nicht-frei-Sein, es war etwas, was völlig anders lag. Schon die Frage war falsch, weil sie gar nicht zutraf – weder noch. Sie litt und litt nicht. Sie litt darunter, dass die anderen nicht litten. Das, woran sie litt oder was dieses sogenannte Leiden war, war nicht die Krankheit. Sie war nicht das Problem. Und Lucie war auch nicht das Problem. Aber die Lösung war sie auch nicht.
„Es geht nicht darum, frei zu sein, Lucie.“
„Nicht? Worum geht es denn dann?“
Das waren die Fangfragen. Nicht böse gemeint von ihrer lieben Freundin. Sie meinte nie etwas böse – nicht zu ihr. Aber die Fangfrage fing sie in ihrer eigenen Antwortlosigkeit. Sie konnte nicht begründen, was ... wahrscheinlich auch niemand anders begründen konnte, weil man etwas entweder selber einsah oder nicht einsah. Man konnte nicht begründen, warum ein Sonnenuntergang schön war. Es war nicht zu begründen.
„Wenn du jemanden liebst, Lucie, aber wenn er dich verlassen hat ... würdest du dann den ,Sack’ voller Gefühle und Gedanken auch schnell wieder loswerden wollen?“
Sie wusste nicht einmal genau, ob der Vergleich nun ein guter war, aber Lucie verstummte erstaunt, um kurz zu überlegen.
„Jaa... Schon...“, sagte sie etwas gedehnt, noch im Überlegen, aber schon mitten in der Antwort. „Ich würde jedenfalls nicht künstlich lange leiden. Ich würde mein Leben fortsetzen. Ich würde, wenn mich jemand verlassen hat, den Typen wahrscheinlich schnell wieder vergessen.“
Sie war doch etwas bestürzt, obwohl sie Lucie auch kannte.
„Schnell wieder vergessen – oder schnell wieder vergessen wollen?“
„Vergessen wollen. Und deswegen auch vergessen.“
„Also ganz einfach?“
„Weiß ich nicht. Aber eben auch nicht besonders kompliziert.
Es wäre, wie es ist. Aber ich würde kein Problem daraus machen. Ich bin lieber Teil der Lösung. Also weiterleben. Neue Richtung einschlagen. Ein neuer Freund – oder eben auch mal keiner.“
„Ist das so einfach?“
„Ich denke, es ist so einfach, wie man es sich macht.“
„Es ist also mach-bar?“
„Na klar ist es machbar. Man macht es sich doch auch schwer.
Das macht man doch auch selbst?“
„Das finde ich nicht.“
„Doch. Auf jeden Fall könnte man es leichter nehmen. Das könnte man auf jeden Fall tun.“
„Aber vielleicht will man es gar nicht.“
„Ja – siehst du? Das meine ich! Vielleicht will man es gar nicht. Dann will man es nicht – also will man es schwerer.
Aber dann macht man es sich doch selbst schwer, oder nicht?“
„Ja, wenn du es so siehst...“
„Wie siehst du es denn?“
Sie dachte darüber nach.
„Ich weiß nicht. Ja ... was soll ich denn sagen? Wenn du es so siehst... Schwerer... Was heißt denn das? Ich weiß nicht, was ,schwerer’ heißt. Ich will nicht, wenn ich jemanden geliebt habe, ihn vergessen, bloß weil er mich vergessen oder eben verlassen hat...“
Lucie stutzte.
„Aber – du musst doch nicht darunter leiden!“
„Ja, ich muss nicht.“
„Aber – du willst?“
„Ja, vielleicht will ich...“
„Aber warum?“
Wieder dachte sie nach.
„Vielleicht, weil ich meine Liebe nicht einfach so wegwerfen will.“
„Was heißt denn wegwerfen? Du hast doch bis dahin geliebt?
Reicht das nicht? Wenn er dich verlassen hat, nützt doch deine Liebe gar nichts mehr. Sie quält dich doch nur. Und solange du den blöden Typen noch liebst, der dich verlassen hat, kannst du auch niemand anderen lieben. Das heißt also, du lebst nur noch in der Vergangenheit. Nein – das möchte ich nicht.“
Sie schwieg.
„Würdest du dann nicht nach vorne gucken?“, beharrte Lucie.
,Vor einem wäre dann noch immer der Schmerz, aber auch noch immer die Liebe’, dachte sie.
„Ich könnte meine Gefühle nicht einfach abschneiden“, sagte sie – in dem leidvollen Wissen, dass ihre Freundin bereits eine Gegenantwort hätte.
„Ja, aber wenn sie dich quälen.“
„Aber es sind meine, Lucie!“
Lucie sah sie von der Seite an.
„Ja...“, sagte sie warm und versöhnlich. „Ich will dir doch nur – – Ich will doch nur ... Marja...“
„Ich weiß doch, Lucie...“
Sie sah ihre Freundin voller Zuneigung an.
„Gibst du mir deine Hand?“
Lucie tat es bereitwillig, und als sie die warme Berührung der Freundin spürte, war ihr viel wohler. Niemand an ihrer Schule ging so Hand in Hand, aber Lucie hatte sich daran gewöhnt und fand es auch schön. Sie selbst aber konnte auch dies nicht verstehen: wieso man das nicht tat. Manchmal hatte sie schon gedacht, sie sei lesbisch, aber das war es sicher nicht. Es war auch hier nur das, was die anderen nicht hatten...
Mit diesem zärtlichen, intimen Kontakt fiel ihr auch das weitere Sprechen viel leichter. Nicht, dass man mehr vertraute. Das tat sie sowieso. Aber der Kontakt ... der Kontakt ermöglichte mehr Verständnis. Der Andere würde einen mehr verstehen, das spürte sie. Das Verständnis ging durch das Herz, also ging es auch durch die Hände...
„Du brauchst mir nicht helfen, Lucie...“, begann sie dankbar. „Ich bin schon glücklich, dass du meine Freundin bist. – –
Ich will meine Gefühle gar nicht verlieren. Wenn ich jemanden geliebt habe, habe ich jemanden geliebt. Das ist unabänderlich. Wenn er mich verlässt, wird es mir wehtun. Aber das bin immer noch ich. Ich werde meine Gefühle nicht aktiv abschneiden, nur weil er mich verlassen hat. Ich habe ihn geliebt und werde ihn sicher noch immer lieben. Und gerade deshalb, wegen beidem, wird es mir wehtun, und ich werde ihn vermissen. Aber warum sollte ich dieses Gefühl abschneiden? Weil es nicht mehr erreichbar ist? Oder weil es enttäuscht wurde? Aber es ist doch deswegen nicht weniger wahr. Ich liebe ihn doch, auch wenn er mich verlässt. Sonst würde es doch nicht so wehtun. Kannst du ... sind es ... sind es denn noch ehrliche Gefühle, wenn man sie einfach so abschneiden kann? An- und abschalten? Oder zumindest abschalten? Wie ... wie ehrlich liebt man denn dann den nächsten...?“
„Genauso ehrlich, warum denn nicht?“, erwiderte Lucie.
„Wenn wieder jemand da ist, den man lieben kann, liebt man ihn – aber wenn man noch immer unter der vergangenen Liebe leiden würde, würde man ihn nicht lieben können. Vielleicht nicht einmal sehen. Man hätte keine Augen dafür, obwohl das Leben längst etwas Neues gebracht haben könnte. Vielleicht extra für dich...“
„Ja, vielleicht...“, ließ sie sich auf diesen Gedanken ein.
„Aber dann muss das Leben eben Geduld mit mir haben...“
„Es gibt Gelegenheiten, und die kommen und gehen auch wieder.“
„Ja, dann gehen sie eben wieder. Wenn ich noch nicht so weit bin, kann ich nichts dafür...“
„Marja, du bist romantisch, und du leidest lieber.“
„Nein, ich liebe lieber.“
„Nein, tust du nicht. Denn du leidest noch immer unter der vergangenen Liebe und siehst die mögliche neue nicht.“
„Aber, verstehst du, die vergangene Liebe ist noch gar nicht vergangen. Nicht für mich...“
„Ja, aber sie besteht nur noch in deiner Vorstellung.“
„Nein, sie besteht noch in meinem Herzen. Nicht mehr in seinem, aber in meinem noch immer.“
„Aber was nützt das?“, fragte Lucie völlig ratlos.
„Weißt du“, sagte sie, „ich glaube, Liebe muss nicht immer glücklich sein. Es reicht ihr, überhaupt da zu sein – als Liebe...“
„Aber wäre es nicht schöner – glücklich?“
„Nein. Es ist schöner, seine Gefühle nicht abschneiden zu müssen, um möglichst schnell wieder glücklich zu sein. Das ist wie im Supermarkt. Gerät kaputt – umtauschen – schnell wieder glücklich sein. Liebe kann man nicht einfach umtauschen. Wenn einen jemand unglücklich gemacht hat, dann ist das so. Die Liebe kann das nicht ändern. Aber sie schafft sich deswegen nicht ab. Sie ist treuer als der andere.“
„Na, das nützt einem ja viel!“
„Ich weiß, dass du das nicht verstehst.“
„Du bist also lieber treu, als mit einem anderen Jungen glücklich zu werden, der dich vielleicht wirklich liebt? Du bist einem Idioten treu, um an dem wirklichen Glück vorbeizugehen?"
„Ich möchte nur sagen, dass für mich die Gefühle kein Supermarkt sind. Ich kann und ich möchte auch gar nicht meine Gefühle steuern. Wenn ich jemanden geliebt habe, höre ich damit nicht auf, bloß weil er mich verlassen hat. Wie soll das gehen? Danach kommt das Leid darüber. Wieso ist das so schwer zu verstehen? Ist es ... ist es so modern, das auszulassen? Dann ... dürfte man doch auch nicht trauern, wenn jemand gestorben ist. Es könnte einen ja vom Glück abhalten...“
Lucie überlegte ein wenig.
„Der Gestorbene hat einen ja nicht verlassen – ich meine, er wollte es ja nicht. Er hat einen nicht im Stich gelassen. Er ist nicht das, was ich vorhin einen ,Idioten’ nannte.“
„Du kannst niemanden ,Idiot’ nennen, der dich einmal geliebt hat.“
„Vielleicht hat er mich ja nie wirklich geliebt, wenn er mich verlässt.“
„Du weißt nicht, warum er dich verlässt.“
„Na, weil er eine Neue hat, natürlich.“
„Aber das heißt noch immer nicht, dass er dich nicht geliebt hat.“
„Mann, Marja, du bist so geduldig – mit dir kann man alles machen!“
„Aber mit meiner Liebe eben gerade nicht. Sie ist nicht abhängig davon, ob ich verlassen werde oder nicht. Sie liebt selbstständig. Sie richtet sich nicht danach, was der andere tut. Sie leidet, aber sie schaltet sich nicht selbst ab, nur weil der andere seine Liebe abgeschaltet hat. Sie ist kein Nachmacher. Sie ist keine bloße Kopie. Sie ist echt.“
„Sie ist echt...“, murmelte Lucie noch einmal.
Sie gingen eine Weile schweigend, während eine Straßenbahn an ihnen vorüber fuhr.
„Und ... irgendwann hört sie dann auf?“, fragte Lucie nun weiter.
„Ja, wahrscheinlich.“
„Und wann?“
„Lucie! Wie soll ich das wissen? Ich war noch nicht in der Situation. Ich hab noch gar keinen Freund!“
„Ja, gut“, lenkte diese ein. „Du hast Recht. Aber willst du denn einen Freund? Du weißt, es stehen genügend Jungen in den Startlöchern...“
„Hör auf, Lucie. Ich mag es nicht, wenn du so davon redest.
Du weißt, dass ich ... schon auch einen Freund haben wollen würde. Gern sogar... Aber die Jungen aus unserer Klasse, an die du denkst, sind es alle nicht. Das weißt du doch bestimmt auch.“
„Na ja, Mehmet ist schon ganz nett, oder?“
„Mehmet!? Du weißt ganz genau, dass ich dieses Coole nicht mag!“
„Er ist gar nicht so cool. Weniger als die anderen! Und er hat sich in letzter Zeit sehr geändert.“
„Das mag sein. Er ist es trotzdem nicht. Niemals.“
„Und was schwebt dir vor?“
„Wie?“ „Ach, Marja, du bist so süß... Was schwebt dir denn vor?
Was ist denn dein Typ? Was für einen Jungen suchst du denn nun?“
„Das weißt du doch auch. Einen, der mich wirklich verstehen würde. Aber wenn du es schon so schwer hast, wird wohl nur einer von tausend Jungen auch nur theoretisch in Frage kommen. Vielleicht gibt es nur einen einzigen irgendwo auf der Welt...“
„Ach, Marja, das ist doch auch wieder nur so eine blöde, kitschige, falsche Hollywood-Vorstellung. Auch wieder so eine, die dir das Glück gerade nimmt, weil du es nie findest, wenn du an so einen Blödsinn glaubst!“
„Es geht nicht um Vorstellung. Es geht um Tatsachen. Ich will mir gerade nicht fortwährend vorstellen, dass mich irgendein beliebiger Junge verstehen würde, um dann festzustellen, dass er es natürlich nicht tut!“
„Warum sollte er es nicht tun?“
„Weil er garantiert nicht begabter ist als du!“
„Oh, danke...“
„Ich meine es ernst, Lucie. Warum sollte ein Junge mich verstehen?“
„Weil er dich vielleicht liebt?“
„Das reicht nicht.“
„Was reicht denn dann?“
„Lucie, du weißt es doch ganz genau. Um sich zu verstehen, muss man sich Mühe geben. Man muss ... man muss sich Mühe geben. Du weißt doch, was Mühe geben heißt?“
„Denkst du, ein Junge kann sich keine Mühe geben?“
„Du kennst mich doch. Denkst du, irgendein Junge würde sich diese Mühe geben?“
Lucie sah sie kurz an.
„Ich denke, wenn er dich liebt, ja – würde er.“
Sie verstummte.
Sie ging der Reihe nach die Jungen durch, von denen sie irgendwie glaubte, sie würden vielleicht, wie Lucie es sagte, ,in den Startlöchern stehen’. Sie schüttelte innerlich den Kopf. Nein, in ihrer Klasse war überhaupt kein Junge ernst genug. Sie würden alle irgendwie zu Lucie passen, aber nicht zu ihr.
„Es liebt mich kein Junge so, Lucie.“
„Aber du lässt ja auch keinen an dich heran, Marja.“
„Was soll denn das heißen? Ich will ja auch gar keinen von ihnen als Freund.“
„Vielleicht würden sie sich völlig verwandeln, wenn du sie erst einmal ließest.“
„Was heißt ,erst einmal ließest’?“
„Ich meine, dass manche von diesen Jungs noch ganz anders sein können, wenn man sich mit ihnen mal länger unterhält.
Was man so sieht, täuscht auch oft ein bisschen. Oder sogar sehr.“
„Zum Beispiel?“
„Zum Beispiel Sam. Man denkt immer, er ist der völlige Draufgänger. War er früher auch. Aber jetzt liest er Tolstoi!
Hätte ich nie gedacht! Bis er es vor zwei Wochen oder so erwähnte.“
Lucie hatte mit vielen Jungen Kontakte, ohne dass einer von ihnen ihr Freund im engeren Sinne wäre. Lucie hatte eine absolute Gabe für Freundschaften im weiteren Sinne. Auch mit Mädchen.
„Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe längst gesehen, dass Sam sich sehr verändert.“
„Wirklich?“
„Ja.“
„Na gut, du hast gute Augen.“
„Aber das weißt du doch.“
„Na ja – also dann siehst du auch, dass diese Jungs auch anders sind, als sie oft tun.“
„Ja, aber nicht so anders, wie für mich ein Freund sein müsste.“
„Und dann sag es mir noch mal.“
„Ein bisschen so wie ich.“
„Was?“, lachte Lucie. „Ich dachte, jetzt kommt eine halbe Stunde eine Beschreibung von Eigenschaften, ,verständnisvoll’ und so weiter.“
„Ja, das habe ich mir erspart. Es ist zu schwierig. Außerdem stimmt es. Du weißt, wie ich bin, also brauche ich es nicht zu beschreiben. Keiner der Jungs aus unserer Klasse ist so wie ich, nicht mal ein bisschen. Und ein bisschen würde schon reichen, da bin ich sicher. Ein bisschen so wie ich. Anders geht es nicht. Deine Freunde sind ja auch ein bisschen so wie du. Du hast keine Probleme...“
„Und du? Wärst du denn dann auch ein bisschen so wie dein Freund?“
„Wenn er ein bisschen so wäre wie ich, ist das anzunehmen, Lucie!“
„Okay, du hast gewonnen. Hmm... Und wir? Wo bin ich so wie du – oder umgekehrt? Wieso sind wir befreundet?“
„Wir sind beide Mädchen. Du bist so unglaublich lieb. Du verstehst mich mehr als jeder andere. Wenn mich eine verstehen kann, dann du. Ich verstehe die Frage nicht. Man muss nicht so sein wie der andere. Man muss sich nur liebhaben. Das reicht immer!“
„Aber du hast doch gerade gesagt, bei einem Jungen reicht das nicht.“
„Jungen haben normalerweise nicht so lieb wie Mädchen.“
„Wie denn dann?“
„Sie ... sie wollen was von einem ... und verstehen einen trotzdem nicht.“
„Du meinst ... Sex und so?“
„Ja, anscheinend.“
„Ja, möglich.“
Lucie dachte nach.
„Aber Jan zum Beispiel ist anders. Viel intelligenter, viel reifer irgendwie. Er würde dich bestimmt am ehesten verstehen können.“
„Ja, aber er interessiert sich nicht für mich.“
„Aber du könntest dich doch für ihn interessieren...“
„Lucie! Ich brauche gar keinen Freund. Ich meine – ich brauche keine Heiratsvermittlerin oder so etwas. Ich möchte Jan nicht als Freund.“
„Und warum nicht? Nur interessehalber.“
„Weil ... weil er mir auch wieder zu intelligent ist. Ich meine zu eingebildet. Irgendwie. Nicht stark, aber ein bisschen. Du weißt bestimmt, was ich meine.“
„Ja, ich glaub schon. Na gut, keine Heiratsvermittlung.“
„Nein, wirklich nicht. Bitte. In unserer Klasse oder Schule kommt niemand in Frage. Ich kenne keinen. Und du brauchst auch nicht weiter herumschauen. Es ist nicht dringend. Und es würde auch gar nichts nützen. Ich nehme nicht den ersten Besten, bloß um jemanden zu haben. Das wäre glaube ich der allerfalscheste Ansatz.“
„Ich meine ja nur, du könntest auch einmal ein paar Kontakte knüpfen. Marja... Wirklich nur, um ... um ein bisschen mehr zu leben. Weißt du, ich ... ich will doch nur...“
Die Wärme von Lucies Worten durchströmte wie eine Riesenwoge ihr Inneres. Sie spürte den unendlich guten Willen ihrer Freundin bis auf den Grund – und dies alles rührte sie so sehr...
Sie drückte ihre Hand.
„Ich weiß, was du meinst, Lucie. Aber mach dir keine Sorgen. Ich lebe schon. Ich bin auch glücklich. Ich bin eigentlich in jedem Moment auch glücklich. Das kommt dir vielleicht nicht so vor. Aber es ist so. Inmitten von allem ist es so. Und ich mag jeden Einzelnen aus unserer Klasse – auch wenn ich selbst zu ihm keinen Kontakt habe. Lass mal Mehmet und Jan und all die anderen als Freunde von mir aus dem Spiel. Ich mag sie so, wie sie sind. Ich fühle mich nicht einsam. Erst recht nicht, wenn du dabei bist – irgendwo mittendrin...“
Lucie drückte sanft zurück.
„Du bist schon seltsam, Marja... Wie so ein ganz eigener Planet... Eine Sonne, die einfach so vor sich hinleuchtet...“
*
Als sie sich voneinander verabschiedet hatten, weil Lucie noch andere Verabredungen hatte und sie nie von sich aus auf irgendetwas beharrte, war sie wieder auf sich allein gestellt. Sie ging nach Hause, übte etwas Klavier, vertraute ihre heutigen Erlebnisse und Empfindungen ihrem Tagebuch an und sann dann auf dem Bett liegend weiter über vieles nach.
Sie war froh, dass ihre Eltern noch nicht zu Hause waren. Auch das war seit einigen Jahren ein Problem. Sie hatte immer gedacht, ,anthroposophische’ Eltern wären Vorbildpaare. Irgendwann einmal hatte sie aufgeschnappt, dass fast die Hälfte der Eltern aus ihrer Klasse – sie besuchte jetzt die elfte – inzwischen getrennt lebten oder geschieden waren. Nun konnte bei einer bloßen Waldorfschule von anthroposophischen Eltern natürlich keineswegs die Rede sein. Aber ihre gehörten mit zu den schlimmsten, in der Hinsicht. Sie hielten sich nicht nur für anthroposophisch, sondern stritten sich fast jeden Tag. Warum waren sie eigentlich noch nicht getrennt? Sie hatten doch beide längst neue Partner. Wer zuerst wen gehabt hat, wusste sie bis heute nicht. Sie wusste nur, dass ihr Vater eine fünf Jahre jüngere Freundin hatte und ihre Mutter einen drei Jahre jüngeren Freund.
Ihre Mutter war das dominante Element ihrer Familie. Sie war als Jugendliche irgendwie mit ihren Eltern aus Russland gekommen, hatte dann im Studium ihren Vater kennengelernt. Ihr Vater war Architekt in irgendeinem größeren Büro, hatte viel zu tun. Ihre Mutter hatte den Beruf aufgegeben, als sie geboren wurde. Danach kam noch ein zwei Jahre jüngerer Bruder, Marco, der längst nur noch am Handy oder PC hing, und vor vier Jahren noch ein kleines Schwesterchen, Tamara, das sie total liebte. Aber kurz nach ihrer Geburt hatten die Streitereien begonnen. Sie hatte fast den Eindruck, als wäre das Baby eine Art Versuch gewesen, die Ehe zu retten, und hätte es nicht geschafft. Ihre Eltern waren noch immer zusammen, aber man merkte nicht mehr viel davon. Und am unangenehmsten war ihre Mutter – ihr russisches Naturell ließ sie überall das Haar in der Suppe finden. Niemand konnte es ihr recht machen – und ihr Mann schon gar nicht.
Aber was hieß ,ihr russisches Naturell’? Sie hatte daraus das Schlechteste gemacht, war herrisch und gehässig geworden, nicht immer und nicht durchgehend, und man sah auch, wie sie selbst unter allem litt – aber das Endergebnis war furchtbar. Hätte das russische Naturell nicht auch unendlich anders zur Erscheinung kommen können? Sagte man den Russen nicht nach, sie seien unendlich duldsam? Sagte Rudolf Steiner nicht sogar, sie seien das künftige Christusvolk? Auch das hatte sie irgendwo einmal aufgeschnappt, vielleicht sogar von ihren eigenen Eltern. Nun – hier war davon nur das Gegenbild vorhanden. Aber in Russland selbst vielleicht auch inzwischen nur noch...
Und sie selbst? Hatte sie nicht auch russisches Naturell? Jedenfalls spürte sie geheimnisvolle Wurzeln dort, in diesem fernen Osten. Vielleicht auch nicht nur Wurzeln, vielleicht auch eine ebenso geheimnisvolle Sehnsucht – nach diesem Christusvolk, das nicht mehr da war. Aber nicht nur das. Auch nach der russischen Erde. Sie hatte einmal eine Stelle gelesen – war es bei Bunin? –, wo diese Erde beschrieben wurde, im Frühling, bevor die Bäume sich wieder mit jungem Grün belauben, wie sie daliegt, die Erde, schwarz, nackt, glänzend, aber beseelt, von einer tiefen Auferstehungskraft beseelt, die zumindest der russische Mensch unmittelbar empfand – so, wie Bunin, wenn er es gewesen war, der dieses Erlebnis in jener kurzen Erzählung so besungen hatte. Gewiss war er nicht der Einzige, und gewiss war dies nicht die einzige Stelle gewesen. Die russische Erde... Dieses ganz Besondere, auch dieses innige Verhältnis des russischen Menschen zur Erde. Liebe...
Und dann der Gottesglaube selbst. In wenigen Wochen war Ostern. Sie dachte an die russischen orthodoxen Gottesdienste, die sie überhaupt nicht kannte, nur vom Hörensagen, nur von leisen Ahnungen – und die sie ebenfalls anzogen, ohne dass sie je den Mut gehabt hätte, einen solchen zu besuchen, vielleicht sogar nur aus der leisen, aber bestimmten Angst heraus, in ihren idealistischen Vorstellungen enttäuscht zu werden. Weil das Ideal vielleicht längst auch nicht mehr lebte, auch untergegangen war, zusammen mit dem Christusvolk...
Aber das alles lebte in ihr – als ein reines Ideal, etwas nicht einmal wirklich Fassbares, aber Fühlbares, Ahnbares, etwas wie nur Geträumtes. Russland. Erde. Gottesdienst. Christusvolk... Einfach so. Einmal irgendwo aufgeschnappt, vielleicht bei ein paar Gelegenheiten. Mosaiksteinchen. Zusammengefügt, wie von selbst. Wie so etwas kam... Oder war das alles in ihr, immer gewesen...? Jetzt jedenfalls war es in ihr...
Und dann kam diese Sache mit dem Klimawandel. Greta Thunberg in Schweden. Ein einziges Mädchen. Mutig wie Tausende. Die einfach tat, was sie tun musste – weil es das einzig Richtige war.
Nicht mehr nur die Erde wurde geschändet, die heilige Erde, deren Heiligkeit man in Russland einmal gespürt hatte, aber sicher auch hier in Deutschland, überall in Europa, als Bauer, der noch an Gott geglaubt hat ... sondern nun wurde sogar der Himmel geschändet. Die Atmosphäre war schließlich bereits Himmel – der Himmel der Erde. Anstatt der schwarzen Erde treu zu sein, rissen sie sie auf, entrissen ihr das, was sie ,schwarzes Gold’ nannten, Kohle, Öl, und verbrannten das, um zu fahren, zu fliegen, überall hin, milliardenfach, und veränderten die Atmosphäre – wie auch mit der milliardenfachen Viehzucht, gemordete Bäume, gemordete Tiere, für den kannibalischen Fleischhunger, und wiederum mit genau diesen Taten einhergehend die Entheiligung der Atmosphäre, ihres heiligen Gleichgewichtes.
Es war ein Wahnsinn, der über das Begreifen hinausging. Man musste es sich wirklich vorstellen. Langsam, eindringlich, in seiner schrecklichen Sinnlosigkeit, in seiner realen Öde und dem realen Grauen. Und wenn man wirklich bis zu der Realität durchdrang, dann kamen auch die Tränen. Dann kamen sie jedes Mal...
Als sie alle Tränen geweint hatte, trocknete sie ihre noch warme Spur auf ihren Wangen mit bloßer Hand. Wer weinte um die Erde? Wer? Weinten die Engel im Himmel? Sicher...
Tamara weinte oft, wenn ihre Eltern sich stritten. Dann tröstete sie sie, wann immer sie da war. Welche Erde würde Tamara vorfinden, wenn sie groß wäre...?
„Habt ihr schon gehört?“, verkündete Tom. „Die Eltern können die Freitags-Demos nicht mehr entschuldigen. Die Schulbehörde hat alle Schulen angewiesen, die Tage als Fehltage ins Zeugnis zu bringen.“
„Ist doch egal – wen interessieren schon Fehltage“, erwiderte Simone.
„Ich sag’s ja nur.“
„Die Behörde!“, sagte Lucie verachtend. „Das Klima interessiert die Behörde einen Scheißdreck. Hauptsache auf dem Zeugnis sind die Fehltage vermerkt!“
„Eine Behörde kann nicht anders“, sagte Sam.
„Eine Behörde sind auch nur Menschen“, widersprach Lucie scharf.
„Es sind Funktionsträger“, korrigierte Sam. „Bürokraten. Bürohengste. Pflichterfüller. Aktenträger. Das Menschsein spielt da keine Rolle mehr. Genauso wenig, wie wenn eine Kassiererin ein paar Cent Pfandgeld ,unterschlagen’ hat.“
„Deswegen hasse ich Deutschland“, erwiderte Lucie.
„Bürokratie gibt es überall.“
„Dann muss man sie eben wieder abschaffen.“
„Das ist eine Einbahnstraße. Einmal Bürokratie, immer Bürokratie. Sie schafft sich höchstens noch mehr Räume. Man nennt das auch Wasserkopf. Bürokratie kann immer nur wachsen.“
„Passt doch zum System“, erwiderte nun Tina.
„Ihr redet, als ob sich nichts ändern ließe“, sagte Lucie.
„Nicht mal eben so. Aber vielleicht, wenn wir jahrelang demonstrieren“, schaltete sich Frank ein.
„Auf den Bewerbungszeugnissen kann man sich Fehlzeiten aber nicht leisten“, sagte Alma.
„Alma will sich schon jetzt brav bewerben“, säuselte Tim.
„Hör doch auf mit dem Blödsinn!“, sagte Lucie. „Das wollen die doch nur. Merkt ihr das nicht? Die wollen Druck machen – bis der Druck so groß wird, dass wir nicht mehr demonstrieren!“
„Fehltage sind doch kein Druck – sie sind einfach die Wahrheit“, sagte Lars.
„Du demonstrierst eh nur mit, weil du dann nicht in die Schule musst!“
„Richtig“, grinste Lars.
„Interessiert dich das Klima überhaupt nicht?“
„Nö. Hier in Deutschland wird’s schon nicht so schlimm werden.“
„Ach, und deine Kinder?“
„Welche Kinder?“
„Lass mal, Lucie, bei dem hat’s eh keinen Sinn.“
„Aber Fakt ist, dass es Fehlzeiten sind. Wir denken, nur denen tut es weh, wenn wir in der Schulzeit demonstrieren.
Aber die können uns auch wehtun. Wir haben noch Glück, dass wir an ’ner Waldorfschule sind. An ’ner Staatsschule können sie ganz schnell mit ’nem Verweis kommen. Oder auch mit der Polizei.“
„Dann gibt es mit Sicherheit einen Aufstand. Ich mein’, echte Aufstände.“

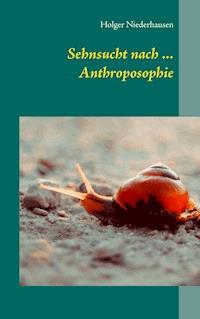

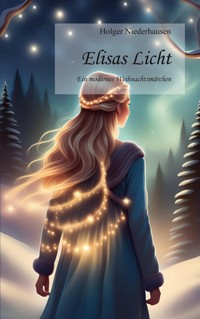
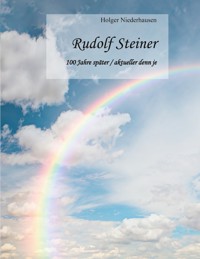







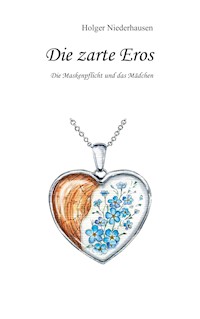



![Die [durchgestrichen: letzte] erste Unschuld - Holger Niederhausen - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/9d69c6320692c771bc65edda9a41b406/w200_u90.jpg)












