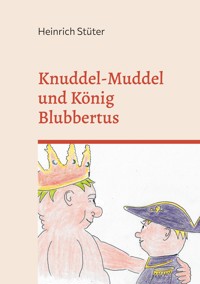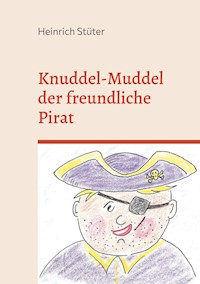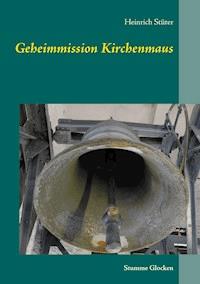Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Während seiner Reisen hat der Erzähler immer wieder Erlebnisse zwischen den Welten, dem Hier und Jetzt und der körper- und zeitlosen Existenz gehabt. Ob es um den Kontakt mit bis zum Tode gequälter Menschen, oder einer über den Tod hinaus liebenden Frau geht, mysteriöse Vorkommnisse während einer Beerdigung, oder der Hilfe einer anderen, parallelen Welt aus einer lebensbedrohlichen Notlage. Immer wieder haben sich diese beiden Welten, die reale und die irreale miteinander vermischt. Sind Quasi fließend ineinander übergegangen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 115
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Einleitung
Nachtschicht
Die weiße Frau von Haus Hyven
Das Haus der weinenden Mädchen
Grab zur Unterwelt
Eine eiskalte Winternacht
Erzählt und gezeichnet von Heinrich Stüter
INHALT
EINLEITUNG
NACHTSCHICHT
Ein neues Projekt
Eine merkwürdige Beobachtung
Ein unheimlicher Spuk
Eine unbekannte Lok
Eine schreckliche Entdeckung
DIE WEISSE FRAU VON HAUS HYVEN
Ein unbedeutender Unfall
Ein einsames Haus
Eine schreckliche Gewissheit
DAS HAUS DER WEINENDEN MÄDCHEN
Lodernde Feuer
Joe
Eine erschreckende Wahrheit
GRAB ZUR UNTERWELT
EINE EISKALTE WINTERNACHT
Einleitung
Erlebnisse eines Reisenden?
Natürlich, wer sich auf den Weg macht, wer sich von den liebgewordenen Gewohnheiten des Alltags löst, der kann Menschen, Dinge und Situationen erleben, kennenlernen, von denen er in seinem gewohnten, beschützenden Umfeld nicht zu träumen gewagt hat.
Die meisten Menschen verspüren in sich das unstillbare Bedürfnis, Neues kennen zu lernen, zu erleben. Nicht von Ungefähr genießen Reiseberichte in Schriftform, oder im Fernsehen, Abenteuerromane, so eine hohe Nachfrage. Allein die Verpflichtungen, die Bindungen, die der Alltag und der einmal errungene Wohlstand uns auferlegt, halten uns fest in ihren Klauen. Wer möchte schon gerne das weiche Bett, die morgendliche Dusche mit einer schmutzigen Unterkunft in einem Oasendorf in der Sahara tauschen, in dem es kaum genügend Wasser für den starken Pfefferminztee gibt, der von dem freundlichen Gastgeber gebracht wird. Wer möchte schon gerne in den algerischen Bergen neben Ziegen und Hühnern sein Nachtlager in einem feuchten, nahezu fensterlosen Gemäuer aufschlagen, das vielleicht später einmal ein Haus werden soll.
Aber dennoch sind wir alle Reisende.
Reisende zwischen den Welten, zwischen den Existenzen. Zwischen der physischen- und der spirituellen-, der geistigen Existenz. Auch wenn es immer noch einige Zeitgenossen gibt, die sich verbissen an die physische, materielle Welt klammern, so glauben- nein, ich möchte sagen, wissen doch viele bereits von der Existenz einer parallelen- geistigen, spirituellen Welt.
Wer schon einmal bei einer Meditation tiefenentspannt in sich hinein geschaut hat, oder die Zeit zwischen Traum und Tag, bevor die Ratio, das Wachbewusstsein voll einsatzbereit war, erlebt hat, wird erstaunt festgestellt haben, dass es da tatsächlich noch etwas anderes gibt als das, was man greifen, was man für Geld erwerben kann. Etwas Geistiges, Spirituelles. Eine andere Existenz.
Und diese geistige Existenz, dieses spirituelle SEIN, ist keineswegs weit weg von uns. Sie ist um uns herum, im HIER und JETZT. Bisweilen kann es sogar vorkommen, dass sich ein Fenster öffnet und diese beiden Existenzen, die physische und die spirituelle sich mit einander verbinden. Ineinander verschmelzen.
Nachtschicht
Ein neues Projekt
Wenn ich heute so zurück denke, spürte ich damals schon bei einem Vorläuferprojekt, bei dem ich die Lagertätigkeiten in einem Zellstoff verarbeitenden Betrieb zu untersuchen hatte, dass eine größere Aufgabe auf mich zukam. Eine Aufgabe, die mit Eisenbahnwagen zu tun hatte. Was im Detail mich dort erwartete, wusste ich allerdings nicht. Und das war auch gut so. Von Natur aus bin ich zwar allem Neuen aufgeschlossen, aber manches übersteigt eben auch mein Bedürfnis nach neuen Erfahrungen.
Es war Mitte Februar. Das Projekt in der Zellstofffabrik war gerade erfolgreich abgeschlossen, meine Frau Marianne und ich saßen noch beim Frühstück und machten Pläne für den kommenden Tag, als das Schrillen des Telefons uns jäh aus unserer Gedankenwelt heraus riss. Widerwillig ging ich ins Büro und nahm den Hörer ab. Die Stimme, die sich aus der Muschel meldete, kannte ich. Es war der Chef der Unternehmensberatung, für die ich nun seit vier Wochen arbeitete.
Ob ich schon einmal mit dem Ausschlachten von Eisenbahnwagen zu tun gehabt habe, und ob ich mir vorstellen könnte, in so einem Projekt mitzuarbeiten.
„Na ja“, antwortete ich ihm. „So etwas habe ich mir schon gedacht, denn als ich eine Studie bei der Entladung von Eisenbahnwagen durchführte, spürte ich bereits, dass noch eine größere Sache bezüglich Eisenbahnwagen auf mich zukommen würde.“
Ob er mir diese Vorahnung abgenommen hat, kann ich nicht sagen, denn er bremste gleich meine Freude.
„Das ist aber nicht gleich um die Ecke. Sie können dann nicht jeden Abend heimfahren. Das Werk ist in einer kleinen Stadt in Bayern. Das sind ungefähr fünfhundert Kilometer von hier.“
Ich bat mir Bedenkzeit aus, war es doch nicht in meinem Sinn, eine Wochenendehe zu führen. Auch war zu befürchten, dass meine politischen Aktivitäten in unserem Stadtbezirk darunter leiden könnten.
Als ich nach dem Telefonat wieder am Frühstückstisch erschien, muss ich wohl ein sehr nachdenkliches Gesicht gemacht haben, denn Marianne fragte gleich, ob es Probleme gäbe. Auch sie war nicht gerade begeistert von dem neuen Angebot meines Chefs, doch meinte sie nach einigem Überlegen, dass wir das Geld ja gut gebrauchen könnten, hatten wir doch gerade erst vor einem Jahr unser Haus neu gebaut und daher noch eine Menge Schulden am Bein. Also rief ich noch am gleichen Tag meinen Chef an, um mit ihm weitere Details zu besprechen.
Das Wochenende verging dann schnell und die Anspannung aus einem Gemisch von Neugier und einem Hauch von Furcht vor dem Ungewissen wuchs zunehmend in mir. Doch als ich dann endlich montags morgens um halb sechs in meinem grünen Passat Richtung Bayern los fuhr, war alle Anspannung von mir abgefallen.
Friedlich zog sich das graue Band der Autobahn über die Höhen und vielen Brücken des Sauerlandes, so wie man es sich heute kaum noch vorstellen kann. Auch wenn dann durch den Spessart hin, der Verkehr merklich zu nahm, so war es doch kein Vergleich mit dem Verkehrsaufkommen der heutigen Zeit. Steif vom langen Sitzen, aber doch entspannt, stand ich dann ziemlich genau wie verabredet um zwölf Uhr an der Pforte des Eisenbahn-Ausbesserungswerks in der bayerischen Kleinstadt.
„Jo, doa missens hinta da Pforten rechts ab, dann an dea Kantieenen voaboa. Dann wiada links on dea Lokhollen entloang. Doa sengs schoa a Haus mit a Turm. Dos ist die Verwaltung. Doa missens noa mual froagen“, beschrieb mir der Uniformierte den Weg.
Obwohl ich nicht viel von dem verstand, was mir der freundliche Pförtner beschrieb, so stand ich dann doch vor einem, noch aus der Kaiserzeit stammenden Gebäude mit einem kleinen Turm auf der Dachmitte, in dem sich von allen Seiten weit sichtbar eine große Uhr befand.
Herbert, der Kollege von der Unternehmensberatung, wartete bereits auf mich. Beim gemeinsamen Mittagessen in der Kantine, zu dem es, wie damals in Bayern noch üblich, auch Bier zu trinken gab, informierte er mich schnell über alle Dinge und Personen, die für dieses Projekt wichtig waren. Am Nachmittag fanden dann die üblichen Vorstellungsgespräche und eine Projektbesprechung statt. Die Fertigungshalle, durch die man uns anschließend führte, war durchzogen von sechs Gleispaaren, auf denen die unterschiedlichsten Güterwagen zur Reparatur standen. Allein an der rechten Außenwand stand ein noch in recht gutem Zustand befindlicher D-Zug Wagen. Dieser sollte nun das Objekt unserer Untersuchungen sein. Herbert und ich schauten uns nachdenklich an. Und ich konnte seinen Blicken entnehmen, dass er genau so wenig Ahnung davon hatte, was nun auf uns zu kam, wie ich. Jedoch wussten wir beide auch, dass wir schnell in dieses Projekt hinein wachsen würden. Den fünf Schlossern, die zur Ausführung dieses Projektes abgestellt waren, wurden wir noch vorgestellt, so dass wir gleich am nächsten Morgen starten konnten. Schichtbeginn um sieben Uhr.
Nach einer freundlichen Begrüßung begannen die fünf mit dem planmäßigen Zerlegen des D-Zug-Wagens. Unsere Aufgabe bestand nun darin, eine Dokumentation mit allen erforderlichen Arbeiten und den dazu aufgewendeten Zeiten zu erstellen, wonach dann später eine Serienfertigung erfolgen konnte. Daher hatten wir oft bis vier Uhr oder später in der Werkshalle zu tun, um dann nach Schichtende im Büro die gesammelten Daten auszuwerten und aufzubereiten.
Es war die zweite Woche unseres Projektes. Bei der Mengenerfassung während der Demontage war mir wohl ein Fehler unterlaufen, so sah ich mich gezwungen, nach Schichtende noch einmal in die Halle zu gehen, um die ausgebauten Teile zu kontrollieren. Herbert hatte bereits das Büro verlassen, als ich zurück kam. Auch von den Eisenbahnern war niemand mehr da. Der Schlüssel zum Eingang lag auf meinem Schreibtisch . Eine Notiz lag dabei: „Wenn du fertig bist, schließe ab. Schlüssel beim Pförtner abgeben.“
Eine merkwürdige Beobachtung
Gegen zwanzig Uhr verließ ich dann endlich mein Büro und machte mich auf den Weg durch das weitläufige Werksgelände . Der im Schein des hell leuchtenden Mondes glitzernde Schnee, gegenüber dem sich die nun schwarzen Backsteingebäude düster und drohend abhoben, knirschte unter meinen Schritten. An dem Parkplatz vorbei, auf dem eingeschneit mein Auto stand - ich benutzte es seit Tagen nicht mehr - führte mich mein Weg auf die Lokhalle zu. In Vorfreude auf eine heiße Dusche und mein warmes Bett, lauschte ich dem knirschenden Geräusch, das man nur bei trockenem, stark gefrorenem Schnee hören kann, wie man ihn bei uns im Ruhrgebiet nur noch selten findet.
Doch da, was war das?
Unversehens wurde ich aus meinen Gedanken gerissen. Schimmerte da nicht ein Licht durch die bereits matten und vom Frost beschlagenen Fenster der alten Lokhalle?
Das konnte doch nicht sein. Es war doch niemand mehr im Werk. Und überhaupt, Lokomotiven wurden hier seit Jahren nicht mehr repariert.
Gespannt ging ich auf die alte Halle zu, vor der noch hier und da einige alte Lok-Radsätze an bessere Zeiten erinnerten. An jene Zeiten, als hier noch die mächtigen Dampflokomotiven wieder zum Leben erweckt wurden.
„Ach“, sagte ich mir. „ Vielleicht hast du dich ja auch nur getäuscht. Wahrscheinlich ist es ja nur eine Reflektion des Mondlichts oder der vereinzelt stehenden Außenleuchten in dem Fenster.“
Doch dann sah ich es wieder. Und jetzt, wo ich direkt vor dem Fenster stand, gab es für mich keinen Zweifel. Das Licht, ein bläulich, matt schimmerndes, diffuses Licht, es kam von drinnen. Vielleicht hätte es das Licht eines Schweißgerätes sein können, versuchte ich abermals eine logische Erklärung für diese Erscheinung zu finden. Mit der Hand kratzte ich den Schnee von der Scheibe, um besser sehen zu können. Ich traute meinen Augen nicht. Es war nicht nur eine Lichtquelle, die ihren Schein durch das matte Fensterglas fallen ließ., nein, es mochten an die zwanzig matt leuchtenden Lichter sein, die wie Wesen aus einer anderen Welt, in der Halle auf und ab liefen, so als würden sie dort arbeiten.
Was nur sollte ich tun?
Wie sollte ich mich verhalten?
Ich hatte keine Ahnung. Auf jedem Fall wollte ich den Pförtner über meine Beobachtung in Kenntnis setzen.
„Noi, doa is nix. Doa wiad scho seit Joaren nich mea geoabeit“, war die lapidare Antwort des guten Mannes. Jedoch beruhigen konnten mich diese Worte nicht wirklich.
Wem konnte ich mich anvertrauen? Herbert, mein Kollege war ein rein rational denkender Mensch. Er würde es sich auch im Traum nicht einfallen lassen, einmal länger als unbedingt nötig im Werk zu bleiben, wo doch im Hotel ein kühles Bier auf ihn wartete. Er war ein netter, zuverlässiger Kerl, jedoch viel zu sehr in materiellem Denken verfangen. Die anderen Kollegen von der Bahn kannte ich noch zu wenig, um mich ihnen anzuvertrauen. So trug ich die Bilder der Nacht noch tagelang mit mir herum, ohne eine Erklärung dafür gefunden zu haben. Selbst über das Wochenende ließen mich diese Gedanken nicht los. Und als Marianne, meine Frau, mich dann fragte, ob es Probleme bei der Arbeit gab und ich ihr darauf von meiner Beobachtung berichtete, antwortete sie nur mitleidig lächelnd
mit dem abgewandelten Goethe-Zitat:
„Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde - als anderswo!“
Doch die Glut der Neugier entwickelte sich im Laufe der nächsten Wochen zu einem lodernden Feuer, das mich nach und nach immer mehr zu verzehren drohte. Jede freie Minute strich ich um die Lokhalle herum, suchte hier und dort einen Blick durch die blinden Fensterscheiben hinein zu werfen, oder einen offenen Eingang, eine Türe zu finden. Doch ohne Erfolg. Alle Türen und Fenster auf der mir zugänglichen Hallenseite waren fest verschlossen. Die Rückseite allerdings war durch einen hohen Zaun abgetrennt, welcher das nun kleinere Werksgelände einfriedete.
Irgendwie musste ich dort hinüber kommen, soviel stand fest. Vielleicht gab es ja von dort einen Zugang.
Der folgende Tag, es war ein Dienstag, schien mir für mein Vorhaben bestens geeignet, denn die Werksleitung setzte ab zehn Uhr eine Betriebsversammlung an. Unser Erscheinen war dort nicht erforderlich, so dass wir nach der Frühstückspause freigestellt waren. Doch ich hatte mich zu früh gefreut. Herbert trug sich schon mit anderen Plänen herum. Hatte doch ein Mitarbeiter aus der Arbeitsvorbereitung uns sehr ans Herz gelegt, die freie Zeit zu einem Besuch in einer nahe gelegenen KZ - Gedenkstätte zu nutzen.
Wenn ich ehrlich sein will, so hatte er auch recht, denn die schon recht kräftige Märzsonne lud förmlich zu einem Ausflug ein.
So verließen wir kurz darauf in Herberts champagnerfarbenen Mercedes das Werksgelände Richtung Norden, um später in der Kreisstadt dann rechts in Richtung Gedenkstätte abzubiegen. Zügig waren die zweiundzwanzig Kilometer zurückgelegt und schließlich standen wir vor dem großen Tor über dem wie bei fielen anderen Konzentrationslagern der menschenverachtende Spruch wie für die Ewigkeit in Stahl geschrieben stand „Arbeit macht frei“.
Und genau aus demselben Stahl schien die Klammer zu sein die sich über meine Brust legte, als wir dieses Portal durchschritten. Herbert schien es nicht anders zu gehen, denn die lockeren Sprüche, die noch bis vor wenigen Minuten über seine Lippen kamen, wichen einem bedrückenden Schweigen, das während des ganzen Besuches dort uns begleitete. Selbst als wir Stunden später in unserem Hotel beim Abendessen saßen, bedrückte uns immer noch die Erinnerung an die Brennöfen und an den großen Hügel, unter dem die Asche und Gebeine von tausenden Gefangenen ruhten.
Am nächsten Morgen wurden wir schon vor unserem Büro empfangen. Voll freudiger Erwartung kam uns der Kollege entgegen, der uns den Tipp mit dem KZ gegeben hatte: Na, wie hat euch denn die Gedenkstätte gefallen?“, wollte er wissen.
Ich dachte ich höre nicht recht.
„Von gefallen kann ja wohl gar keine Rede sein. Entsetzlich, grauenhaft, das trifft es wohl eher“, gab ich ihm gereizt zur Antwort, und vergaß dabei ganz, das es ja von ihm nur gut gemeint war.