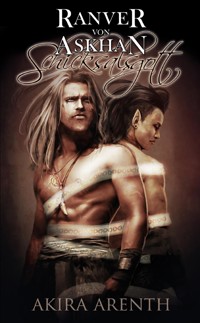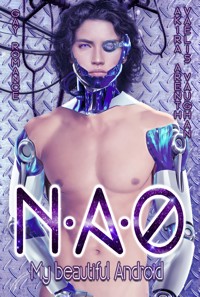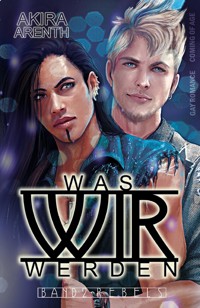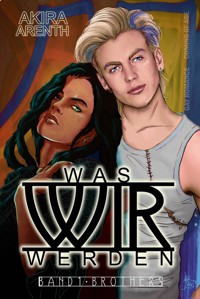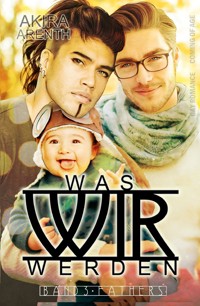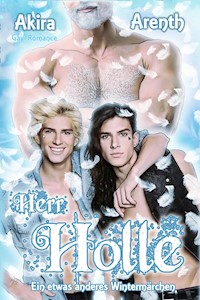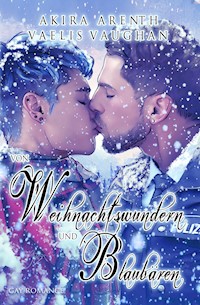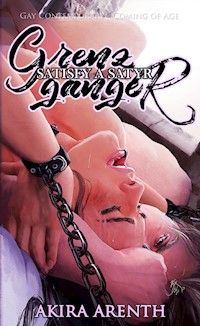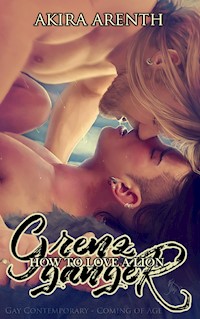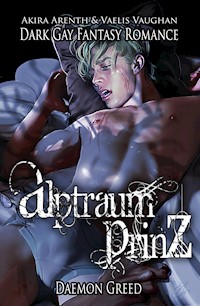4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Piraten mögen keine Holzwürmer (Sammelband!) Print 346 Seiten Genre: Gay Romance / Gay Humor / Yaoi Novel Ein blutrünstiger Piratenkapitän, bekannt und berüchtigt auf allen sieben Weltmeeren, bedeutende Schlachten auf See, grauenvolle Ungeheuer der Tiefe ... um all dies geht es in dieser Story keine Spur. Also, es geht schon um einen Piraten: mich! Marley Bell! Aber ich bin nur ein ganz gewöhnlicher Teich- und Pfützenpirat. Als Sohn vom Deckschrubber Segelohren-Sören und dem Hafenflittchen Rosine Reißzahn bin ich leider weder reich noch gefürchtet. Trotzdem bin ich eine Frohnatur und liebe mein wildes Piratenleben in Captain Brownies Crew: luftige, farbenfrohe Kleidung, belebender Seegang, lockere Hygienevorschriften, frisurentechnische Narrenfreiheit und dazu stets ein frischer Wind um die Nase, von dem ein oder anderen Seebärenbläh mal abgesehen. Frei wie die Vögel können wir schiffen, wo auch immer wir wollen! Nun ja, zumindest konnten wir das, bis wir eine Kaperfahrt versemmelten und ich mitten beim Entern in die Hände eines äußerst unhöflichen Sklavenhändlers fiel. Und als ob meine missliche Lage dadurch nicht schon unerfreulich genug wäre, verkaufte er mich auch noch an einen stämmigen Holzfäller, der weniger Intelligenz zu besitzen scheint als der Dreck unter seinen Fußnägeln! Ich muss ihm entkommen und das werde ich auch! Schwupps, bin ich weg ... sobald der endlich mal aufhört, mich so lüstern anzugucken! Geradezu unangenehm ist das! Wie kann man als Kerl eigentlich so schöne Augen haben? Egal! Ich muss mich zusammenreißen und meine Flucht planen! Ich werde entkommen! Ja, ganz bestimmt! Gibt es hier irgendwo eine Metallsäge?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Piraten mögen keine Holzwürmer - Klappentext
Genre: Gay Romance / Gay Humor
Ein blutrünstiger Piratenkapitän, bekannt und berüchtigt auf allen sieben Weltmeeren, bedeutende Schlachten auf See, grauenvolle Ungeheuer der Tiefe ... um all dies geht es in dieser Story keine Spur. Also, es geht schon um einen Piraten: mich! Marley Bell! Aber ich bin nur ein ganz gewöhnlicher Teich- und Pfützenpirat. Als Sohn vom Deckschrubber Segelohren-Sören und dem Hafenflittchen Rosine Reißzahn bin ich leider weder reich noch gefürchtet. Trotzdem bin ich eine Frohnatur und liebe mein wildes Piratenleben in Captain Brownies Crew: luftige, farbenfrohe Kleidung, belebender Seegang, lockere Hygienevorschriften, frisurentechnische Narrenfreiheit und dazu stets ein frischer Wind um die Nase, von dem ein oder anderen Seebärenbläh mal abgesehen. Frei wie die Vögel können wir schiffen, wo auch immer wir wollen! Nun ja, zumindest konnten wir das, bis wir eine Kaperfahrt versemmelten und ich mitten beim Entern in die Hände eines äußerst unhöflichen Sklavenhändlers fiel. Und als ob meine missliche Lage dadurch nicht schon unerfreulich genug wäre, verkaufte er mich auch noch an einen stämmigen Holzfäller, der weniger Intelligenz zu besitzen scheint als der Dreck unter seinen Fußnägeln! Ich muss ihm entkommen und das werde ich auch! Schwupps, bin ich weg ... sobald der endlich mal aufhört, mich so lüstern anzugucken! Geradezu unangenehm ist das!Wie kann man als Kerl eigentlich so schöne Augen haben? Egal! Ich muss mich zusammenreißen und meine Flucht planen! Ich werde entkommen! Ja, ganz bestimmt! Gibt es hier irgendwo eine Metallsäge?
Akira Arenth
Vaelis Vaughan
Prolog
Zaghaft klopfe ich an der massiven Tür im obersten Bereich des Hecks, die als einzige auf unserem Schiff abschließbar ist. Die Sonne geht gerade erst unter und bis vor wenigen Minuten war ich noch dabei, die Takelage zu überprüfen und die neuen Ankerleinen zu befestigen, die wir im letzten Hafen erstanden hatten. Just in dem Moment, als ich den Hanf fertig geknüpft hatte, kam Piers auf mich zu und sagte salopp: »Zum Captain. Jetzt!« Da dies nicht nach einer Bitte klang, ließ ich alles stehen und liegen und machte mich eilig auf den Weg.
Big B. lässt man nicht warten! Vor allem nicht, wenn man nur ein Schiffsjunge und damit eines der kleinsten Lichter in seiner Mannschaft ist, das gerade erst mit seiner Karriere als Seeräuber beginnt.
Ich wiederhole mein Klopfen und diesmal vernehme ich ein kratziges »Komm rein!«.
Die raue See rauscht so laut und unermüdlich gegen den Rumpf des Schiffes, dass der Klang seiner Stimme beinahe darin untergeht. Mit rasendem Herzschlag öffne ich die Tür und betrete das Quartier unserer obersten Autorität, während ich inständig hoffe, dass er bei guter Laune ist und auch noch nicht zu viel Rum getrunken hat.
Wärme empfängt mich, und nachdem ich das abgenutzte Brett hinter mir geschlossen habe, mindert sich auch der Krach auf ein erträgliches Maß. Riesige Fenster, fünf Stück an der Zahl, dominieren den Raum und lassen die letzten roten Strahlen der bereits untergehenden Sonne hindurch. Sie bestehen aus kleinen, viereckigen Kacheln und bedecken beinahe die gesamte Rückseite der Kajüte, weshalb die Spiegelungen des Wassers auf die halbe Decke übertragen werden. Vor der mächtigen Wand aus Glas steht ein alter, wuchtiger Schreibtisch: massiv, dunkelbraun, zerkratzt, doch dadurch nicht minder beeindruckend, so wie alles in diesem rustikalen Raum. Dahinter, auf einem hochlehnigen Sessel, sitzt der Captain mit gesenktem Blick, vertieft in ein vor ihm liegendes, sehr dickes Buch. Ich sehe, wie er den Federkiel in seiner rechten Hand führt und ihn gerade in seinem Tintenfass neu benetzt, das nahe dem großen Kerzenleuchter auf dem Tisch steht.
Er sieht mich nicht an. Er sieht mich nie an.
»Zieh dich aus«, tönt es aus seinem Mund. Ruhig, ohne erkennbare Absicht, beinahe schon gleichgültig.
»Aye«, antworte ich nervös, gehe nach links zum großen Bücherregal und beginne damit, mein einfaches Leinenhemd aufzuziehen. Es dauert nur wenige Minuten, bis ich komplett nackt bin und meine Kleidung ordentlich auf den Deckel der daneben befindlichen Truhe gelegt habe. »Erledigt, Sir«, gebe ich demütig bekannt und stelle mich wieder vor seinen Schreibtisch, die Hände schützend vor meiner Scham verschränkt.
Ein Raunen dringt aus seiner Kehle. Er greift mit der Linken zu seinem Glas und leert es in einem Zug, bevor er damit auf den kleinen, runden Holzzuber zeigt, welcher an seinem Bettende steht. »Wasch dich!«
»Aye, Captain.« Ich komme nicht umhin zu bemerken, dass es derselbe Ablauf ist wie bei meinen letzten elf Aufwartungen. Um meine Fehler aus der Vergangenheit nicht zu wiederholen, beeile ich mich und steige in den runden, leeren Bottich. Auf dem kleinen Tisch daneben steht ein großer Krug Wasser. Ebenfalls liegen Bürsten, Lappen und eine Seife aus Fett mit gelöster Pflanzenasche bereit, die ich eifrig benutze. Ich zittere schon nach kurzer Zeit, denn nass ist es doch ziemlich kalt. Trotzdem bin ich froh, diese gelegentliche Möglichkeit der Säuberung zu haben, auch wenn noch immer viele Ärzte den Irrglauben verbreiten, dass Wasser den Körper durch die Poren hindurch aufweicht und Krankheiten deshalb leichter in uns eindringen können. Doch wir Piraten wissen es besser. Mangelnde Sauberkeit leistet Seuchen Vorschub und außerdem ziehen wir Ungeziefer an, wenn wir zu sehr stinken. Genau deswegen wäscht sich der Captain täglich und hat mit seinem Reinigungsfimmel auch schon die ganze Crew angesteckt. Bei meinem ersten Mal musste ich die Prozedur dreimal wiederholen, bis er mit mir zufrieden war.
Tagsüber haben wir noch immer angenehme Temperaturen, aber abends und nachts kann es auf See schon mal empfindlich kalt werden. Besonders zu dieser Jahreszeit. Daher rubble ich mich schnell mit dem großen Tuch trocken, das auf einem Stuhl bereitliegt, hänge es danach zum Trocknen über die Lehne und tappe dann bibbernd zurück auf meine Ausgangsposition.
»E-E-E-Erl-l-l-ledigt, S-S-S-Sir!«, gebe ich zähneklappernd Bescheid.
Emotionslos hält der Captain sein leeres Glas hoch und ich eile nach vorn, um ihm Rum nachzugießen. Selbst während ich das tue, bleibt sein Kopf gesenkt und der Blick starr auf unser Logbuch gerichtet, in das er gerade den täglichen Eintrag schreibt. Allerdings sehe ich, wie er mich dann doch ganz kurz aus dem Augenwinkel von der Brust bis zu meinem entblößten Unterleib mustert.
»Zünde die Kerzen an, danach leg dich ins Bett.«
»A-A-Aye.«
Schon als ich in das massive, an der Wand verankerte Bett steige, das mit gedrechselten Holzsäulen versehen ist, welche einen dichten, elfenbeinfarbenen Vorhang tragen, beginnt mein Herz regelrecht zu rasen, obwohl es eigentlich keinen Grund dazu hat. Big B. ist wie alle großen Tiere: Ehrfurcht gebietend, aber sanftmütig ... zumindest innerhalb seiner eigenen Herde. Er ist gnadenlos, wenn es um seine Feinde geht, und man sollte es sich gut überlegen, ob man ihm droht. Uns gegenüber ist er jedoch ein gerechter Anführer, weder grausam noch egozentrisch, dem es weniger um seinen eigenen Ruhm geht als darum, dass wir immer genügend Essen an Bord haben und unter guten Bedingungen leben und segeln. Die eine Hälfte der Mannschaft beneidet ihn um seine Stärke, die andere Hälfte sehnt sich danach, an meiner Stelle zu sein. Sich mit dieser lebenden Legende in den Laken zu wälzen und sich ihm hinzugeben, ist weit mehr, als befriedigend. Es ist eine Ehre.
Anfangs hatte ich große Angst, doch auch ich musste erkennen, dass ich die Nächte mit ihm bald herbeisehnte und sie bis heute genieße ... beinahe schon zu sehr, und das liegt sicher nicht nur an seinem bequemen Bett.
So langsam wird mir wieder warm und ich höre auf zu zittern. Die dicke, mit rotem Brokat bezogene Daunendecke ist zudem angenehm weich und strömt den unverwechselbaren, herben Duft meines Captains aus, der mich geradezu benebelt. Zugleich hypnotisiert mich der Blick des ausgestopften Raben auf dem Regal gegenüber. Der flackernde Schein der Kerzen ersetzt inzwischen das Licht der Sonne, die soeben untergegangen ist.
Verstohlen streiche ich über meinen nackten Körper bis zum Ansatz meines Gliedes und lege die Hand um meinen Schaft, um diesen ganz leicht zu massieren. Das Bett steht rechts an der Wand und von hier aus könnte ich meinem Captain auf den Schreibtisch schauen, wäre der Bereich vor dem Fenster nicht durch ein Podest erhöht. Trotzdem erkenne ich sein ernstes Gesicht und beobachte noch eine ganze Weile, wie er schreibt. Sein Kinn wird von dichten Bart verdeckt. Seine letzte Rasur scheint bereits zwei oder drei Wochen her zu sein, doch eigentlich kann ich mich gar nicht erinnern, ihn je ganz bartlos gesehen zu haben.
Beim ersten Mal war ich noch irritiert, dass er nicht gleich zu mir kommt, sobald ich in seinem Bett liege. Doch schnell merkte ich, dass er es auch zu genießen scheint, wenn jemand bei ihm ist und ihm zusieht. Da meine Arbeit auf Deck hart und anstrengend ist, kam es jedoch schon das ein oder andere Mal vor, dass ich vor Erschöpfung einschlief, bevor er mit Schreiben fertig war. An diesen Abenden bedrängte er mich nicht und schlief einfach neben mir, so wie in meiner ersten Nacht bei ihm ... und in der zweiten. In der dritten war ich es dann, der ihn küsste und ihn bat, mich zu entjungfern. Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass es viele Captains gibt, die Neuankömmlinge in der Crew nicht einfach gewaltsam nehmen, vollkommen unabhängig davon, welche Erfahrung diese bereits haben.
Heute scheint er mich jedoch nicht nur als Schlafgefährten neben sich haben zu wollen, denn er schaut immer wieder, wenn auch versteckt, zu mir rüber. »Was soll das werden?«, fragt er irgendwann leise und klappt das Buch zu, doch er würdigt mich weiterhin keines direkten Blickes.
»Ich ... warte auf Euch«, hauche ich erregt und kann nicht umhin, die Faust um meine sensible Spitze zu legen. »Kommt Ihr bald?«
»Bis ich komme, wird es noch eine Weile dauern«, raunt er und ich muss ernsthaft überlegen, wie er das meint. Da er sitzen bleibt und sich noch einen der ungeöffneten Briefe vom Stapel zieht, vermutlich in mehrfacher Bedeutung. »Schlag die Decke zurück, wenn du an dir herumspielst. Du machst mir sonst alles dreckig!«
Dass dies nicht der wahre Grund ist, weiß ich genau, denn wir haben beide schon mehrmals unseren Samen in diesem Bett verteilt. Es ehrt mich jedoch, dass er mir zusehen will, während ich mich ein wenig anheize.
Ich drehe mich auf den Rücken und schiebe die Decke ein Stück beiseite, allerdings nur in Höhe meines Schwanzes, damit der Rest des Körpers nicht zu sehr auskühlt. Dann lasse ich die Faust ganz provokativ über meine gesamte Länge gleiten, während ich Big B. mit halb geschlossenen Augen und leicht geöffnetem Mund lüstern ansehe. Kaum zu glauben, dass ich bis vor ein paar Wochen noch vollkommen unberührt war. Mittlerweile bin ich geradezu süchtig nach dieser Form der Aufmerksamkeit.
Eine gewisse Zeit ignoriert mich mein Captain, doch dann sehe ich, wie er immer häufiger aus dem Augenwinkel zu mir schaut und auch seine Atmung schwerer wird. Auf jeden Fall scheint er sich nicht mehr ganz so gut auf die Arbeit konzentrieren zu können ...
Ich reibe mich immer schneller, spreize die Beine, wippe unablässig mit dem Becken und beginne leise zu seufzen, während ich meine Wange ins Kissen drücke. Dabei schaffe ich es nicht, den Blick von ihm abzuwenden. Ich verzehre mich nach ihm ... dem Klang seines tiefen Stöhnens ... seiner Inbrunst ... und dem erfüllenden Gefühl, wenn er seinen Pfahl in mich treibt.
»Bitte ... Sir ... kommt zu mir«, wispere ich leise, da ich es kaum wage, diesen Wunsch auszusprechen.
»Geduld«, fordert er jedoch nur und liest weiter.
Ich quelle bereits über, lasse die Kuppe meines Schwanzes schneller durch meine glitschigen Finger gleiten und spüre schon, wie er puckert. Jede Sehne, jeder Muskel vom Bauchnabel bis zum Steißbein ist angespannt und ich japse auf.
»Wehe dir!«, grollt mein Anführer plötzlich sehr streng und sieht endlich zu mir herüber. »Hände ans Kopfteil!«
Sofort lasse ich mein pochendes Lustzentrum los und greife an die reich verzierte Holzplatte. »Bitte verzeiht mir!«
Nach seinem Befehl steht er knurrend auf, verschränkt die Arme und stellt sich nun direkt an die Bettkante. »Immer das Gleiche mit euch Kajütenjungs! Erst wisst ihr vor lauter Scham nicht wohin mit euch und seid verschlossener als jede Auster, doch sobald sich euer Arsch an das Eindringen eines anderen Mannes gewöhnt hat, könnt ihr euer Verlangen kaum noch beherrschen! Soll ich dich eine Runde ums Schiff schwimmen lassen, um dich abzukühlen?«
»Nein Sir«, keuche ich zu ihm rauf und fühle, wie meine Wangen glühen. In diesem Moment schäme ich mich für meine ungezügelte Begierde, doch leider treffen seine Worte zu. Erst schien es beinahe unmöglich, ihn in mir aufzunehmen, doch inzwischen komme ich bis zu dreimal pro Nacht und kann kaum noch an etwas anderes denken.
Das Schiff schwingt im Wellengang auf und ab, doch Big B. steht nur da und beobachtet ungerührt meinen zuckenden, überlaufenden Pfahl, bis meine Anspannung etwas abebbt. Dann löst er seine verschränkten Arme und streicht mir, nur mit dem Mittelfinger, über die Spitze, ehe er ihn leicht auf meinen Spalt drückt. Ich keuche, zucke weg, doch da beendet er seine Zuwendungen bereits und kehrt an seinen Schreibtisch zurück.
»Dreh dich um, auf Knie und Ellenbogen! Blick nach unten, Decke über den Körper! Hände bleiben draußen, sodass ich sie sehen kann!«
»Aye«, seufze ich und gehorche.
***
Eine halbe Ewigkeit vergeht, ehe ich irgendwann das Knarzen seines Sessels höre. Fast wäre ich eingeschlafen. Es scheint, als würde er sich nun extra lange Zeit lassen, nur um mich zu bestrafen. Als ich jedoch endlich das Rascheln seiner Kleidung, plätscherndes Wasser und dann auch das leise Klappern des tönernen Fett-Tiegels vernehme, schwillt meine Anspannung. Unweigerlich verhärtet sich mein Riemen erneut, noch bevor er zu mir ins Bett steigt und die Decke meinen Rücken hinaufschiebt.
Meinen hochgestreckten Hintern streift ein kühler Luftzug und ich fühle eine warme Hand, die mir über die Backen streicht.
»Spreiz die Beine weiter!« Der Klang seiner Stimme ist nun, trotz des Befehls, deutlich versöhnlicher als vorher, und sobald ich folge, kreisen zwei Finger auf meinem Zugang, um einen gleitenden Film aufzutragen. Ich seufze leise, als er mir mit der zweiten Hand sanft die Eier massiert und über meinen Steifen streicht, was mich erschaudern lässt.
Dies tut er eine ganze Weile, doch irgendwann setzt er endlich seinen harten, eingeschmierten Bolzen an und schiebt ihn mir inbrünstig hinein.
Ich schreie auf, beiße in meinen Unterarm und verdrehe die Augen, als seine stark ausgebildete Eichel diesen einen, lustvollen Punkt in mir trifft. Trotz der vorherigen Unterbrechung meiner Erregung beginne ich gleich wieder zu zittern und spüre, wie sich meine Muskeln zusammenziehen. Doch darauf nimmt er nun keine Rücksicht mehr.
Er zieht sich zurück, bis er fast aus mir herausrutscht, nur um mir seinen Pfahl erneut in den Körper zu treiben. Dieses Spiel wiederholt er immer wieder, mal schneller, mal langsamer, doch jedes Mal bis zum Anschlag, bei dem sich seine Eier an meinen Damm pressen.
Ich kann nicht mehr an mich halten. Fest in die Leinenunterlage verkrallt, spüre ich das Zucken meines Unterleibs. Noch während ich brüllend auf das Laken spritze, packt er mich bei den Haaren und drückt mein Gesicht in die Matratze, um meine Lautstärke zu dämpfen. Daraufhin hämmert er sich in mich und pumpt mir schließlich seinen ganzen Saft in dicken Schüben hinein.
Dies war das letzte Mal, dass er mich in seine Kajüte rief, und seitdem vergeht kaum eine Nacht, in der ich mich nicht nach ihm sehne.
Nein. Man sollte sich niemals in den Captain eines Piratenschiffes verlieben, egal wie sehr man ihn respektiert oder verehrt.
Part 1 - Lebenswert
Als ich das Podest betrete, blendet mich die Sonne, die selbst um diese Uhrzeit schon hoch am Himmel steht. Eine feiste Fliege brummt dicht an meinem Gesicht vorbei, kitzelt mir mit ihrem haarigen Hintern fast die Nase und surrt dann schnurstracks hinüber zu den anderen Marktständen, von denen ein herzhaft-süßlich gemischter Geruch verschiedenster Waren an meine Nase dringt.
Was für ein wunderschöner Tag!
Auch Mister Köttels lunzt verzottelt aus seinem Versteck hervor, der ausgeleierten rechten Tasche meiner Hose, dehnt sich ausgiebig und gähnt, sodass man ihm tief in den Rachen gucken kann. Dabei streckt er seine winzigen Pfoten hoch und spreizt diese, was ich immer schon äußerst possierlich fand. Normalerweise schläft er in der linken Innentasche meines Gehrockes, doch dieser befindet sich derzeit in einer gut verschlossenen Truhe, so wie auch mein Säbel, mein Hut und der Rest meiner Kluft.
Mein treuer Begleiter springt auf den einfachen Bretterboden, läuft das Treppchen herunter, sucht sich ein Grasstück neben dem Podest, scharrt in diesem und pieselt. Dann schüttelt er sein rotes Fell in einem Schwung durch, dehnt sich noch einmal, kommt zurück und hüpft leichtfüßig wieder auf meinen Arm. Von dort klettert er mir auf die Schulter, seinen Lieblingsplatz.
Manche Piratenkapitäne haben einen Papagei - ich habe einen Minifuchs!
Und dabei bin ich noch nicht mal Captain.
Schon jetzt ist die aufsteigende Hitze dieses drückenden Spätsommers deutlich zu fühlen, aber auch die salzige Meeresluft wabert noch kühl vom anliegenden Hafen zu uns rüber. Bald werden die ersten Mägde kommen, um frische Zutaten für das Frühstück ihrer hohen Herren zu kaufen. Die Händler dieser kleinen Stadt ordnen dafür ihre Güter ansehnlich auf Tischen, Podesten und Bänken, die sie zum Schutz vor der Sonne mit Tüchern überdacht haben.
Der Geschäftsmann Godric Chapman, mit dem ich ähm ... zusammenarbeite, legt weniger Wert auf diese Dinge, denn er wird seine Ware schneller los, als er Materialgemeinkostenzuschlagsprozentsatz sagen kann. Das ist tatsächlich eines seiner Lieblingswörter, um seine unverschämten Preise zu rechtfertigen. Ja, seine Unkosten sind sicher höher als die eines Brothändlers, aber an dieser Stelle sollte ich vielleicht erst einmal verraten, was er verkauft.
Mich.
Also genau genommen bin ich, Marley Bell, neben drei Frauen, vier Männern und zwei Kindern, nicht direkt sein Geschäftspartner, sondern eher so etwas wie ... seine Ware.
Ja, ich stecke in einer misslichen, geradezu unerfreulichen Lage, aber ich mache das Beste daraus, so wie immer. Zugegeben, wenn ich daran denke, dass ich schon seit Wochen von meinem Zuhause, dem Piratenschiff des eloquenten Captain Brownie und seiner Crew, getrennt bin und nebenbei auf die unförmigen Metallschellen an meinen Handgelenken schaue, könnte mir das den Tag versauen. Aber ich bin ein Optimist und blicke stets positiv in die Zukunft. Immerhin lebe ich noch – das ist doch schon mal was! Außerdem flattert just in diesem Moment ein hübscher Falter an meiner Nase entlang und ich bin geneigt, mich an seiner pudrigen Farbenpracht zu erfreuen. Fast wie an der des geschminkten Gendarms, der mich festnahm. Ich erinnere mich gut an diesen stark beleibten Kerl, welcher derart viel ausgetrocknete Kalkpaste in seinem wohlgenährten Gesicht trug, dass es kaum auszuhalten war. Meine Finger kribbelten und alles in mir schrie danach, ihm die Schollen von der fettigen Stirn zu polken, doch er ließ mich nicht, warum auch immer. Während er aufgeregt mit mir diskutierte, denn das kann ich gut, bröckelte jedoch sein halber Gesichtsbelag von selbst ab.
Zurück zur unerquicklichen Gegenwart.
Chapman ist dafür bekannt, dass er Sklaven verschiedener Herkunft und in gutem körperlichen Zustand anbietet. In den letzten Wochen habe ich so üppig gegessen wie noch nie zuvor in meinem Leben. Außerdem gibt er uns hochwertige Fettcremes, die unsere Haut weniger ausgemergelt und rissig erscheinen lässt. Diejenigen unter uns, die krank oder einfach nur völlig erschöpft waren, so wie auch ich, ließ er ausruhen und genesen. Natürlich tut er das alles weder uneigennützig noch aus Nächstenliebe, sondern einzig und allein für eines: den Gewinn! Gesunde, starke Sklaven, ohne große körperliche Einschränkungen, kann er für zwanzig bis dreißig Prozent über dem üblichen Marktwert verkaufen. Und dabei ist dieser schon übertrieben hoch. Durch die Engpässe und die Aufstände der letzten Jahre hat sich der Wert seiner Waren mehr als vervierfacht! Um deren Qualität zu halten, benutzt er, im Gegensatz zu anderen Sklavenhändlern, auch keine Peitschen oder Prügelstöcke. Frech werden, oder gar Ausbruchsversuche unternehmen, sollte man trotzdem nicht, denn der Kerl kennt andere, hinterhältige Bestrafungen, die keine sichtbaren Verletzungen hinterlassen. Er mischt zum Beispiel gerne mal scharfe Tinkturen oder Gewürze mit Wasser und spritzt diese in den Körper des zu Bestrafenden hinein. Da hat man noch Tage später was von.
Ich schaue mich um und spüre eine gewisse Schwermut aufsteigen, denn ich wurde in den Straßen einer ähnlich verschlafenen Hafenstadt geboren. Diese hier gehört zu den ersten in den Kolonien. Sie ist noch relativ jung, doch schon als ich ein Kind war, sah ich Sklaven auf Märkten wie dem hier. Niemals hätte ich gedacht, dass ich eines Tages, mit gerade mal achtzehn Jahren, selbst auf einem verkauft werde. Damals bekam man einen männlichen Leibeigenen, fünfundzwanzig bis fünfunddreißig Jahre alt, für rund zwanzig Pfund. Heutzutage zahlt man achtzig bis neunzig Pfund und Chapman handelt sogar oft über hundert aus, vor allem für weiße Frauen im gebärfähigen Alter und besonders muskulöse oder gebildete Männer. Am teuersten sind jedoch die Eunuchen, denn sie sind rar und sterben schnell.
Dass er weniger afrikanische Gefangene hat, liegt daran, dass diese teilweise monatelang übers Meer reisen müssen, um dann mehr tot als lebendig in den britischen Kolonien in Amerika anzukommen. Aber der Mann ist schlau und bezieht seine Ware über zwielichtige Geschäfte mit Piraten, Militärs und auch ganz gemeinen Kidnappern, die überall freie Bürger und deren Kinder versklaven, wo sie nur können. Vor allem in den Küstengebieten des amerikanischen Kontinents gibt es einen regen Handel mit Sklaven: Menschen, die sich hoch verschuldet haben, mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind, in Gefangenschaft gerieten oder unter unglücklichen Umständen geboren wurden.
»Marley!« Sobald ich meinen Namen höre, straffe ich mich und trete vor. »Zieh die Bank heran und dann nehmt ihr alle eure Position ein! Du gehst nach rechts! Die anderen Männer nach links und die Frauen in die Mitte. Die Kinder nach vorne!«
Also wie immer. »Aye, Sir.«
»Und wehe, ich höre heute auch nur ein schräges Wort von dir! Zeig dich von deiner besten Seite, denn noch länger werde ich dich nicht mehr durchfüttern!« Erst droht mir der Kerl nur mit seinem blanken Finger, doch dann packt er mich an meinem lodderigen Leinenhemd und grunzt mir unverschämt nahe ins Ohr: »Entweder irgendjemand erbarmt sich deiner und kauft dich heute vor Sonnenuntergang oder ich lasse dich noch in dieser Nacht kastrieren und verschiffe dich mitsamt deinen abgeschnittenen Eiern nach Asien!«
Leider weiß ich, dass er nicht zu scherzen beliebt. Meine Aussicht auf einen entspannten Abend entschwand soeben und lässt mich missmutig schauen, denn bisher hat sich kaum einer für mich interessiert. Warum sollte es ausgerechnet heute anders sein? Ich weiß nicht mal genau, ob es daran liegt, dass ich ein Pirat war, oder doch eher an meiner recht schmalen Statur, die mich als belastbaren Arbeiter weitestgehend ausscheiden lässt. Aber wenn ich Godric zu sehr auf seine kleinen Schrumpelnüsse gehe, könnte er mich ja auch einfach freilassen. Nur leider entspricht das nicht wirklich seinem Geschäftskonzept.
Ich nicke also und ziehe die große Präsentationsbank heran. Ehrlich gesagt habe ich die ganze Sache bisher relativ gelassen gesehen, denn ich bin nicht zum Sklaven geboren und werde auch ganz sicher nicht lange einer bleiben! Solange ich aber dieses verfluchtverflixte Halseisen umhabe und auch Schellen aus Metall an den Händen trage, halte ich es für besser, mich dem rasierten Speckgesicht zu beugen. So gruppiere ich die anderen Sklaven folgsam, wie es Chapman wünscht. Die zwei Kinder springen allein vor die Bank, denn sie sind die Einzigen, die nicht an einer Kette hängen. Man kann sich wohl sicher sein, dass sie ihre Mütter niemals freiwillig verlassen und weglaufen würden. Ich werde leider oft zum Handlanger in der Umsetzung von Chapmans Befehlen, denn in unserer Gruppe spreche derzeit nur ich dieselbe Sprache wie er. Das hat aber auch durchaus Vorteile für mich oder meine Mitleidenden, weil ich bereits so manchen Deal versaut habe, wenn der Käufer ein grobschlächtiges Ekel oder anderweitig unpassend war.
Ein kleiner Kommentar zu erst kürzlich entfernten Warzen im Intimbereich, dem Unvermögen Körperausscheidungen zurückzuhalten oder zu Beulen, die über Nacht plattgedrückt werden, damit sie tagsüber keiner sieht, verleitet viele Interessierte ganz schnell zum Weitergehen. Anfangs blieb meine Taktik auch vollkommen unbemerkt, bis so ein feiner Schniepel vom Nachbarstand Godric darauf aufmerksam machte, dass ich seine Kunden vergraule. Seitdem achtet er ganz genau auf meine Klappe und stopft mir manchmal sogar einen Lappen in den Mund, über den er einen Riemen bindet.
Wir stehen zum Verkauf bereit, doch unser Besitzer räumt noch irgendwelche Fliederbüsche hin und her, die den Geruch um uns herum angenehm machen sollen. Der farbenfrohe Falter entscheidet, noch einmal eine Runde vor meinem Gesicht zu drehen, um mir seine ach so schöne Freiheit und seine flatternde Anmut unter die Nase zu reiben. Mister Köttels versucht die ganze Zeit vergeblich, ihn mit lauen Pfotenhieben zu fangen, doch aus irgendeinem Grund stellt er sich bei der Jagd allgemein ziemlich dusselig an. Vielleicht bremsen ihn auch seine übergroßen Ohren aus ... wer weiß. Für einen Minifuchs ist er jedenfalls eher plump und das, obwohl er sogar auf Bäume klettern kann. Manchmal glaube ich, eines seiner Elterntiere war ein Eichhörnchen, was auch seine geringe Größe erklären würde.
Plötzlich fordert uns Chapman ruppig auf, eine ansprechendere Haltung anzunehmen, was meine Aufmerksamkeit von meinem treuen, kleinen Begleiter auf den ersten Kauflustigen an diesem Tag lenkt: einen feinen Pinkel, der samt seinem Gefolge über den Markt scharwenzelt. Chapman stürzt sich auf ihn wie ein Aasgeier auf eine tote Ratte und präsentiert uns fuchtelnd, während er überschwänglich lobende Worte zu unseren Wesenszügen und Fähigkeiten findet. Erst sehe ich nur den fremden Herrn, doch dann kommt auch seine Frau dazu, die offensichtlich gerade bei einem Tuchstand war, denn ihre Sklavinnen tragen ihr verschiedene Ballen an Stoffen hinterher. Dabei schwitzen die Damen schon so kräftig, dass ihre hochgedrückten Brüste fast aus ihren Kleidern flutschen.
Zunächst geht es nur um eines der beiden kleinen Mädchen, doch dann scheint die Herrin Mitleid mit dessen Mutter, Agatha, zu haben und sie verhandeln auch über ihren Preis. Derweil wippe ich gelangweilt von den Fersen auf die Zehen, ziehe mein ledernes Bandana[Fußnote 1] über den strubbeligen, dunkelblonden Haaren zurecht und beobachte das altbekannte Spielchen nur beiläufig. Es ist traurig, natürlich, doch wenn man diese Dinge tagein, tagaus sieht, stumpft man irgendwann ab. Mutter und Tochter müssen hier, mitten auf dem Marktplatz, ihre sich notdürftig um den Körper geschlungenen Tücher ablegen und sich dem interessierten Paar in jeder gewünschten Position präsentieren. Wir wurden alle von den Augen abwärts zwangsenthaart, weshalb es kein Fleckchen auf unseren Körpern gibt, das unentdeckt bleibt. Diese Vorgehensweise schwappte aus dem Orient herüber, damit die Sklavenhalter physische Schwächen, Krankheiten und auch die Unterernährung ihrer Ware schlechter verstecken können. Aus diesem Grund gilt es als Gütesiegel, wenn ein Händler seine Sklaven enthaart präsentiert. Außerdem ist diese vollkommen schamlose Zurschaustellung, besonders die der Genitalien, für viele Interessenten auch sexuell anregend, was erfahrungsgemäß zu besseren Verkäufen führt.
Ich persönlich finde den Leib einer Frau wenig ansprechend, aber das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich bisher nie sexuellen Kontakt zu einer solchen hatte. Ich weiß es nicht, doch so wie mir, geht es fast allen Seeleuten, und weibliche Menschen sind ja selbst auf dem Festland rar. Als ich bei den Piraten anheuerte, trat ich in deren Bruderschaft ein und musste sogar ein Dokument unterzeichnen, das es mir verbot, je eine Frau mit aufs Schiff zu schmuggeln. Hätte ich dann noch mit ihr Geschlechtsverkehr, stünde darauf die Todesstrafe durch Ersäufen.
Agatha, eine ehemalige Bäuerin, wie ich inzwischen weiß, war mit ihrer Tochter durch die maßlose Spielsucht ihres Mannes in Godrics Hände gelangt, und sie beeilt sich sichtlich, ihre Demütigung so kurz wie möglich zu halten. Doch die Interessenten lassen sich Zeit. Eine Sklavin ist ungefähr so viel wert wie die Ausgaben einer kleinen Familie für Nahrungsmittel in einem Monat. Ihr Preis steigt, wenn sie bereits ein Kind geboren und die Geburt unbeschadet überstanden hat, und dazu noch eine Weile im gebärfähigen Alter bleibt. Aus diesem Grund werden die Objekte der Begierde sehr lange und ausführlich begutachtet und teilweise sogar noch vor Ort einer ärztlichen Untersuchung unterzogen.
Chapman lobt Agathas sanftmütiges und folgsames Wesen, preist ihr Pflichtbewusstsein und vor allem ihre Nähkünste an, obwohl sie, seit ich sie kenne, nie eine Nadel in der Hand hatte. Und sie kam erst nach mir zu unserem Besitzer.
Während sie eine Brust nach der anderen hebt, schicke ich ein Gebet an alle Götter des Meeres, dass ich von solch schaulustigen Käufern weiterhin verschont bleibe. Was sollte ich denn auch heben? Meine Eier? Eins nach dem anderen?
Bis zum heutigen Tag hatte ich Glück, weil den Wenigen, die bisher an mir Interesse zeigten, ein Blick auf meine Hühnerbrust genügte, um dieses wieder zu verlieren. Doch nun brauche ich dringend einen Käufer, der nicht abspringt und von dem ich später leicht fliehen kann.
Ein großes Schiff dreht am Ankerplatz bei und verlässt den Hafen. Ein anderes macht an seiner Stelle fest und ich seufze innerlich. So nah und doch so fern ...
›Es muss doch eine Möglichkeit geben, da rüber zu kommen! Ich will nicht als Kastrat enden, verdammt!‹ Da hüpft mir indes tatsächlich eine Idee ins Hirn! ›Wenn ich es irgendwie schaffe, mich von diesen verfluchten Metallschellen zu befreien, könnte ich über die niedrige Mauer ins Hafenbecken springen. Vorausgesetzt Godric wäre einen Moment lang unachtsam. Das Wasser ist so braun, dass sicher keiner sieht, wohin ich unter der Oberfläche schwimme. Selbst wenn sie nach mir schießen, würden sie nur blindlings ins Wasser feuern. Hinter einem der anliegenden Schiffe steige ich hoch, hole Luft und tauche dann weiter zu einem, das gerade ablegt. An dessen Heck klettere ich rauf und verstecke mich unter Deck. Godric wird niemals die anderen unbeaufsichtigt zurücklassen, nur um mich zu jagen, und selbst wenn die Stadtwachen ihm helfen, können auch sie kein auslaufendes Schiff stoppen.‹
Klingt nach einem guten Plan! Mister Köttels könnte mir über die Seile und Ketten der Schiffe folgen, da mache ich mir gar keine Sorgen. Bleibt nur noch die Kleinigkeit mit meinen Fesseln.
So langsam füllt sich der Marktplatz und auch vor unserem Podest sammeln sich einige Schaulustige, doch die scheinen sich alle nur ein paar Anregungen für ihre nächtliche Einsamkeit holen zu wollen. Ich schaue mich unauffällig um, aber wie schon die Tage zuvor, entdecke ich einfach nichts, das mir zur Flucht verhelfen könnte. Dieser ausgefuchste Mistkerl Godric hat alles außer Reichweite geräumt, was auch nur im Entferntesten hilfreich wäre.
›Apropos ausgefuchst – wo ist Mister Köttels?‹
Manchmal verschwindet er einfach, wahrscheinlich um sich etwas Essbares zu stibitzen, doch er bleibt eigentlich immer in Rufweite. Trotzdem habe ich Angst, dass es irgendwann mal jemand schafft, den Zwerg zu fangen und mitzunehmen. Natürlich gibt es eine Menge streunender Tiere in den Städten und die meisten werden von allen Menschen königlich ignoriert, so auch Kötti. Aber einen so kleinen und zahmen Fuchs wie ihn habe ich noch nirgendwo gesehen, weswegen ich immer davon ausgehen muss, dass er doch mal abhandenkommen könnte.
Ich möchte nach ihm pfeifen, um ihn wieder in meine Sichtweite zu locken, aber das würde Chapman ganz sicher nicht gefallen. Er hasst es, wenn ich pfeife und hält mich so schon für einen verrückten Sonderling, der sich das Hirn zu jung mit Rum geflutet hat.
Ja, mag sein, aber hey – ich lebe noch! Das ist etwas Positives und motiviert mich immer wieder.
Ich weiß, meine Methoden zur Selbstüberzeugung sind nicht besonders abwechslungsreich, aber egal.
›Wo ist er nur? Mann! Ich hätte ihn mal darauf trainieren sollen, mir hilfreiche Gegenstände zu bringen, statt ihn immer nur zu flauschen! Selbst eine Haarnadel würde mir schon reichen! Irgendwas!‹
Während ich mich möglichst unauffällig umsehe, bleibt mein Blick plötzlich auf einem Bereich am Anlegeplatz haften. Dort lädt gerade ein groß gewachsener, kräftiger Mann, mithilfe einiger Sklaven, halbierte Baumstämme von seinem Karren ab und schleppt diese über den Landungssteg auf ein großes Schiff. Ich beobachte, wie er unermüdlich einen Stamm nach dem anderen transportiert, und dabei verringert er noch nicht mal sein Tempo. Er läuft, als wäre er ein emsiger, übergroßer Hamster, nur dass er sich die Bäume auf die Schultern lädt, statt sie sich in die Backen zu stopfen. Sähe ja auch reichlich komisch aus.
Ich weiß gar nicht genau, was mich an diesem Schauspiel so sehr fasziniert, doch ich beobachte ihn, bis der Wagen leer ist. Ich würde bereits unter der Hälfte eines Viertelbaumstammes zusammenbrechen, und zwar noch vor dem ersten Schritt! Daher verspüre ich einen Anflug von Neid auf diesen kraftstrotzenden Kerl.
›Das ist doch albern! Auf einen wie den braucht man nicht neidisch sein!‹
Er ist nur ein einfacher Arbeiter, ein Holzfäller, wenn mich meine findigen Instinkte und die Hinweise nicht täuschen. Demnach wird er wohl weder besonders schlau noch nennenswert wohlhabend sein. Obwohl ... die Baumstämme wurden weitestgehend behobelt, also ist er eventuell ein Takler[Fußnote 2]. Zumeist betätigen sich diese auf einer Werft oder in einer Spezialwerkstatt für Riggreparaturen, doch einige arbeiten auch ortsungebunden. Nur wenige Schiffe sind so groß, dass sie einen eigenen Takler beschäftigen und auf die Reise mitnehmen.
Jedenfalls trägt er nur gewöhnliche Leinen- und Lederbekleidung, die abgenutzt aussieht, auch wenn ich auf die Entfernung nichts Genaues erkenne. Sein langes, dunkelbraunes Haar scheint im Nacken geflochten, doch einige Strähnen haben sich bei der Arbeit herausgelöst. Ein weiteres Indiz für seinen niederen Stand ist sein dunkler Vollbart, den er unter dem Kinn zusammengebundenen hat. Bei den Adligen sind die nämlich verpönt und werden als ein Zeichen für Ungepflegtheit gesehen. Die einzige Ausnahme bilden feine, gedrehte, eingeschmalzte Oberlippenschnäuzer.
Der Hüne hebt den Arm, als er fertig ist, und ein Kerl mit einem Kapitänshut kommt auf ihn zu. Die Sklaven verschwinden eilig und ich sehe, wie sich die beiden Geschäftsmänner unterhalten. Sie diskutieren und gestikulieren dabei, als wären sie sich nicht ganz einig, doch dann besiegeln sie das Geschäft mit einem Handschlag und der Captain holt seinen Lederbeutel hervor. Er zählt dem Holzlieferanten Münzen in die Hand, fasst sich zum Abschied kurz an die Hutkrempe und geht dann, ohne sich umzudrehen.
Der Bulle steckt die Geldstücke ein, wendet sich zu seinem ebenso stämmigen Schecken[Fußnote 3], der vor den Karren gespannt ist, und bewegt den Mund, als würde er mit dem Gaul reden?! Dann streichelt er dessen Hals, prüft die Gurte und zieht eine Plane in das leere Fahrzeug. Danach dreht er sich um, nimmt die Zügel und schaut auf.
Plötzlich treffen sich unsere Blicke und seine Bewegungen erstarren.
Mein Puls beschleunigt sich. Er sieht mir direkt in die Augen und für einen Moment scheint sich die Zeit zu verlangsamen. Als würden Wellen um mich strömen, verschwimmen alle Laute um mich herum zu einem einheitlichen Rauschen.
Erst als mir Mister Köttels unvermutet auf den Arm springt, reiße ich mich los und senke den Kopf. Mein Füchslein begrüßt mich mit seinem typischen, trillerartigen Laut, der einem Winseln ähnelt, sich jedoch manchmal auch in ein freudigerregtes Schreien steigert. Deutlich lieber ist mir da sein Keckern, das sich anhört, als würde man tonlos »k-k-k-k« sagen, doch leider macht er das nur, wenn er schlechte Laune hat.
»Da bist du ja endlich«, flüstere ich ihm zu und fühle mich gleich erleichtert. »Hast du mir wenigstens irgendwas Nützliches mitgebracht?«
Ein leises, raues Geräusch ist aus seiner winzigen Kehle zu hören und ich weiß genau, was es bedeutet: Hör auf, mich vollzuquatschen, und streichle mich oder ich würge dir als Zeichen meiner unendlichen Liebe gleich eine halbverdaute Maus hoch!
Schnell kraule ich seine übergroßen Lauscher, um Letzteres zu verhindern, doch unweigerlich spitze ich dabei die Lippen. »Jaaa, schon gut. Bist ein ganz Feiner, ein gaaaaaaanz Feiner!«
»Hör auf damit!!!«, faucht mich Godric scharf von der Seite an und stößt mir gegen den Arm, weshalb klein Köttels erschrocken auf meine Schulter springt und ungehalten keckert. »Ich hab dir gesagt, du sollst dich ruhig verhalten und nicht reden, wenn ich mit Kundschaft verhandle! Setz dich da hin und halt die Klappe!«
»Verzeihung, Sir. Bin ja schon still.« Rasch befolge ich, was er sagt.
»Solltest du auch! Sonst hole ich den Knebel!«
Seine Kunden sind noch immer mit Agathas Untersuchung beschäftigt, also eigentlich kann ich ihn gar nicht stören. Er hasst es aber wie die Pest, wenn ich mich mit meinem Haustier beschäftige, und dreht auch erst ab, als ich zu Boden schaue und gar nichts mehr tue.
›Elender Eselsliebhaber! Soll er doch zum Teufel gehen und sich seinen Knebel mit Schmackes in den Hin-‹
»Wie viel?«, unterbricht eine harsche, tiefe Stimme meine Gedanken und ich zucke erschrocken zusammen, derweil schwerfällige Schritte vor dem Podest stoppen. Ein ungutes Gefühl macht sich in mir breit, als ich die großen, abgenutzten, dreckigen Stiefel sehe, die sich in mein beschränktes Sichtfeld drängen. Mister Köttels stellt sich halb an meinen Kopf, faucht und buckelt, weshalb er sogar kurz von meiner Schulter rutscht.
›Das wird doch nicht ...‹
»Guten Morgen, Sir. Tja, kommt drauf an, für welche Ihr Euch interessiert. Allerdings verleihe ich meine Ware nicht. Ihr solltet also schon genügend Bares -« Ich höre einige Münzen in einem Beutel klimpern, als würde er sie provokant einmal aufhüpfen lassen, was Chapmans Satz vorzeitig beendet. Gleichzeitig atme ich auf, denn der Fremde muss ihm zu verstehen gegeben haben, dass er an einer Frau interessiert ist. »Ah! Wunderbar! Nichts für ungut, Sir, man kann ja nie wissen!«, entschuldigt sich Chapman gleich und fährt in seiner gewohnt schleimigen Schnöselart fort. »Zögert nicht, Euch die beiden dort drüben schon einmal eingehender anzusehen. Diese hier wird gerade begutachtet, aber Ihr könnt gern mitbieten, falls Ihr ebenfalls Interesse an ihr habt. Ich bin gleich für Euch da!«
Mit dieser bewusst unterschwelligen Aussage baut der gewiefte Aasgeier Druck auf das reiche Paar auf, damit sie sich schneller entscheiden, und die beiden reagieren genau so, wie er es geplant hat. Der Hausherr hebt die Hand und einer der Diener kommt mit dem Geld herbei. Dann zahlen sie den von Chapman gewünschten Preis für Mutter und Kind, ohne zu feilschen.
Solange der Sklavenhändler mit seiner Kundschaft abrechnet, schaue ich vorsichtig auf und muss feststellen, dass es tatsächlich der Holzfäller ist, der da vor uns wartet! Mein Herzrasen verstärkt sich. Der Bart scheint ihn älter zu machen, als er eigentlich ist, denn so von Nahem sehe ich kaum Falten in seinem Profil. Vielleicht Mitte dreißig? Allerdings hat er eine X-förmige, wulstige Narbe auf der Wange, die ihm einmal sehr brachial zugefügt worden sein muss. Er ist noch viel riesiger, als ich es auf die Entfernung geschätzt hatte, oder kommt es mir nur so vor, weil ich sitze? Nein ... die Bank steht ja auf einem Podest, und außerdem überragt er auch alle anderen Schaulustigen um mindestens zwei Köpfe. Dieser Mann ist wirklich ein Koloss! Ein laufender Baumstamm - oh! Wie passend.
Sein Gesicht ist von uns abgewandt, denn er beobachtet, genau wie der Rest der Traube um ihn herum, gelassen, wie sich Agatha anzieht, doch sobald sie ihre intimen Stellen wieder bedeckt hat, lichtet sich auch der Platz vor uns. Die Frauen neben mir zittern schon so sehr, dass die ganze Bank wackelt. Angsterfüllt betrachten sie den Titanen. Kein Wunder. Wenn dieser Riesenwuchs alle Teile seines Körpers betrifft, dann tut mir jede Frau leid, die mit ihm gehen muss.
Die einzige Frau in unserer Runde, die noch kein Kind geboren hat, greift sogar hilfesuchend nach meiner Hand und sieht mich mit flehenden, aufgerissenen Augen an. Ich habe schon einige unpassende Interessenten für sie vergrault, aber wenn ich mich heute wieder einmische, bin ich schlimmstenfalls meine Eier los! Trotzdem nicke ich ihr zu und streiche beruhigend mit meinem Daumen über ihre Finger.
»Nun zu Euch, mein Herr!« Godric scheint fertig zu sein, denn die von ihm zuerst bediente Kundschaft macht sich mitsamt ihrem menschlichen Einkauf auf den Weg, während er liebevoll sein prall gefülltes Ledersäcklein klöpfelt. Dabei schlendert er hinter die beiden übrigen Damen, die beinahe panisch ihre Köpfe gesenkt halten. »Also, welche wollt Ihr Euch näher anschauen?« Mit seinen speckigen Fingern greift er der Linken in den Mund und zieht ihre verkniffen aufeinandergepressten Lippen auseinander. »Diese hier ist jung, hat besonders gepflegte Zähne und noch dazu ein gebärfreudiges Becken! Folgsam ist sie auch und singen kann die, da werdet Ihr schwach! Außerdem ist sie gut erzogen und -«
»Den da. Was kostet der?«, raunt unser Gegenüber.
Mein Blut gefriert in den Adern und ich erstarre, als er tatsächlich mit seinem Daumen auf mich zeigt, ohne mich auch nur anzusehen.
›Was??? Oh nein! Nein, nein, nein! Das kann unmöglich sein! Wofür will der mich? Zum Holzhacken und Bäume schleppen wohl kaum!‹
»Marley?«, fragt auch Chapman ziemlich erstaunt nach, doch dann macht sich ein hämisches Lächeln auf seinem Gesicht breit. »Oh ja, eine gute Wahl!« Er springt verzückt hinter mich, reißt mich hoch, hält jedoch gleichzeitig die Kette an meinen Handschellen fest, damit ich die Arme nicht hochreißen kann. »Ein stattlicher junger Bursche, der auf jeden Fall einiges ... öhm ... einstecken kann!« Sein widerliches Grinsen verstärkt sich und dabei leckt er sich anzüglich über die Unterlippe.
Jetzt bin ich es, der die Damen hilfesuchend ansieht und sich am liebsten an die Bank krallen will. Auch Köttels duckt sich und legt sich flach auf meine Schulter, als wäre er ein kleiner roter Kuhfladen.
›Dieses Monstrum kann mich doch unmöglich für die Dinge wollen, die Chapman gerade angedeutet hat! Das überlebe ich nicht! Keine einzige Nacht!‹
»Dieser Bursche ist nicht zu jung und nicht zu alt für allerlei .