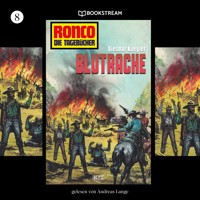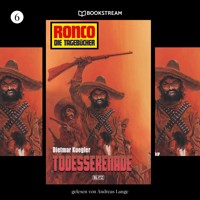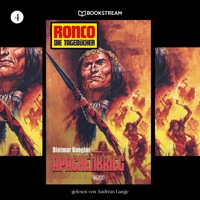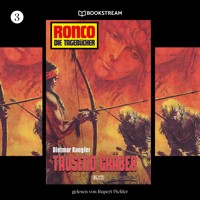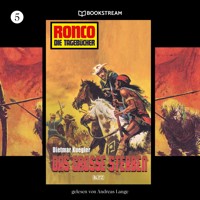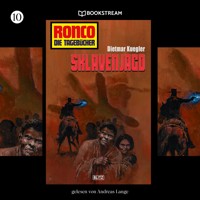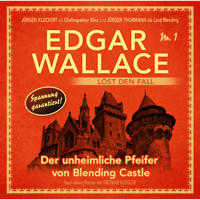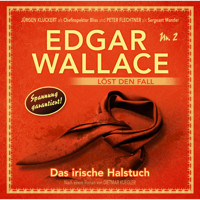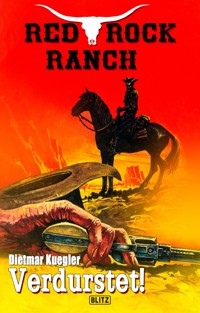
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Red Rock Ranch
- Sprache: Deutsch
US-Marshals in Arizona müssen hart sein. Aber kein Mann ist so hart wie eine Kugel. Ric Stanwell verfolgt wie ein Bluthund zwei Banditen, die eine Bank in Globe überfallen haben. Stanwell wird angeschossen. Big John Taylor findet ihn in der Wüste und rettet ihm das Leben. Die Jagd geht weiter. Big John und Stanwell müssen verhindern, dass die beiden Desperados die mexikanische Grenze erreichen und sich in Sicherheit bringen können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 171
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
IN DIESER REIHE BISHER ERSCHIENEN
VERDURSTET
RED ROCK RANCH
BUCH 2
DIETMAR KUEGLER
Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen
und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.
In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.
Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.
Copyright © 2022 Blitz Verlag, eine Marke der Silberscore Beteiligungs GmbH, Mühlsteig 10, A-6633 Biberwier
Redaktion: Alfred Wallon
Titelbild: Mario Heyer
Umschlaggestaltung: Mario Heyer
Vignette: iStock.com/iatsun
Satz: Gero Reimer
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 978-3-95719-340-7
4602
INHALT
Verdurstet
Nachwort
Arizona
Dietmar Kuegler
VERDURSTET
Die Cowboys
Bewohner von Tucson
Über der endlosen Sandfläche der Gila-Wüste lag ein seltsames Flirren und Glitzern, das die gleißenden Sonnen-strahlen verursachten, wenn sie wie glühende Pfeile auf die vom Wind glatt geschliffenen Sandkristalle trafen. Im Nordwesten zogen sich in gerader Linie die Gila Hills durch den Sand, erhoben sich aus der Weite wie gewaltige Monumente eines überirdischen Künstlers. Sie wirkten schroff und zerfurcht, spröde von der gewaltigen Hitze, und reichten bis in den glühenden Himmel, der sich ohne eine Wolke, nur flimmernd vor Hitze über -Arizona ausbreitete.
Der Mann kam von Norden und zügelte sein Pferd neben einer Gruppe von mächtigen, grauen Felsquadern, die nur kargen Schatten spendeten. Eine Vogelspinne kroch auf ihren haarigen Beinen aus einer Felsspalte und verschwand unter einem Stein.
Das Pferd des Reiters schnaubte müde. Der Mann im Sattel sah erschöpft aus. Er war fast sechs Fuß groß und hager. Sein schmal geschnittenes Gesicht war von messer-scharfen Falten durchschnitten und bedeckt mit Bartstoppeln. Seine Haut war grau vom Staub, der mit dem dick perlenden Schweiß eine feste Kruste bildete, die nun zerplatzte, als der Mann den Mund öffnete und einen leisen Fluch ausstieß.
Der Mann glitt vom Pferd. Auf seinem Hemd haftete ein silberner Stern im Kreis, das Zeichen des US--Marshals. Der Mann trug abgewetzte Kleidung, in deren Falten der feine, scharfkörnige Staub nistete und bei jeder Bewegung leise knisterte. An der Hüfte hatte der Marshal einen schweren 45er Colt hängen. Das Pferd senkte müde den Kopf. Der Mann bewegte sich einige Schritte vom Tier fort und kniete sich in den Sand. Seine schmalen Augen glitten über die Hufeindrücke. Er hob den Kopf und legte die linke Hand zum Schutz gegen die beendenden Sonnenstrahlen über die Augen.
Der Marshal schwang sich wieder in den Sattel. Leder knarrte leise. Er richtete sich auf dem Pferderücken auf. Aber er konnte keine Bewegung in der Weite wahrnehmen. Stumm trieb er sein Tier wieder an. Der Marshal ließ die Felsgruppe hinter sich. Nordöstlich in seinem Rücken befand sich ein breiter Kakteengürtel. Doch der war gut zehn Meilen entfernt. Aber diese riesigen Säulenkakteen waren die einzigen Pflanzen, die der Reiter um sich herum sehen konnte. Die glutwabernde Hitze umgab ihn wie eine breiige, zähe Masse und trocknete ihn aus. An seinem Sattel hing ein Wassersack aus Ziegenleder.
Die beiden Männer lagen flach am Rand des Arroyos und beobachteten den herankommenden Reiter. Sie lagen regungslos, registrierten jede Bewegung des anderen und sprachen kein Wort, bis der Mann auf etwa hundert Yards an die Bodenfalte heran war.
„Es ist der Marshal“, sagte einer der beiden heiser. „Er ist es sicher.“ Seine Stimme klang rau von der Hitze und dem Sand, den er geschluckt hatte. Die Männer sahen sich ähnlich. Sie waren ungepflegt, hatten knochige, unrasierte Gesichter und schmale, kalte Augen.
„Erledigen wir es jetzt“, sagte der Mann wieder. Sein Partner nickte ohne ein Wort.
„Er ist verdammt hartnäckig.“, fuhr der Mann fort. Er zog seine Winchester 73 heran. Es war ein nagelneues Modell mit dunkelbrünierten Schlossteilen.
„Er ist nicht hartnäckig, er ist stur. Stur wie ein Büffel“, entgegnete der andere Mann. „Du musst ihn gut treffen.“
„Ich treffe immer gut.“
Der Sprecher zog jetzt das Gewehr an die Schulter und repetierte rasch den Unterhebel durch. Knirschend schob sich eine Patrone aus dem Magazin in den Lauf. Durch die flirrende Hitze visierte der Bandit den heran-kommenden Marshal über Kimme und Korn an. Er tat es kaltblütig und ohne eine Gefühlsregung. Seine Hände hielten das Gewehr ruhig, und sicher krümmte sich der Zeigefinger seiner Rechten um den Abzug.
Der Karabinerschuss peitschte hell aus dem Lauf. Die Mündungsflamme verschmolz mit der gleißenden Helle der Wüstensonne. Die Detonation rollte über die Weite. Ein stinkendes Pulverwölkchen zerflatterte. Das Pferd des Marshals machte im selben Moment einen Schritt zur Seite und warf den Kopf hoch. Die Gewehrkugel traf es zwischen den Augen. Der Bandit stieß einen wilden Fluch aus und riss den Unterhebel durch. Das Pferd des Marshals taumelte, wieherte röchelnd und brach mit rötlichem Schaum vor den Nüstern in die Knie. Der Beamte wurde aus dem Sattel geschleudert, rollte kraftlos durch den Sand und raffte sich betäubt auf die Knie hoch. Im selben Moment krachte der zweite Schuss.
Der Bandit stand jetzt hoch aufgerichtet und breitbeinig am Rand des Arroyos und feuerte auf den Mann neben dem liegenden Pferd. Der Wassersack am Sattelhorn war vom Gewicht des Tieres zerquetscht worden. Sein Inhalt sickerte in den Sand und verdunstete in der Hitze binnen weniger Sekunden.
Der Marshal wollte auf das Pferd zuspringen, um sein Gewehr aus dem Sattelschuh des gestürzten Tieres zu reißen. Aber er war nicht schnell genug, und es war zu spät für ihn, viel zu spät. Der Schuss des Banditen traf ihn in der linken Schulter, nur zwei Handbreit über dem Herzen. Die Kugel wirbelte ihn von den Beinen. Der US-Marshal wollte sich halten, nicht stürzen. Aber mit unwiderstehlicher Gewalt zog es ihn auf den heißen Sand zu. Er fühlte ihn in seinem Gesicht, krallte seine Hände hinein. Glühender Schmerz jagte durch seinen Körper. Blut rann warm und feucht über seinen Oberkörper, sickerte in seine Kleidung, in den Sand.
Schweiß, dick perlender Schweiß bildete sich auf seinem Gesicht, schmeckte salzig auf den Lippen des Mannes und lief über sein Kinn. Rote, dichte Schleier wogten vor den Augen des Marshals. Seine Blicke wurden immer undeutlicher, das Rauschen und Dröhnen in seinem Kopf immer lauter. Es begann sich alles zu drehen, wahn-sinnig schnell zu drehen, grellfarbig und glühend, immer schneller. Dann war der Marshal bewusstlos und lag wie tot im heißen Sand. Dicht neben ihm lag sein Pferd, dessen Fell am Kopf mit Blut verkrustet war.
Die beiden Männer im Arroyo hatten sich erhoben. Der Schütze schob zwei neue Patronen durch den Seitenschlitz ins Röhrenmagazin und wandte sich stumm ab. Er bewegte sich hinunter ins ausgetrocknete Arroyobett zu den Pferden. Der andere schaute noch eine Weile zu dem Marshal hinüber und kam dann nach.
„Er rührt sich nicht mehr.“
„Wie sollte er auch?“ Der Schütze hatte sein Gewehr in den Scabbard zurückgeschoben. Er rückte den hell-braunen Ledersack am Sattelhorn zurecht und schwang sich auf den Pferderücken.
„Der Sand wird ihn nach und nach zudecken. Er war verrückt, uns in die Wüste zu folgen. Nach dem Bankraub in Globe hat er uns auf den Fersen gehangen. Er war ein Idiot, zu glauben, uns zu bekommen. Wir werden jetzt nach Tucson zurückreiten, Chet. Wir sind jetzt sicher. In Tucson bekommen wir alles, was wir brauchen, um durch die Gila nach Mexiko zu kommen. Ehe es Steckbriefe von uns gibt, sind wir längst in Mexiko, trinken feinen, roten Wein und lassen uns von mexikanischen Putas verwöhnen. Es wird ein verdammt feines Leben sein, Chet. Selbst wenn in dem Marshal noch ein Funken Leben ist, wird er vor Durst krepieren. So ein Idiot. Komm, Chet, wir reiten nach Tucson.“
Der andere nickte und stieg auf sein Pferd.
„Wir brauchen Wasser, Proviant und zwei neue Pferde“, sagte er.
„Wir werden ein Packpferd kaufen oder ein Maultier.“
Der andere setzte sein Tier in Bewegung und lenkte es aus dem Arroyobett. Er warf keinen Blick mehr hinüber zu seinem Opfer. Die beiden Männer ritten im weiten Bogen um den Marshal herum, überquerten am Abend den Santa Cruz River und lenkten ihre Pferde nach Norden in Richtung Tucson.
* * *
Es war am Abend, als der US-Marshal erwachte. Er war schwach, und er konnte sich nicht rühren. Sein ganzer Körper schien von einer Lähmung befallen. Hämmernder Schmerz ging von seiner Wunde aus. Die Blutung hatte aufgehört. Der Sonnenball sank wie ein gewaltiger übermächtiger Rubin am Zenit herab, und der Wind des Tages wehte nicht mehr.
Der Marshal versuchte einen klaren Gedanken zu fassen. Er versuchte zu überlegen, was er tun sollte. Doch er konnte nicht. Seine Kraft reichte nicht aus, um sich auf bestimmte Gedanken zu konzentrieren. Sofort begann es wieder vor seinen Augen zu flimmern. Er konnte nur den Kopf etwas drehen und sah sein Pferd wenige Schritte vor sich liegen. Er sah den zerplatzten Wassersack. Er meinte, verrückt zu werden vor Durst. Aber er war hilflos, hilfloser noch als ein kleines Kind, und so einsam und allein.
Einige Yards vor sich sah er eine Vogelspinne auf das tote Pferd zukriechen. Über sich hörte er ein müdes Krächzen und Flügelschlag. Er wusste, dass es Geier waren. Aber er konnte sich nicht rühren. So lag der -Marshal da, und es kam ihm vor wie eine Ewigkeit. Er glaubte hundert Mal zu sterben, nicht mehr weiterleben zu können. Doch so schwach er auch war, er lebte.
Der Marshal balancierte in diesen Stunden auf einem schmalen Grat zwischen Leben und Tod. Er war schon lange wieder bewusstlos, als auf einem Dünenkamm in etwa hundert Yards Entfernung ein Reiter auftauchte.
Der Mann im Sattel war gekleidet wie ein Cowboy. Er war groß und wuchtig. Sein dunkel gebräuntes Gesicht war von Falten zerfurcht und kühn geschnitten. Unter seinem breitkrempigen Hut hervor war graues, leicht welliges Haar mit buschigen Schläfen zu sehen. Die Blicke aus den wasserhellen Augen des Mannes glitten über die Ebene. Und im letzten Licht des vergehenden Tages sah er vor sich im Sand ein totes Pferd und dicht daneben einen Mann liegen. Er hob den Kopf und bemerkte wieder die Geier am dunklen Himmel kreisen, deren Anwesenheit ihn hergelockt hatten.
Der Reiter spuckte grimmig aus und fuhr sich mit der Zungenspitze über die trockenen, schmalen Lippen. Dann trieb er sein Pferd an. Er ritt den Dünenkamm hinunter auf die Gestalt im Sand zu. Die breiten, schwerledernen und mit silbernen Conchos und Nieten verzierten Chaps wippten an seinen Beinen im Rhythmus des Tieres. Der Reiter zügelte das Pferd vor dem Mann im Sand. Das Tier scheute vor dem Blutgeruch. Der Reiter bändigte es mit energischem Griff. Er glitt aus dem Sattel und kniete sich neben den Bewusstlosen. Vorsichtig drehte er den Mann auf den Rücken. Er sah den Stern und zuckte leicht zusammen. Lange blickte er in das fremde, hohlwangige und von Staub, Schweiß und Erschöpfung gezeichnete Gesicht. Dann ging er zu seinem Pferd zurück, nahm die Feldflasche vom Sattelhorn und hob den Kopf des Mannes leicht an. Er benetzte ihm mit der lauwarmen Flüssigkeit die Lippen. Nach einigen Minuten öffnete der Verletzte die Augen. Der Reiter ließ ihn trinken.
„Wer ... wer sind Sie ...?“, presste der Verletzte heiser hervor, nachdem er getrunken hatte. Seine Stimme klang rostig und brüchig. „Ich ...“
„Mein Name ist Taylor, John Taylor. Sie sind an der Grenze meiner Ranch, der Red Rock Ranch, Marshal. Ich habe Sie gerade gefunden, weil ich auf der Spur von drei Broncos war, die mir am Nachmittag davongelaufen sind.“
Der Rancher sprach mit sonorer, ruhiger Stimme.
Der US-Marshal atmete jetzt rasselnd. Schweißperlen erschienen wieder auf seiner Stirn. Er hob die rechte Hand und verkrallte seine Finger in das Hemd von Big John Taylor. Seine Augen glänzten fiebrig. Er zitterte am ganzen Körper. „Ich ... Mr. Taylor ... es war ...“
Seine Stimme erstarb plötzlich. Sein Kopf rollte zur Seite. Er war wieder bewusstlos geworden. Big John Taylor stieß einen Fluch aus. Er richtete sich auf. Breitbeinig stand er neben dem Mann und nagte nachdenklich auf seiner Unterlippe.
Der Marshal war angeschossen worden, ohne Zweifel. Aber von wem? Der Rancher zog fröstelnd die breiten Schultern hoch. Es war kalt in der Wüste, wenn es Nacht wurde. Big John ging zu seinem Pferd und streifte sich eine feste Cordjacke über, die er hinter dem Sattel liegen hatte. Er öffnete seine Satteltasche und holte Verbandszeug heraus. Stumm kniete er sich dann neben den US-Marshal und schnitt ihm das Hemd über der Brust auf. Er legte die Wunde frei. Es war ein großer Einschlag. Die Kugel war am Rücken wieder ausgetreten. Wenn der Mann Glück hatte, hatte das Geschoss nichts zerrissen. Vor allen Dingen durfte die Wunde nicht wieder aufplatzen. Big John Taylor arbeitete sorgfältig und bedächtig.
Es war inzwischen Nacht geworden. Das Mondlicht lag wie ein zartsilberner Mantel über der Wüste und spendete dem Rancher Licht bei seiner Arbeit. Die harten, von Lassonarben gezeichneten Hände John Taylors bewegten sich behutsam und vorsichtig. Er legte dem Marshal einen festen Verband an, erhob sich dann und sattelte das tote Pferd ab. Als er wieder vor dem Verletzten stand, öffnete der die Augen.
„Sie können nicht reiten, Marshal. Ich werde ein paar Stangen holen und eine Schleppbahre machen. Etwa drei Meilen von hier ist eine Weidehütte meiner Ranch. Dort liegen Corralstangen. Es wird nicht lange dauern, aber bis dahin müssen Sie warten.“
Der Marshal versuchte zu nicken. Aber er konnte den Kopf nicht bewegen. Big John Taylor breitete eine Sattel-decke über dem Mann aus und blickte ihm fest in die Augen. „Versuchen Sie nicht, sich zu rühren. Wenn Ihre Wunde aufbricht, werden Sie bestimmt verbluten. Sie können mir später alles erzählen.“
„Ich, ich heiße Stanwell, Ric Stanwell, Rancher. Und ... ich komme ... aus der Stadt Globe ...“, presste der Beamte hervor. Und seine Stimme klang knisternd und schwach wie ein Hauch.
„Was, zum Teufel, macht ein Marshal aus Globe in der Gila-Wüste?“, knurrte Big John Taylor. Doch der Beamte war schon wieder bewusstlos geworden. Der Rancher stampfte zu seinem Pferd und schwang sich in den Sattel. Er wendete das Tier und ließ es im raschen Trab laufen.
* * *
Während er ritt, flogen seine Gedanken. Am Nachmittag waren aus einem Corral drei Broncos ausgebrochen und in das versandete Präriegebiet geflohen, das nach dem großen Sandsturm von 1873 Wüste geworden war. John Taylor hatte es zu spät bemerkt. Er hatte sofort die Verfolgung aufgenommen und war dann auf drei andere Spuren gestoßen. Die Broncos hatte er nicht gefunden, aber einen US-Marshal aus Globe.
Wer schießt einen US-Marshal an? dachte John -Taylor. Wer ist so verrückt, einen US-Marshal anzuschießen und ihn in der Wüste liegenzulassen? John Taylor dachte an Clay, seinen ältesten Sohn, der jetzt US-Marshal in Tucson war. Und er dachte daran, was er wohl tun würde, wenn Clay eines Tages halb tot im Wüstensand liegen würde, zusammengeschossen von irgendwelchen Verbrechern.
Big John Taylor erreichte nach zwei Stunden die Weidehütte. Er stieg aus dem Sattel und schritt auf das dunkle Gebäude zu. Es war aus Adobelehm gebaut und bestand nur aus einem Raum. In einem kleinen Stall-anbau fand er einige etwa vier Yards lange Corralstangen. Er schnürte sie mit seinem Lasso zusammen und ging zu seinem Pferd zurück. Wenig später war er auf dem Weg zurück in die Wüste.
Es war gegen Mitternacht, als Big John Taylor die reglose Gestalt im Sand wieder vor sich sah. Das blasse Mondlicht warf lange Schatten von Reiter und Pferd in den Sand. Die fernen Kuppen der Gila Hills glitzerten hell, und von Nordwesten her kam auch das scharfe Bellen eines Wüstenfuchses.
John Taylor zügelte sein Pferd und stieg ab. Er sah, dass der Marshal wieder bewusstlos war. Er sah aber auch, dass er die Decke halb von sich abgestreift hatte und in seiner verkrallten Rechten den schweren Revolver hielt. Sein eingefallenes Gesicht war verzerrt. Etwa zwei Yards von ihm entfernt lag ein Geier im Sand. Um den hässlichen Vogel herum hatte sich ein dunkler Fleck gebildet.
John Taylor presste die Lippen zu einem schmalen Strich zusammen. Er hatte nicht daran gedacht, dass der Mann so hilflos war, dass er sich nicht einmal gegen Tiere wehren konnte.
Der Rancher hockte sich neben den Bewusstlosen und warf einen Blick auf den Verband. Aber die Wunde schien nicht aufgeplatzt zu sein. John Taylor atmete auf. Er beugte sich vor und entwand der Rechten des Bewusstlosen den Revolver. Die Finger hatten sich so sehr um die Waffe verkrallt, dass John Taylor Mühe hatte, sie loszubekommen. Dann hielt er den schweren Revolver des US-Marshals Ric Stanwell in seinen Händen. Er betrachtete die Waffe mit den Augen eines Mannes, der etwas davon versteht. Es war ein 45er Peacemaker-Colt mit vierdreiviertelzölligem Lauf. Das Korn war entfernt. Der Hahn war plattgehämmert. John Taylor spannte ihn. Mit leisem Klicken bewegte sich die Trommel weiter. Die Waffe hatte einen sanften Schlossgang und war erstklassig ausgewogen.
John Taylor schob die Waffe ins Holster des Marshals. Er wusste jetzt, dass der Mann ein schneller Schütze war, und es war für ihn auch klar, dass man ihn heimtückisch angeschossen hatte und nicht im Kampf. Einen solchen Mann konnte man nur heimtückisch treffen.
Big John ging zu seinem Pferd zurück und nahm die Stangen vom Sattel. Er legte sie auf den Boden und zerschnitt die Gurte vom Sattel des Marshals. Er fühlte keine Müdigkeit. Es machte seinem kräftigen Körper nichts aus, ohne Schlaf auszukommen, obwohl er kein junger Mann mehr war. Der Rancher spannte die breiten Gurte zwischen zwei Stangen. Dann ging er zu dem Verletzten und nahm die Decke weg. Der US-Marshal wachte nicht auf, als Big John ihn wieder zudeckte und mit dem Lasso auf der Schleppbahre festschnürte. Er stöhnte durchdringend. Sein Gesicht verzerrte sich. Der Rancher hielt inne und beugte sich über das bleiche Gesicht des Marshals.
„Haben Sie Schmerzen, Stanwell?“
Der Marshal antwortete nicht. Er atmete pfeifend und grub seine Zähne so tief in die Unterlippe, dass Blutstropfen hervorquollen. Schweißperlen standen auf seiner Stirn.
„Sie müssen das aushalten, Stanwell.“ Big John zurrte das Lasso fest, und der Marshal lag jetzt unverrückbar auf der Schleppbahre. „Ich habe kein Laudanum bei mir, Stanwell. Sie müssen durchhalten. Ich bringe Sie jetzt auf die Red Rock Ranch. Beten Sie, Stanwell, dass Sie keinen Wundbrand bekommen. Sie haben einen glatten Durchschuss. Wenn Sie Glück haben, bekomme ich Sie ohne Entzündung bis zur Ranch.“
„Ich, werde, werde schon durchhalten, Mister Taylor ...“ Die Stimme des Marshals war kaum zu verstehen. Der Rancher nickte. Sein Gesicht lag im Schatten der breiten Hutkrempe, und so konnte der Verwundete die Skepsis in den Augen des anderen nicht wahrnehmen. Aber wahrscheinlich hätte er sowieso nichts gesehen, denn seine Augen schwammen in Tränen. Die Schmerzen drohten ihn zu übermannen. Sie wühlten und fraßen in seinem Körper wie die Hauer eines wilden Tieres. Er stöhnte wieder schrill.
Big John Taylor presste grimmig seine Lippen zusammen und hob die Enden der Schleppbahre hoch. Er befestigte sie am Sattel. Er nahm die Feldflasche und kam zu dem Marshal zurück.
„Trinken Sie einen Schluck, Stanwell.“
Aber der US-Marshal Ric Stanwell schien ihn nicht zu hören. Seine Blicke schienen durch den Rancher hindurchzugehen.
„Die Geier ...“, flüsterte er. „Die Geier, sie kommen, die Geier ...“
Seine Stimme zitterte und vibrierte. In seinen glasigen Augen flimmerte nichts als nackte Angst. Er versuchte, sich zu bewegen. Aber er konnte nur den rechten Arm heben. Er fuhr mit ihm, irgendetwas suchend, in der Luft herum, ballte die Hand zur Faust und schrie mit brüchiger Stimme: „Die Geier kommen …“
Er schrie um Hilfe. Und sein verfallenes Gesicht war so grau wie brüchiger Schiefer. Big John Taylor blickte den anderen schweigend und mit Besorgnis an. Er legte ihm seine linke Hand auf die Stirn und fühlte den Puls des Mannes. Der Marshal hatte hohes Fieber. Er lallte etwas. Seine Stimme war zu schwach, sie klang jetzt rostig und kratzend. Sein Kopf hing kraftlos zur Seite.
John Taylor hob ihn mit der Linken leicht an und setzte dem Mann die Feldflasche an die Lippen. Der Marshal schien es nicht zu bemerken. Das Wasser rann ihm aus dem Mund. Dann verschluckte er sich und hustete. Er wurde blau im Gesicht und schloss keuchend und nach Luft ringend die Augen.