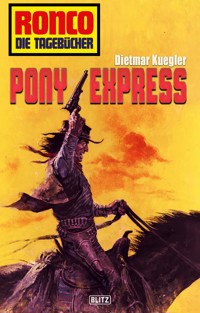
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ronco - Die Tagebücher (Historische Wildwest -Romane)
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Der Pony Express ist das größte Abenteuer auf Erden. Ich bin dabei. Für mich wurde ein Traum wahr. Doch er kann zum Albtraum werden. Gejagt von Cheyenne. Gejagt von weißen Banditen. Vor mir liegt die endlos weite Prärie. Hinter mir lauert der Tod.Ronco, der Waisenjunge, der ehemalige weiße Indianer, sucht seinen Weg im amerikanischen Westen. Sein Leben ist geprägt von Blut und Gewalt.Dieser Band enthält die folgenden Romane:Pony Express (21)Todesfracht für Laramie (22)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
RONCO
In dieser Reihe bisher erschienen
2701 Dietmar Kuegler Ich werde gejagt
2702 Dietmar Kuegler Der weiße Apache
2703 Dietmar Kuegler Tausend Gräber
2704 Dietmar Kuegler Apachenkrieg
2705 Dietmar Kuegler Das große Sterben
2706 Dietmar Kuegler Todesserenade
2707 Dietmar Kuegler Die Sonne des Todes
2708 Dietmar Kuegler Blutrache
2709 Dietmar Kuegler Zum Sterben verdammt
2710 Dietmar Kuegler Sklavenjagd
2711 Dietmar Kuegler Pony Express
2712 Dietmar Kuegler Todgeweiht
2713 Dietmar Kuegler Revolvermarshal
2714 Dietmar Kuegler Goldrausch
Dietmar Kuegler
Pony Express
Diese Reihe erscheint in der gedruckten Variante als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2020 BLITZ-VerlagRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogo: Mark FreierSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-160-1Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
Pony Express
6. August 1879.
Ich bin gefangen und sitze in einer Arrestzelle von Fort Lyon, Colorado. Die Arrestzelle ist zwei Yards lang und zwei Yards breit. Da sind eine eiserne Tür mit einer schmalen Klappe, durch die das erbärmliche Essen geschoben wird, und ein Fenster, durch das nicht mal eine fette Ratte passen würde, das aber dennoch vergittert ist. Es gibt eine Pritsche in diesem schäbigen Loch und einen stinkenden Kotkübel, der dringend mal gereinigt werden müsste. Sie nennen die Zelle den Affenkäfig.
Andere an meiner Stelle würden vermutlich Tobsuchtsanfälle kriegen. Ich nicht. Ich habe mich daran gewöhnt, mit schlimmen Situationen fertig zu werden.
Jetzt habe ich eins der Schulhefte auf den Knien. Ich hatte zuletzt darin geschrieben und es unter mein Hemd gesteckt. Man hat es mir nicht abgenommen, und so kann ich meine Geschichte weiterschreiben.
Ich schreibe mit dem bleiernen Geschosskopf einer 45er-Patrone, die ich in einer Tasche gefunden habe. Anfangs war das nicht ganz einfach, jetzt habe ich mich daran gewöhnt, und es geht ganz gut.
Zuletzt habe ich meine Erlebnisse geschildert, die ich auf meiner ersten Fahrt als Kutschenbegleitmann hatte. Danach passierte nicht viel. Das Leben ging weiter. Ich fuhr ab und zu auf dem Kutschbock mit, wenn Geldtransporte durchgeführt wurden, aber Aufregendes erlebte ich nicht.
Als das Jahr 1860 anbrach, wusste bald jeder in St. Joseph, dass die Russell, Majors and Waddell Stage Company etwas plante, und als der Schnee schmolz, war es heraus: Die Gesellschaft richtete eine Postreiterlinie ein. Die größte, die es bis dahin je gegeben hatte. Sie sollte bis nach Sacramento in Kalifornien führen, was für mich so weit entfernt lag wie der Mond.
Es gab nicht wenige Leute, die Mr. Majors, der das alles eingefädelt hatte, für verrückt erklärten und die meinten, dass es ihm nicht gelingen werde, auch nur einen einzigen Brief sicher durchzubringen. Aber es war alles gut geplant, und so schien die ganze Sache trotz der unbekannten Wildnis, die weiter westlich wartete, trotz der Indianer, die überall gegen die weißen Eindringlinge kämpften, und trotz der Banditen, die es im ganzen Land gab, ein sicheres Unternehmen zu sein.
Überall hingen Plakate aus, auf denen Reiter gesucht wurden. Um die vierzehn Jahre sollten sie sein und reiten und schießen können. Waisen bevorzugt.
Das traf alles auf mich zu, und ich sprach mit Cargo Flatt, dem Sicherheitsagenten der Company. Er meinte, was andere könnten, könnte ich schon lange, und wollte sich für mich verwenden.
Hunderte von Jungen in meinem Alter tauchten in diesen Tagen in St. Joseph auf und standen Schlange vor dem Patee House, dem Hauptquartier der Company. Die meisten wurden wieder nach Hause geschickt, aber über hundert durften bleiben und wurden bald mit großen Pferdeherden nach Westen geschickt und auf die vielen Raststationen verteilt, die Mr. Majors am Rande des Trails nach Kalifornien hatte errichten lassen. Es sollten an die 200 Stationen sein, wurde gesagt, und es wurde überall gemunkelt, dass die Company vor dem Bankrott stehe, wenn das Unternehmen scheitern würde.
Am 3. April 1860 sprengte der erste Pony-Express-Reiter, ein junger Bursche, nur wenige Jahre älter als ich, über die Main Street von St. Joseph. Ich glaube, sein Name war Johnny Frye. Er schwenkte seinen Hut und wurde von Tausenden von Menschen, die sich rechts und links der Straße gesammelt hatten, bejubelt. Eine Fähre brachte ihn über den Missouri ans andere Ufer, von wo er im Höllentempo westwärts jagte. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine Nachricht erhalten, ob ich ebenfalls als Express-Reiter akzeptiert worden war. Ich hoffte inbrünstig, dass es klappen würde, ich wünschte es mir mehr als alles andere.
Die ersten Reiter wurden wie Helden gefeiert. Sie brachten ihre Post glatt nach Sacramento durch. Ab und zu gab es Zwischenfälle auf der langen Strecke, aber sie konnten dem Unternehmen keinen Abbruch tun. Tagtäglich verließen Reiter St. Joseph, und andere trafen von Westen kommend ein.
Aber erst einen Monat später wusste ich, dass ich bald zu ihnen gehören würde ...
1.
Mein Herz pochte, als ich vor der hohen, eichenen Tür stand, auf der ein poliertes Messingschild mit dem Namen Alexander Majors prangte. Ich atmete tief durch, dann klopfte ich an.
Eine tiefe Stimme rief: „Herein!“
Ich stieß die Tür auf und betrat den Raum. Ich hatte das Gefühl, bis zu den Knöcheln in dem Teppich zu versinken, der den Boden bedeckte. Das große Büro war holzgetäfelt und mit schweren, kostbaren Möbeln ausgestattet. Ich registrierte das alles nur am Rande. Meine ganze Aufmerksamkeit nahm der Mann in Anspruch, der neben einem mächtigen Schreibtisch aus schwarzer Mooreiche stand.
Er war ungefähr sechs Fuß groß und sah kräftig aus. Seine Schultern waren breit. Sein Gesicht war schmal geschnitten und hatte strenge Züge. Unter buschigen Brauen blickten mir zwei dunkle Augen entgegen, von denen ein eigenartiges Glänzen ausging, das ich später noch häufiger bei Männern gesehen habe, die von großen Ideen besessen waren.
Er war glatt rasiert und trug sein Haar straff nach hinten gekämmt und in der Mitte gescheitelt. Sein langer Gehrock war städtisch geschnitten, aus dunkelgrauem Stoff. Darunter trug er ein blütenweißes Hemd und eine schwarze Schnürsenkelkrawatte.
Alexander Majors. Ich hatte ihn bisher nur selten gesehen. Meist erschien er sehr früh in seinem Office, bevor die anderen Angestellten ihre Arbeitsplätze aufsuchten, und meist ging er sehr spät, sodass ihn selten jemand zu Gesicht bekam. Bei der Eröffnung des Pony Express hatte ich ihn zum ersten Mal etwas länger beobachten können. Er hatte eine Rede gehalten, viel von der Gnade Gottes und von der Zivilisierung des Landes gesprochen und war danach mächtig bejubelt worden.
Jetzt stand er vor mir und musterte mich so, dass ich mich klein und hässlich fühlte.
Ich war nicht ganz ein Kopf kleiner als er und ziemlich breit und kräftig für meine vierzehn Jahre. Äußerlich wirkte ich sowieso erheblich älter, denn das Leben, das hinter mir lag, hatte Spuren hinterlassen. Innerlich und äußerlich. Ich war reifer als andere Jungen meines Alters. Mein Gesicht wies einige Falten auf, und ich hatte die Augen eines Mannes. Mein Haar war blond und fiel noch immer, seit der Zeit, die ich bei den Apachen zugebracht hatte, bis auf meine Schultern. Ich trug eine abgeschabte Leinenhose, einfache Schuhe und ein verwaschenes, farbloses Hemd, das offen über meinen Gürtel hing.
„Du bist Ronco?“, fragte Mr. Majors.
Ich beeilte mich, zu nicken. „Jawohl, Sir.“
„Ich hoffe, du weißt, wie ehrenvoll die Aufgabe ist, mit der du ab heute betraut wirst.“
„Natürlich, Sir.“
„Du sollst das Eigentum fremder Menschen befördern, die dafür viel Geld bezahlt haben. Die haben ein Recht darauf, dass du deine Arbeit gut ausführst.“
Ich nickte wieder.
„Der Weg nach Westen ist lang und hart und mit vielen Versuchungen gespickt. Manchmal wird die Post, die du zu befördern hast, wertvoll sein. Du wirst dich nie an ihr vergreifen, und du wirst verhindern müssen, dass andere sich an ihr vergreifen.“
„Ja, Sir“, sagte ich.
„Bist du getauft worden, Ronco?“
„Ja, Sir“, sagte ich. „Ich bin von Mönchen aufgezogen worden.“
„Nun“, sagte Mr. Majors. „Ich habe gehört, dass du lange Zeit unter Heiden zugebracht hast. Hoffentlich hat deine Seele dabei keinen Schaden genommen.“
Ich zog es vor, darauf lieber zu schweigen, denn ich wollte ihn nicht verärgern. Ich wusste, dass er ein sehr frommer Mann war, der täglich in die Kirche ging, stundenlang in der Bibel las und jede Ansprache mit einem Gebet beendete. Es hätte zu nichts geführt, wenn ich versucht hätte, ihm zu erklären, dass Indianer keineswegs Heiden waren, dass sie ebenfalls ihren Gott hatten, wenn er auch nicht so hieß wie der, an den Mr. Majors glaubte.
„Du bist ab heute Express-Reiter“, sagte er. „Ab heute erhältst du jeden Monat 125 Dollar Lohn. Das ist sehr viel Geld für euch Jungen, und genau wie den anderen sage ich dir, dass du dich damit in Acht nehmen und es nicht für sündige Vergnügungen verwenden sollst. Denke immer daran, dass Gott, der Herr, alles sieht, was du tust, und dass er dich eines Tages zur Verantwortung zieht, wie jeden von uns.“
Ich nickte wieder, und Mr. Majors nahm eine in Leder gebundene Bibel von seinem Schreibtisch. Er reichte sie mir, und ich nahm sie.
„Lies jeden Tag darin“, sagte er. „Das stärkt dich und befreit dich von Angst und bösen Gedanken. Wenn du den Weg des Herrn gehst, wird sein starker Arm immer schützend über dir sein.“
Er drehte sich um und holte hinter dem Schreibtisch einen brandneuen Sharps-Karabiner hervor, den er mir ebenfalls in die Hand drückte.
„Damit wirst du das dir anvertraute Gut verteidigen“, sagte er.
Er langte unter seinen Gehrock und zog einen nagelneuen Navy-Colt hervor. Die bläulich schimmernde Brünierung glänzte wie eine Speckseite. Er wollte weiterreden, aber ich unterbrach ihn.
„Verzeihung, Sir“, sagte ich. „Aber ich möchte meinen Revolver behalten.“
Ich zog meinen Navy-Colt unter dem Hemd hervor. Es war eine stark gebrauchte Waffe mit fleckiger Brünierung und ein paar Rostnarben. Der scharfe Geruch von Pulverdampf haftete ihr an, und auf dem zerbeulten Griff war der Stempel El Moro Prison Guard zu erkennen, der bewies, dass die Waffe einmal einem Wachtposten in einem Straflager in Colorado gehört hatte.
Mr. Majors warf einen Blick darauf, wirkte seltsam berührt und steckte den neuen Revolver wieder weg.
„Also gut“, sagte er. Einen Moment wirkte er etwas verwirrt. Ich hatte ihn wahrscheinlich aus dem Konzept gebracht. „Eine Waffe kann wie ein Freund sein, wenn man in einem so gefährlichen Land unterwegs ist. Dann muss man sich darauf verlassen können. Ich verstehe, dass du dich mit einer Waffe, die du kennst, sichererer fühlst.“
Er fuhr fort: „Nichts darf dich aufhalten. Du reitest so schnell, wie du kannst, denn die Menschen, die sich uns anvertrauen, wollen ihre Post schnell befördert wissen. Gehe hin in Frieden und tue deine Pflicht.“
Ich durfte gehen, sagte: „Danke, Sir“, und verließ das Office. Die Bibel in der Linken, den Sharps-Karabiner in der Rechten, schritt ich den Gang hinunter zum Ausgang.
Jetzt war ich Pony-Express-Reiter, wie ich es mir gewünscht hatte. Dennoch fühlte ich mich nicht ganz glücklich. Eine seltsame Beklommenheit erfüllte mich für einige Minuten. Ich dachte an die Worte von Alexander Majors und begriff, dass mir eine große Verantwortung übertragen worden war. Ich hoffte, dass ich damit fertig werden würde.
Als ich auf den Wagenhof hinaustrat, blendete mich die Vormittagssonne. Ich winkte einem der Kutscher zu, der neben einer wuchtigen Concord-Kutsche stand, die gerade abfahrbereit gemacht wurde.
„Hat es geklappt?“, fragte einer der Stallknechte, als ich die Treppe zu meiner Kammer hinaufstieg, die über den Ställen lag.
„Sicher, was denkst du“, sagte ich.
In der Kammer wartete Shita auf mich. Er blickte mir aus seinen großen runden Augen entgegen und wedelte mit dem Schwanz. Erwartungsvoll kläffte er mich an. Ich lehnte den Sharps-Karabiner gegen den wackligen Tisch und hockte mich neben Shita auf den Boden.
„Hör zu“, sagte ich. Er musterte mich, und ich wusste, dass er jedes Wort verstand.
„Wir werden uns jetzt trennen“, sagte ich. „Nicht für lange, aber es muss sein. Ich würde dich gern mitnehmen, aber so schnell kannst du nicht laufen, wie ich reiten muss. Du würdest womöglich unterwegs liegen bleiben, und wegen dir anhalten, das darf ich nicht. Also wirst du hierbleiben. Alle werden sich um dich kümmern, bis ich wieder zurück bin.“
Er hatte aufgehört, mit dem Schwanz zu wedeln, und rückte ein Stück von mir ab. Traurig schaute er mich an. Er winselte leise und vorwurfsvoll und fuhr sich unruhig mit der Zunge über die schwarze Nase.
„Ja, ich weiß, zum Teufel, es gefällt dir nicht. Mir gefällt es auch nicht. Aber ich muss meine Arbeit tun.“ Ich strich ihm über den Kopf.
Er duckte sich jedoch, klemmte den Schwanz zwischen die Beine und ging steifbeinig in eine Ecke der Kammer, wo er sich einfach zu Boden plumpsen ließ, den Kopf zwischen die ausgestreckten Vorderpfoten legte und starr zur Wand blickte, ohne mich weiter zu beachten.
„Verdammt noch mal“, sagte ich. „Was ist denn schon dabei? Ich bin ja bald wieder zurück. Stell dich nicht so an. Ich bin nicht zum Vergnügen auf der Welt. Du willst regelmäßig deinen Knochen. Dafür muss ich schließlich auch was tun.“
Er war beleidigt. Da konnte ich nichts machen. Ich kannte ihn. Ich erhob mich und ging zur Tür. Den Sharps-Karabiner nahm ich mit. Er schielte mich an.
„Tut mir leid, alter Junge“, sagte ich.
Dann ging ich hinaus, und irgendwie war mir nicht wohl zumute, dass ich ihn zurücklassen musste. Wir waren seit fast einem Jahr zusammen und in dieser Zeit eigentlich nie getrennt gewesen. Shita war mein Freund, einen besseren hätte ich mir nicht wünschen können. Wenn er nicht bei mir war, fehlte etwas. Aber ich konnte ihn wirklich nicht mitnehmen.
Ich begab mich in das neu errichtete Express-Depot seitlich der Stallgebäude und Remisen. Hier lieferte einmal am Tag ein Clerk die zum Transport aufgegebene Post an, sauber gebündelt und sorgfältig gestempelt. Es waren auf sehr dünnem Papier geschriebene Briefe, denn sie durften nicht schwer sein. Ein Brief bis nach San Francisco kostete fünf Dollar Gebühr, mindestens, je nach Gewicht; das war ein kleines Vermögen.
Der Depot-Agent führte mich zu einer riesigen Landkarte, die neben seinem Schreibtisch an der Wand hing. Hier waren sämtliche Pferdewechselstationen eingezeichnet. Ich hatte eine Strecke von etwas mehr als siebzig Meilen vor mir, die ich im Laufe von höchstens zwölf Stunden zurücklegen musste. Dann war ich in Rock Creek Station in Nebraska. Dort würde ein anderer Reiter die Post übernehmen und weiterreiten bis Liberty Farm, wo wieder gewechselt wurde. Ich würde mit der Gegenpost zurückkehren. Die größeren, weiteren Ritte durfte ich erst durchführen, wenn ich mich bewährt hatte. Zwar war ich der Meinung, dass ich das längst hatte. Aber es gab keine Ausnahmen.
Nachdem ich mir die Route eingeprägt hatte, erhielt ich meine Mochilla, den Sattelüberwurf aus leichtem Leder, der viele Packtaschen hatte. Die Mochilla wurde über den normalen Reitsattel geworfen. Die verschließbaren Taschen rechts und links waren bereits mit Post prall gefüllt. Ich schleppte die Mochilla mit, als der Agent mich zu den Pferden führte. Es waren besonders ausgewählte Tiere, die robust, unempfindlich, außergewöhnlich schnell und zäh sein mussten. Zur Eröffnung des Express-Dienstes hatte die Company über 500 dieser Tiere angeschafft, die auf die verschiedenen Wechselstationen verteilt worden waren.
Ein paar Reiter standen herum, als wir den Stall betraten. Ich kannte sie. Die meisten waren so alt wie ich, sahen aber jünger aus, obwohl auch ihnen anzusehen war, dass sie kein einfaches Leben hinter sich hatten. Ein hagerer, pickelgesichtiger Bursche mit langen schwarzen Haaren trat auf mich zu. Das war Johnny Frye, der den ersten Postritt durchgeführt hatte. Er schüttelte mir die Hand und wünschte mir Glück.
„Kurz vor Rock Creek musst du aufpassen“, sagte er. „Da ist ein verdammtes Tal, lauter Wald, du kannst keine fünfzig Yards weit sehen. Danach viele Hügel. Eine lausige Gegend. Wenn dir jemand an den Kragen will, dann dort. Außerdem ist der Boden weich. Eine Menge Präriehundbauten. Bleib am besten auf der Wagenstraße. Die Radspuren sind deutlich sichtbar. Nimm keine Abkürzung.“
Ich nickte und bedankte mich. Dann sattelte ich das Pferd, das der Agent mir gab, und ich führte es aus dem Stall.
Die Sonne stand bereits hoch. Ich schwang mich in den Sattel. Spätestens gegen Mitternacht sollte ich in Rock Creek Station sein. Ich hatte mir zum Schutz gegen die Sonne und eventuellen Regen einen Hut aufgesetzt, den ich mir jetzt fest in die Stirn drückte. Den Karabiner schob ich in einen Scabbard. Dann trieb ich das Pferd an, ritt vom Hof und lenkte es zum Hafen hinunter.
Ein paar Menschen blieben auf der Straße stehen, als ich vorüberritt. Sie schauten mir nach. Ich fühlte ihre Blicke und genoss es. Ich war aufgeregt, als würde ich meinen ersten Ritt unternehmen. Dabei hatte ich bereits abenteuerlichere und gefährlichere Erlebnisse hinter mir und oft genug Kopf und Kragen riskiert. Dagegen war das, was mir jetzt bevorstand, der reinste Spazierritt – dachte ich. Aber es war einfach ein gutes Gefühl, wieder ein Pferd unter mir zu haben, wieder einmal die große Stadt verlassen zu können, in die Ebene hinausjagen zu dürfen, die Luft der Prärie zu atmen, die nach grenzenloser Freiheit, nach Wildheit und Kraft schmeckte, die mich an die Zeit erinnerte, da ich ein Teil der Wildnis gewesen war, ein weißer Apache.
Ich hörte nicht darauf, was der Fährmann sagte, der mich über den Missouri brachte. Ich hatte es eilig. Und als ich die weite Savanne vor mir sah, beugte ich mich im Sattel vor und trieb mein Pferd an.
2.
Seit acht Stunden war ich unterwegs. Gerade ging die Sonne unter. Ich hatte keine Sekunde gerastet, seit ich St. Joseph verlassen hatte. Bis zum Spätnachmittag war ich der ausgefahrenen Wagenstraße gefolgt. Dann war ich ins offene Gelände ausgewichen, wie die Landkarte im Depot in St. Joseph es mir vorschrieb. Lange Zeit war das Land eben und übersichtlich gewesen. Jetzt buckelten sich flache Hügelrücken vor mir, die der glutrote Schein der Abendsonne in mächtige schwelende Aschehaufen zu verwandeln schien.
Das Land war menschenleer und still. Ich war allein, nur mein eigener Schatten folgte mir. Ich spürte meinen Körper kaum noch. Die verkrampfte Haltung, in der ich seit Stunden im Sattel saß, hatte ihn fast gefühllos werden lassen.
In stetigem Tempo jagte ich dahin. Das Pferd unter mir zeigte keinerlei Ermüdungserscheinungen. Es griff kräftig aus wie bei Beginn des Ritts. Das Hügelland rückte näher. Ich tauchte darin unter. Die Dämmerung wurde immer dichter, ein kühler Wind strich mir entgegen. Nach der brütenden Hitze des Tages war es angenehm. Der Schweiß auf meinem Gesicht trocknete.
Die Nacht sank über das Land. Eine schmale Mondsichel spendete bleiches Licht, das mir aber völlig ausreichte, um die Landschaft zu erkennen.
Ich ritt Stunde um Stunde. Als ich vor mir das graue Band der Wagenstraße wieder auftauchen sah, das sich in zahllosen Windungen durch das weite Grasland Nebraskas schlängelte, wusste ich, dass ich es nicht mehr weit bis zur Rock Creek Station hatte.
Nur wenig später entdeckte ich das Feuer.
Ein glutrotes Brandmal stand am Himmel. Flammen fraßen ein hässliches Loch in die schwarze Decke der Nacht.
Ich zügelte das Pferd und hatte jäh ein flaues Gefühl im Magen. Als ich mich im Sattel aufrichtete, verspürte ich einen scharfen Schmerz in meinen steif gewordenen Gelenken.
Ich wusste nicht, was das Feuer zu bedeuten hatte, aber instinktiv spürte ich, dass es mich etwas anging. Dort, wo es brannte, musste die Rock Creek Station liegen. Ich war nie dort gewesen, aber ich war mir ganz sicher.
Es hatte schon bei früheren Ritten Schwierigkeiten mit Indianern gegeben, aber die Reiter waren immer damit fertig geworden.
Merkwürdig. Ich dachte in diesem Moment nur an Indianer. Daran, dass das Feuer eventuell etwas mit weißen Banditen zu tun haben könnte, glaubte ich nicht eine Sekunde. Für Banditen gab es auf einer Pferdewechselstation nicht viel zu holen, nur die Reiter waren interessant, denn sie trugen die teilweise wertvolle Post bei sich. Für Indianer aber mussten die Raststationen eine Bedrohung darstellen. Sie standen für den Fortschritt der Besiedelung, die die Stämme mehr und mehr aus ihren Jagdgründen verdrängte.
Das war etwas, was ich verstand, und wahrscheinlich dachte ich deshalb sofort an einen Überfall von Indianern. Meine Gedanken waren noch die eines weißen Indianers, in vielen Fällen zumindest. Das trennte mich noch immer von der Welt der Weißen, in die ich sonst wieder zurückgefunden hatte. Ich war nicht traurig darüber.
Ich überlegte, ob ich weiterreiten sollte. Dann besann ich mich auf meine Aufgabe. Egal was geschah, ich hatte in jedem Fall weiterzureiten und alles zu versuchen, die mir anvertraute Post durchzubringen.
Ich beugte mich wieder im Sattel vor und trieb das Pferd an. Es verfiel rasch wieder in seinen gewohnten Laufrhythmus. Dumpf hämmerten seine Hufe auf den harten Boden des Wagenweges.
Das Feuer vor mir war fast so etwas wie ein Wegweiser. Es wurde etwas kleiner, blieb aber gut zu sehen, bis die Station am Rock Creek vor mir auftauchte. Da wusste ich, dass ich mich nicht geirrt hatte. Brennende Ruinen waren alles, was von ihr übrig geblieben war.
*
Ich durchritt die Furt des Rock Creek ein Stück unterhalb der Station. Schäumende Gischt spritzte unter den Hufen meines Pferdes auf. Als ich es die Uferböschung hinauftrieb, sah ich den ersten Toten.
Er lag am Rand des Hofes der Station, unmittelbar neben einem Corral, dessen Gattertor eingerissen worden war. Er lag mit dem Gesicht nach unten am Boden. Die linke Hand war noch im Tode um die unterste Corral-Stange gekrampft, die Rechte hatte sich in den Staub gekrallt. Der gefiederte Schaft eines Pfeiles ragte aus dem Rücken des Mannes. Das Hemd war dunkel von Blut.
Die Indianer waren verschwunden. Auf dem Hof hielt ich das Pferd an und rutschte aus dem Sattel. Erst jetzt wurde mir bewusst, wie erschöpft ich war. Ich fühlte mich leer und ausgebrannt: Ein Ritt von fast zwölf Stunden lag hinter mir. Zwölf Stunden ohne Pause im Sattel. Ich verspürte Hunger und Durst und hatte mich schon auf das weiche Bett der Station gefreut.
Davon konnte jetzt keine Rede mehr sein.
Eine Wand des brennenden Stalles war noch nicht zusammengestürzt. Dort stieß ich auf die Leiche eines jungen Burschen; vermutlich war es der Postreiter, der mich ablösen sollte.
Der tanzende, flackernde Feuerschein verlieh ihm etwas unheimlich Lebendiges. Er lehnte mit dem Rücken an der Stallwand. Eine Kriegslanze hatte seine Brust durchbohrt und ihn gegen das Holz genagelt. Sie hatten ihm die ganze Kopfhaut abgezogen. Unweit von ihm entdeckte ich eine Frauenleiche.
Es waren Cheyenne gewesen. Ich war ganz sicher. Die Fiederung der Pfeilschäfte verriet es, und hier, im südlichen Nebraska, hatten sie noch ihre Jagdgründe. Als ich im vorigen Jahr als Begleitmann in einer Kutsche mitgefahren und zum ersten Mal in Nebraska gewesen war, hatte es bereits Zusammenstöße mit ihnen gegeben. Es war damals das erste Mal gewesen, seit ich von einem weißen Waffenschmuggler von den Apachen verschleppt worden und zwangsweise wieder in die Welt der Weißen zurückgebracht worden war, dass ich wieder gegen Indianer gekämpft hatte.
Die Cheyenne waren mir fremd gewesen, aber sie hatten die gleiche Hautfarbe wie jene, denen ich mich einmal zugehörig gefühlt hatte, die mich einst in die Geheimnisse der Wildnis eingeführt und mich gelehrt hatten, zu kämpfen und zu überleben. Die Sache hatte mir damals einiges Kopfzerbrechen bereitet. Aber ich hatte begriffen, dass ich mir in diesem Land Gewissensbisse dieser Art nicht leisten durfte. Ich musste gegen jeden kämpfen, der mein Leben bedrohte. Das war die Regel. Es hatte nichts mit Zuneigung oder Abneigung zu tun. Ich hatte viele Menschen getroffen, die alle Indianer hassten, aber es gab auch viele, die keine Unterschiede zwischen der Hautfarbe machten. Sie unterschieden zwischen Freunden und Feinden, nicht zwischen Weißen und Indianern. Sie kämpften, wenn sie gezwungen waren, ihr Leben zu verteidigen; und dabei war es ihnen egal, welche Farbe ihr Gegner hatte. Und sie teilten ihre Mahlzeiten und ihr Lager mit jedem, der ihr Freund war.
Ich ging auf dem Hof umher. Der Wind wurde stärker und drückte den Rauch herunter. Er wirbelte glühende Ascheteilchen zum Flussufer. Ein paar trafen mich im Gesicht, und ich schrie auf vor Schmerz.
Rasch lief ich zum Brunnen hinüber, zog einen Eimer mit Wasser herauf, kühlte meine Wangen und wusch mir den Schweiß ab. Krachend brach hinter mir die letzte Stallwand zusammen. Der Tote mit der Lanze in der Brust wurde von den glühenden Trümmern begraben. Es stank nach verbranntem Fleisch.
Ich konnte nichts mehr tun. Die Cheyenne hatten ganze Arbeit geleistet. Sie hatten die Pferde der Station mitgenommen und offenbar auch alles andere, was sie verwerten konnten.
Ich ging zurück zu meinem Pferd und nahm es am Zügel. Es stand mit hängendem Kopf da und atmete geräuschvoll. Es sah verdammt müde aus. Fast zwölf Stunden war es ununterbrochen galoppiert. Es hatte alles gegeben, was an Kraft und Ausdauer in ihm steckte.
Ich strich ihm durch die Mähne und führte es hinunter zum Fluss. Hier rupfte ich Grasbüschel aus, nachdem ich ihm den Sattel abgenommen hatte, und rieb sein schweißbedecktes Fell trocken. Dann ließ ich ihn saufen.
Nachdenklich hockte ich mich zu Boden. Was erwartete mich, wenn ich weiterritt. Was sollte ich tun, wenn Indianer auftauchten? Das Pferd war erschöpft. Bis zur nächsten Station waren es mindestens dreißig Meilen. Dreißig Meilen durch ein Land, das ich nicht kannte.
Einmal dachte ich daran, umzukehren. Aber nur sehr kurz. Ich war erledigt, wenn ich das tat. Es gab kein Zurück.
Hinter mir sank das Feuer in sich zusammen. Der scharfe Brandgeruch hing zäh in der Luft. Der Wind vermochte nicht, ihn zu vertreiben.
Ich erhob mich, hob die Mochilla auf und legte sie dem Pferd wieder auf den Rücken. Es war ein gutes Tier. Es schnaubte nur leise, und es klang vorwurfsvoll.
Ich sagte: „Tut mir verdammt leid, mein Lieber. Aber ich kann schlecht zu Fuß weitergehen und mir den Sattel selbst auf den Buckel binden. Du kannst auch nicht allein hierbleiben. Die Burschen in St. Joseph würden mir schön was erzählen, wenn ich ohne dich zurückkehrte. Die sind bei so was sehr eigen, weißt du. Ich bin auch hundemüde, aber wir müssen einfach weiter. Es geht nicht anders, klar?“
Es schnaubte abermals. Ich zurrte die Sattelgurte fest, stieg auf, lenkte das Pferd wieder die Uferböschung hinauf und ritt über den Hof der Station, vorbei an den Toten und den Ruinen. Ich ritt jetzt langsam, denn ich wollte das Tier nicht zu Tode hetzen. Die Prinzipien des Express-Dienstes galten jetzt nicht mehr. Schnelligkeit war jetzt unwichtig, wichtig war, dass ich sicher mit der Post mein Ziel erreichte.
Mein Ziel?
Ich wusste nicht einmal genau, wo das war. Die nächste Station nannte sich Liberty Farm. Ich hatte mir ihre Lage auf der Karte gut eingeprägt. Dennoch würde es nicht einfach sein, sie zu finden, denn ich kannte das Land nicht.
Es musste jetzt Mitternacht sein. Wenn ich die Kräfte des Pferdes gut einteilte, konnte ich gegen Mittag des nächsten Tages Liberty Farm erreichen.
Das Hügelland, von dem die Rock Creek Station umgeben wurde, öffnete sich vor mir. Im silbrigen Mondlicht sah ich eine tellerartige Ebene vor mir liegen, die im Süden von einem lang gestreckten düsteren Waldgürtel begrenzt wurde. Nach Norden hin war sie völlig offen und schien in einer finsteren Unendlichkeit zu versinken.
Ich ritt auf die Ebene hinaus. Fast gleichzeitig sah ich die Indianer. Es war unmöglich, auszuweichen. Es hatte auch keinen Sinn, umzudrehen und zu versuchen, irgendwo Deckung zu finden. Auch sie hatten mich bereits entdeckt und lenkten ihre Ponys in meine Richtung.
Sie waren zu dritt. Ich vermutete, dass es sich um Kundschafter handelte, während die anderen Krieger irgendwo in der Nähe rasteten.
Ich bemühte mich, so ruhig wie möglich zu bleiben, ließ aber den Sharps-Karabiner im Scabbard stecken und rührte auch meinen Revolver nicht an. Ich ritt einfach weiter, als seien sie gar nicht da. Bis sie unmittelbar vor mir ihre Pferde zügelten, mir den Weg versperrten und mich damit zum Halten zwangen.
Wir musterten uns schweigend.
Die drei waren noch jung. Sie hatten Wildlederhosen mit langen Fransen an den Nähten an. Einer trug lediglich eine Lederweste über dem breiten Oberkörper, die seine muskulösen Arme freiließ. Der zweite trug einen bestickten Fellumhang, und der dritte hatte eine hüftkurze Armeejacke angezogen, die vermutlich von einem toten Soldaten stammte. Auf den Ärmeln waren zwei gelbe Streifen aufgenäht. Der Mann trug außerdem einen etwas zerbeulten Zylinder auf dem Kopf. Die beiden anderen hatten Federn im Haar stecken, das sie alle drei zu Zöpfen geflochten hatten.
„Hokahey, Weißauge“, sagte einer in kehligem, schwer verständlichem Englisch. „Du bist Ponyreiter?“
Er grinste breit, auch die anderen grinsten und musterten mich, als wollten sie mich gleich am Spieß braten und mit Haut und Haaren verspeisen.
Wie schon im vergangenen Jahr, als ich zum ersten Mal Cheyenne-Kriegern gegenübergestanden hatte, fiel mir auch diesmal wieder auf, wie groß der Unterschied zwischen ihnen und den Apachen war, deren Stammesbruder ich gewesen war.
Apachen waren meist klein, drahtig und gedrungen. Sie hatten breitflächige Gesichter und schmale, leicht schräg stehende Augen.
Diese Krieger vor mir waren durchweg hochgewachsen und athletisch gebaut. Sie hatten ovale, gut geschnittene Gesichter mit markanten Zügen.
Ich überlegte fieberhaft, was ich sagen sollte. Alles hing davon ab, wie ich mich jetzt verhielt. Ich hatte nur eine Chance, wenn es mir gelang, sie zu überrumpeln. Dazu aber musste ich sie erst einmal ablenken und sie verblüffen. Ich kannte mich aus mit Indianern. Mochten sie sich auch äußerlich noch so sehr unterscheiden, in vielen Dingen waren sie sich ähnlich.
So, als hätte ich die Worte des Kriegers gar nicht gehört, griff ich zu einer Tasche meiner Mochilla und zog die in Leder gebundene Pony-Express-Bibel heraus, die ich von Mr. Majors erhalten hatte. Mir stand der Schweiß in dicken Tropfen auf der Stirn, aber ich ließ mir meine innere Erregung nicht anmerken. Als ich kurz hochschielte, sah ich, dass mein seltsames Benehmen bereits Wirkung zeigte. Die drei Krieger beobachteten mich erstaunt und sichtlich neugierig. Ich klappte die Bibel blindlings auf und hoffte nur, dass es mir gelingen würde, die Aufmerksamkeit der Cheyenne lange genug abzulenken.
Erst jetzt sah ich, dass ich die Bibel beim Psalter aufgeschlagen hatte. Der einhundertvierzigste Psalm befand sich direkt vor meiner Nase. Ich überlegte nicht lange, sondern begann mit dröhnender Stimme, einer Stimme, die nicht mir zu gehören schien, zu lesen.
„Errette mich, Herr, von den bösen Menschen, behüte mich vor den frevelnden Leuten, die Böses gedenken in ihrem Herzen und täglich Krieg erregen!“
Ich schrie geradezu, hielt die Bibel in der Linken und fuchtelte mit der Rechten drohend in der Luft herum. Die Krieger waren tief beeindruckt. Ich sah es an ihren erstarrten, ernsten Gesichtern und geweiteten Augen.
Vor meinen Blicken verschwammen die Buchstaben, begannen die Zeilen zu tanzen. Ich versuchte, weiterzulesen. Es gelang mir nicht. Ich stotterte ein wenig, und plötzlich war der Krieger mit dem Zylinder neben mir, beugte sich im Sattel vor und riss mir die feine, nagelneue Bibel aus den Händen. Er blätterte darin herum, schnüffelte daran wie ein Hund an einem Knochen und stieß dann ein lautes Gelächter aus.
„Du, Ponyreiter!“ Er lachte und tippte sich mit dem Zeigefinger der Linken an die Stirn. Dann riss er plötzlich mehrere Seiten aus der Bibel, zerknüllte das Papier, zog sein Messer und spießte die Bibel auf. Er wirbelte sie hoch über seinen Kopf und lachte dröhnend.
Ich fand das gar nicht komisch, aber ich hatte mein Ziel erreicht. Die beiden anderen Krieger lachten ebenfalls und starrten nur auf die Bibel, nicht auf mich.
Ich zog meinen Navy-Colt unter dem Hemd hervor und schoss, ohne zu zögern.
Die dumpfe Detonation hallte durch die Nacht. Sie übertönte das Lachen der Cheyenne-Krieger. Der Bursche mit dem Zylinder hatte kein Gesicht mehr, als er rücklings aus dem Sattel stürzte. Er ließ meine Bibel fallen und begrub sie unter sich, als er am Boden aufschlug.
Da hatte ich den Revolver schon herumgeschwenkt und schoss den zweiten Krieger aus dem Sattel.
Die Kugel erwischte ihn eine Handbreit über der Gürtelschnalle. Er schnaufte satt, als er ganz langsam nach hinten kippte. Sein Gesicht verzerrte sich. Er presste beide Hände auf den Leib, und als er am Boden lag, quoll das Blut aus der großen Wunde zwischen seinen Fingern hervor. Er wälzte sich durch das Gras und stieß ein geradezu tierisches Gebrüll aus.
Ich spannte abermals den Hammer des Revolvers und duckte mich gleichzeitig im Sattel. Mein Pferd scheute, und das rettete mir das Leben. Der dritte Indianer schoss aus einer altertümlichen Steinschlosspistole auf mich. Das Geschoss strich sengend an meinem Kopf vorbei. Ich hatte einige Mühe, mein Pferd zu beruhigen, und der dritte Krieger hatte Gelegenheit, seinen Tomahawk aus dem Gürtel zu reißen und auf mich loszugehen.
Ich feuerte und traf sein Pferd in den Kopf. Es brach wie vom Blitz getroffen zusammen. Der Krieger vermochte sich nicht rechtzeitig aus dem Sattel zu werfen. So wurde sein linkes Bein unter dem Pferdeleib festgeklemmt. Er konnte sich nicht erheben. Dafür schleuderte er mit einem Wutschrei seinen Tomahawk, aber hinter dem Wurf steckte zu wenig Kraft. Das Beil trudelte an mir vorbei. Ich trieb mein Pferd an und ritt den Mann nieder, den ich in den Bauch geschossen hatte und der sich gerade wieder erheben wollte.
Die breite Brust meines Pferdes rammte ihn mit voller Wucht und wirbelte seinen Körper ein paar Schritte weit durch die Luft. Sein gellendes Geschrei brach ab. Er plumpste wie ein nasser Sack zu Boden und blieb reglos liegen, während ich mich weit im Sattel vorbeugte und über die Ebene westwärts sprengte.
3.
Sie jagten mich. Der Kriegerverband, dem die drei Kundschafter angehört hatten, musste in der Nähe gerastet haben. Offenbar waren die Krieger nach dem Überfall auf die Rock Creek Station nicht mehr sehr weit geritten, um die Beute zu verteilen.
Jetzt waren sie hinter mir her.
Knapp eine halbe Stunde nach dem Kampf mit den drei Cheyenne hatte ich sie bemerkt. Es war eine ganze Horde. Fünfzehn oder vielleicht sogar zwanzig Krieger. Als ich einmal auf einem Hügelrücken angehalten und zurückgeschaut hatte, hatte ich sie gesehen.
Meine Chancen standen schlecht. Das Pferd würde eine Verfolgungsjagd nicht lange durchhalten. Ich auch nicht. Ich war übermüdet, und in meinem Magen wühlte der Hunger.
Meine Chance war die Nacht, war die Hoffnung, dass die Cheyenne die Gebräuche des Pony Express kannten und vermuteten, dass die Express-Reiter immer denselben Trail benutzten. Sie würden annehmen, dass ich schnurgerade nach Westen reiten würde wie alle Pony-Express-Reiter, die diesen Weg benutzten, wenn sie Rock Creek Station verlassen hatten. Sie würden sich nicht damit aufhalten, den Boden nach Spuren abzusuchen. Wenn ich die vorgeschriebene Route verließ, würden sie es wahrscheinlich zunächst einmal gar nicht merken. Zumindest so lange nicht, wie ich benötigte, um einen guten Vorsprung herauszuholen.
In einer Bodenfurche zog ich das Pferd herum und ritt nach Norden. Es war nur eine vage Hoffnung, die Cheyenne damit abschütteln zu können, aber es war die einzige Hoffnung, die mir blieb.
Ich lag fast flach auf dem Pferdehals.
„Lauf“, flüsterte ich und musste mich zusammenreißen, um dem ausgepumpten Tier nicht die Absätze in die Weichen zu hämmern. „Lauf, solange du kannst. Sie dürfen nicht merken, dass wir nicht mehr nach Westen reiten.“
Die Bodenfalte war lang, und als ich gezwungen war, sie zu verlassen, bot sich mir eine Hügelkette als Deckung an.
Die ganze Zeit über redete ich auf das Pferd ein. Ich fluchte, schmeichelte, bettelte und lobte. Ich nahm alle erdenklichen Haltungen an, um dem Tier meine Last zu erleichtern. Ich versuchte alles, nur damit es durchhielt.
Es hielt durch. Schaumflocken flogen von seinem Maul, als nach ein oder zwei Stunden ein Waldgebiet vor uns auftauchte. Seine Flanken waren schweißbedeckt.
Ich ritt noch bis zum Waldrand, dann hielt ich an und rutschte steifbeinig aus dem Sattel. Meine Augen schmerzten. Sie waren mir während des Ritts immer wieder zugefallen. Es fiel mir schwer, sie weiter offenzuhalten.
Ich spähte über die flache Savanne nach Süden. Wie lange ich so dastand und durch die Nacht starrte, bis in der Ferne die Hügelkette vor meinen Blicken zu tanzen begann, wusste ich nicht. Als meine Augen zu tränen begannen, senkte ich den Kopf und wandte mich ab. Alles blieb ruhig. Ich hatte es geschafft. Meine Verfolger mussten weiter nach Westen geritten sein. Sie hatten nicht gemerkt, dass ich nicht mehr vor ihnen war. Vermutlich würden sie es erst bei Tagesanbruch feststellen, dann zurückreiten und meine Spur suchen. Aber bis dahin hatte ich noch lange Zeit.
Ich nahm das Pferd am Zügel und zog es hinter mir her, als ich das dichte Gehölz am Waldrand durchbrach und ins Unterholz eindrang. Auf einer Lichtung blieb ich stehen und nahm dem Tier die Mochilla ab.





























