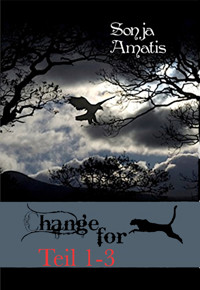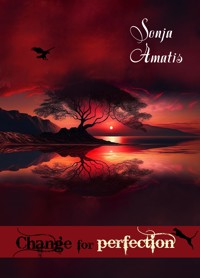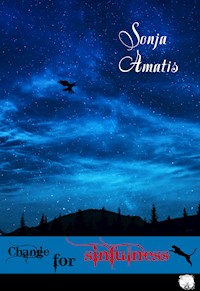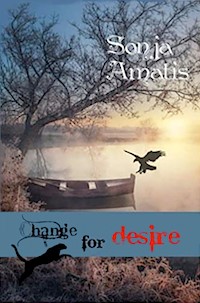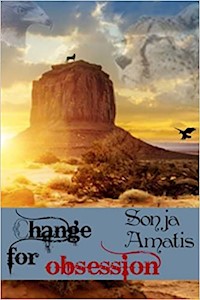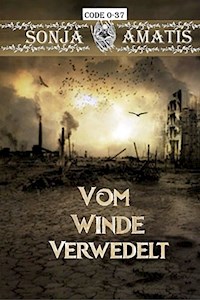
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das London von heute – in einer parallelen Welt Der Kampf gegen Lillith und Karm hat weitreichende Spuren hinterlassen – in Londons Straßen ebenso wie bei Marcus und Ian. Ihr nächster Gegner ist alles andere als ein Windei. Und als wären gleich drei Erzdämonenkinder auf einmal nicht bereits genug, haben sie auch sonst an keiner Front über Langeweile zu klagen … Ca. 62.000 Wörter Das Glossar umfasst etwa 8.000 Wörter Im normalen Taschenbuchformat hätte diese Geschichte etwa 315 Seiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Dies ist der 7. Teil der fortlaufenden Serie „Code 0-37“.
Teil 1 trägt den Titel „Auf Eis gelegt“, Teil 2 „Aus Feuer geboren“, Teil 3 „Fest verwurzelt in der Erde“, Teil 4 „In Stein gemeißelt“, Teil 5 „An heiße Eisen gerührt“, Teil 6 „Mit allen Wassern gewaschen“.
Es ist zum besseren Verständnis sinnvoll, die Bücher der Reihe nach zu lesen.
Der 7. und letzte Teil der Reihe!
Das London von heute – in einer parallelen Welt
Der Kampf gegen Lillith und Karm hat weitreichende Spuren hinterlassen – in Londons Straßen ebenso wie bei Marcus und Ian. Ihr nächster Gegner ist alles andere als ein Windei. Und als wären gleich drei Erzdämonenkinder auf einmal nicht bereits genug, haben sie auch sonst an keiner Front über Langeweile zu klagen …
Ca. 62.000 Wörter
Das Glossar umfasst etwa 8.000 Wörter
Im normalen Taschenbuchformat hätte diese Geschichte etwa 315 Seiten.
Vom Winde verwedelt
von
Sonja Amatis
„Es ist so nett, euch mal zu Besuch zu haben. Hector erzählt häufig von euch beiden.“ Liza strahlte, während sie das Irish Stew servierte. Ian hatte ein wenig den Verdacht, dass sie das Gericht seinetwegen ausgesucht hatte. Schon allein, weil sie ihn in der vergangenen Stunde seit Betreten des Hauses mehrfach auf Irland angesprochen hatte. Sie schien zu glauben, dass er sein altes Zuhause verzweifelt vermissen musste. Das jedenfalls drückten ihre Blicke und der Unterton aus. Klar, es wäre auch gänzlich unvorstellbar, dass er sich nicht mit jeder Faser seines Herzens nach der grünen Insel zurücksehnte. Wer lebte schon freiwillig in London?
Bei Liza war leider Ironie ebenso verloren wie subtile Hinweise, dass man möglicherweise ihre Meinung nicht teilte. Oder sich unwohl unter ihrer erdrückenden Aufmerksamkeit fühlen könnte.
Ian und Marcus hatten eigentlich nicht zusagen wollen, als Hector sie heute Morgen verlegen gefragt hatte, ob sie nicht zum Abendessen kommen konnten. Erst als ihr Chef ziemlich deutlich gemacht hatte, dass seine Frau ein Nein auf keinen Fall akzeptieren würde und er in diesem undenkbaren Fall mit erheblichem Stress rechnen musste, hatten sie ihm zuliebe zugesagt. Ein Fehler, den sie seitdem bereuten. Es erklärte zumindest, warum Hector so gerne und viel auf der Arbeit herumhing.
Liza wusste über ihre Gargoyles Bescheid, genau wie über die Tatsache, dass sie nur etwa alle drei Tage aßen – und auch dann keineswegs die Unmengen, die Liza für sie eingeplant hatte, sondern eher Spatzenportionen. Sie ignorierte es stur und präsentierte stattdessen stolz ihren Irish Stew, mit dem man acht ausgehungerte Männer zufriedenstellend sättigen könnte. Dazu lauerte noch ein Nachtisch im Anschluss.
„Ihr habt es richtig gemütlich“, sagte Marcus an Hector gewandt, in dem vergeblichen Bemühen, ihren Chef am Gespräch zu beteiligen.
„Wie lieb von dir, es zu bemerken. Ich habe die gesamte Inneneinrichtung selbst geplant. Hector hat ja nicht wirklich den Blick für Farben und Stoffe, was da zusammenpasst und so. Nicht wahr, Bärchen? Sag du auch mal was!“, rief Liza sofort.
Hector hob entschuldigungheischend die Hände und verdrückte ein gequältes Lächeln. Er wirkte, als hätte er ein ganzes Bündel Zitronen durchgekaut. Selbst an seinen besten Tagen auf dem Revier war er maulfaul und vergrub sich am liebsten hinter seinen Akten. Wenn es tatsächlich unumgänglich wurde, konnte er sehr gewandt und klug reden. Organisieren war seine Spezialität, er hielt Willowby an der kurzen Leine und bemutterte sein Team, wann immer es notwendig war. Anscheinend waren ihm die normalen Dinge des täglichen Lebens zu lästig, um sich damit beschäftigen zu wollen – welchen anderen Grund sollte er haben, um bei seiner Liza zu bleiben? Sie kümmerte sich um ihn, er brachte das Geld nach Hause. Ein seltsam antiquiertes Lebensmodell, das trotzdem funktionierte. Ian versuchte es mit Toleranz. Wer war er, darüber zu richten, dass sich ein älteres, kinderloses Ehepaar gegenseitig auf die Nerven ging?
Er nahm seinen bis zum äußersten Rand gefüllten Teller dankend entgegen. Es duftete hervorragend, ein Jammer, dass er so viel einfach nicht mehr essen konnte. Auch Marcus‘ Teller drohte überzulaufen, während Hector kaum genug erhalten hatte, um den Boden des Steingutgeschirrs zu bedecken.
„Schätzchen“, murmelte er bedächtig. Ein strafender Blick brachte ihn zum Schweigen. Der Ärmste, er würde hungrig bleiben. Vielleicht sah Liza irgendwann ein, dass Diäten an ihm verloren waren. Er war ein stämmiger Bursche, gleichgültig, wie viele Möhrensticks sie ihm in die Lunchbox packte.
Zum Glück standen Savennah und Ananvi unsichtbar bereit, um immer dann, wenn Liza gerade nicht hinschaute, unauffällig mitzufuttern. Auf diese Weise konnten Marcus und er im Essen herumrühren und vorgeben, Lizas Geplappere zu lauschen. Sie sorgte allein für die gesamte Unterhaltung, man musste lediglich zwischendurch nicken oder den Kopf schütteln, an den richtigen Stellen lachen oder betroffen dreinschauen. Durchaus anstrengend, da ihre Themen nicht allzu interessant waren. Es ging um ihre zahlreiche Verwandtschaft in Südfrankreich, bei denen jeder einzelne entweder im Scheidungskrieg stand, verhaltensauffällige Kinder besaß oder aufgrund von Krankheit, Schicksalsschlägen oder eigener Blödheit leiden musste. Außerdem fand sie Knochenabbau in den Wechseljahren extrem interessant, gerade noch getoppt von den Schwierigkeiten, das perfekte Karamell herzustellen.
Einem der Gargoyles gelang das Kunststück, Ians noch zu einem Viertel gefüllten Teller gegen Hectors auszutauschen, sodass der arme Mann wenigstens eine halbwegs anständige Portion bekam. Gerade als es begann, wirklich langweilig und damit praktisch unerträglich zu werden, klingelte Marcus‘ Handy. Dieses unschuldige Geräusch setzte ihn, Ian und Hector sofort in höchstgradig angespannte Habachtstellung. Der Kampf zwischen Lillith und Karm war jetzt über eine Woche her. London mochte sich in dieser Zeit dank magischer Unterstützung unzähliger Übernatürlicher halbwegs erholt haben – die Schäden an sämtlichen Bauwerken und Brücken, die von der riesigen Flutwelle angerichtet wurden, waren beseitigt. Tote hatte es keine gegeben, die zahlreichen Verletzten waren magisch geheilt worden. Bei Ian, Marcus und ihren Verbündeten hingegen würde es wohl noch eine längere Weile dauern, bis wieder Ruhe einkehren konnte. Vorausgesetzt, dass sie lange genug überleben würden, um dieses Stadium zu erreichen. Kampf gegen den Ertrinkungstod, Yaris Entführung, die Einbrüche in ihr Zuhause, die schweren Verwüstungen, die extrem persönlichen Attacken gegen Marcus, der Verlust des Buches der Wünsche … Und das waren nur die Ereignisse der letzten Spielrunde gewesen. Lillith hatte von Spielrunden gesprochen, als wäre die Prophezeiung ein einziger großer Spaß. Und was für ein Spaß das war!
In den letzten Tagen hatte niemand versucht, sie umzubringen. Kein Dauerregen, keine Stürme, keine seltsamen Phänomene in und um London. Lediglich anhaltend kräftiger Wind, der vorankündigte, zu welchem Element der nächste Feind gehörte. Nun hieß es warten, wann er sich enttarnte. Anscheinend war es Teil der Natur der Prophezeiung, dass die Gegner sich den Auserwählten vorzustellen hatten. Dieses Warten zermürbte, denn ja, natürlich lauerten sie Tag und Nacht darauf, wann die nächsten Katastrophenmeldungen hereinkamen.
„Das ist Nicholson“, sagte Marcus, was die Spannung um zwei weitere Stufen erhöhte. Um diese Uhrzeit meldete sich Nicholson, ihr Vertrauter vom Scotland Yard, garantiert nicht, um einen Plausch über schottischen Whiskey zu beginnen. „Es tut mir entsetzlich leid, Liza, ich muss rangehen.“
„Selbstverständlich“, zwitscherte sie mit verkniffenem Mund und gefurchter Stirn.
Ian, Marcus und Hector marschierten in die Küche, wo Marcus das Gespräch annahm.
„Hey, Berkley!“ Nicholsons Stimme drang kräftig aus dem Lautsprecher. „Hast du heute Abend schon irgendetwas vor?“
„Kommt drauf an, was du mir anzubieten hast“, erwiderte Marcus.
„Ein dutzend tote Mädchen. Rituell hingerichtet in einer entweihten Kirche“, erwiderte Nicholson. „Ja, ich weiß, klingt klassisch nach menschlichem statt übernatürlichem Wahnsinn. Allerdings sind alle zwölf erstickt, ohne dass es das geringste Zeichen gibt, dass sie überhaupt berührt wurden. Es ist, als hätte man ihnen den Atem aus den Lungen rausgezaubert. Wenn ein studierter, sehr ernsthafter und altgedienter Pathologe solche Dinge zu mir sagt, bekomme ich sofort Sehnsucht nach dir und deinem Partner. Also, kommt ihr mal bitte vorbei und konsultiert die Angelegenheit?“
„Selbstverständlich.“ Marcus nickte Ian grimmig zu. Das klang sehr danach, als wären die schlimmsten Befürchtungen bereits eingetroffen.
„Sollen wir dich mitnehmen?“, fragte Ian leise an Hector gewandt, während Marcus sich die genaue Adresse geben ließ.
„Hm? O nein! Lasst mich schön hier. Ich bin zu alt, um nachts über Friedhöfe und durch baufällige Gemäuer zu kriechen. Liza wird ein bisschen meckern, weil ihr so schnell abhauen musstest, da ist es gut, wenn ich bei ihr bleibe. Ist sie nicht ein Prachtweib? Ich liebe ihre Kochkünste. Schade, dass ich nur so wenig davon haben darf.“ Er schielte glücklich in Richtung des Nachtischs. Sicherlich würde sie ihm keine volle Portion davon gönnen, aber nun denn! Sollte er sich ruhig verwöhnen lassen. Unter Geschimpfe. Wenn es das war, was er wirklich brauchte.
Sie verabschiedeten sich herzlich und unter größten Bedauerungsbekundungen, ließen sich die Hälfte des Nachtisches einpacken und durften dann endlich die Flucht ergreifen. Wobei die Freude darüber, gleich ein Dutzend Leichen anstarren zu müssen, äußerst verhalten war. Es ging wieder los!
„Sollen wir nicht noch rasch bei Barney vorbeihüpfen?“, fragte Ananvi, als sie sich gerade anschnallten.
„Wozu?“, entgegnete Marcus stirnrunzelnd.
„Bei zwölf Leichen wird Nicholson nicht allein in dieser entweihten Kirche herumstehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die süße Miranda dabei ist, halte ich für riesig. Ihr habt Barney versprochen, dass er dabei sein darf, wenn ihr wieder mit dem Weib zusammenstoßt.“
„Himmel, was muss ich besoffen gewesen sein“, murmelte Marcus. „Und das, ohne je zu trinken.“
„Wir verlieren zu viel Zeit, Barney wohnt ewig weit draußen. Lass uns nach Hause fahren und Taubrin oder Yari bitten, dass sie uns transportieren. Währenddessen kann ich den Kurzen erst einmal anrufen, ob er überhaupt Zeit und Lust für den Ausflug hat“, sagte Ian.
Der Gedanke, dass Barney an einem Freitagabend etwas anderes tun könnte, als das Telefon zu bewachen, ob ihn einer der Kollegen zu einem spontanen Sondereinsatz einladen könnte, sollte sich deutlich absurder anfühlen, als er es tatsächlich tat. Der Kleine war schließlich entsetzlich jung, gesund, sah gut aus und besaß schwerreiche Eltern sowie sein eigenes großzügiges Einkommen vom LPSC. Sprich: Er sollte in irgendeinem angesagten Club tanzen, trinken, illegale Drogen einnehmen, schöne Mädchen, Jungs oder auch beides zugleich flachlegen oder an zweifelhaften Sexexperimenten mit Übernatürlichen teilnehmen. Eben das, was reiche Kids Anfang Zwanzig in London an einem Freitagabend üblicherweise anstellten.
Stattdessen ging Barney bereits beim ersten Klingeln ans Telefon und rief gut gelaunt seinen Namen, ohne dass im Hintergrund ohrenbetäubende Beats hämmerten.
Ian erklärte kurz, worum es ging.
„O Mann, ja, JA! Nehmt mich bitte mit! Ich habe Ausgangsverbot bis zum fünfundzwanzigsten Jahrhundert und sitze hier mit einem uralten Computerspiel, das bereits meine Oma zum Schreien langweilig fand.“
Ob das dieselbe Oma war, die Barney das Rezept für die Mini-Windbeutel gegeben hatte? Er brachte die kleinen Sahnesünden mittlerweile jede Woche mindestens einmal mit und sie fanden jedes Mal reißenden Absatz. Und warum hatte er wohl Ausgangsverbot, zumal in seinem Alter? Marcus verkniff sich die Fragen, um keinen Ärger zu riskieren.
„Wir kommen dich in etwa einer Viertelstunde holen.“ Ian beendete das Gespräch.
„Keine Sorge“, sagte Savennah vom Rücksitz. „Falls Miranda nicht da sein sollte, um ihn angemessen zu amüsieren, spielen Ananvi und ich mit dem Kleinen ein bisschen Verstecken in der Kirche. Wird schon noch lustig werden.“
Eigentlich sollte es gar nicht lustig werden, wenn man sich mit einem Kollegen zum Besichtigen eines Tatortes verabredete, aber Barney war eben definitiv etwas Besonderes …
Miranda war gemeinsam mit Nichsolson vor Ort. Zusammen mit gefühlt fünfzig Kollegen der Spurensicherung und Pathologie. Die zwölf toten jungen Mädchen lagen sternförmig an der Stelle, wo in früheren Zeiten der Altar gestanden hatte. Diese kleine Kirche war bereits vor Jahrzehnten entweiht worden und diente als Treff für Jugendliche. Aus irgendwelchen nostalgischen Gründen war der alte Altarbereich mit Trennwänden abgesperrt worden. Vielleicht, weil man aufgrund der unterschiedlichen Färbungen des Mauerwerks genau erkennen konnte, wo früher das riesige Holzkreuz gestanden hatte. Die Mädchen waren nach Marcus‘ Einschätzung zwischen vierzehn und sechzehn Jahre alt gewesen. Sie wirkten unfassbar friedlich, als würden sie bloß schlafen. Ihre Augen waren geschlossen, kein Schrecken, keine Schmerzen hatten ihre jungen Gesichter im Tod verzerrt. Der Mörder hatte sie mit weißem Stoff zugedeckt, sie hielten seltsame Gewächse in ihren gefalteten Händen – langstielige Blumen mit gelben Blütenständen. Jedem Mädchen war ein seltsames Symbol auf die Stirn gemalt worden, das wie ineinander verschlungene Halbmonde aussah. Ob dafür Blut, rote Farbe oder etwas anderes verwendet wurde, konnte nicht auf den ersten Blick festgelegt werden.
„Oh, Lord Barnabäus gibt sich wieder die Ehre“, sagte Miranda, deutlich bemüht, ihre Nervosität zu verbergen. Sie wich ein Stück vor Barney zurück, der nun seinerseits versuchte, seine diebische Freude zu verbergen. Nicholson betrachtete Barney, dem er bislang noch nicht begegnet war. Zumindest wusste er, dass gerade seine Kollegin veralbert wurde. Da Miranda es nicht schaffte, sich beliebt zu machen, griff er nicht ein, sondern grinste lediglich.
„Ja, unser tüchtiger halbdämonischer Vampir war in der Gegend, da haben wir ihn mal gleich von unseren Kobolden einsammeln lassen. Er langweilt sich ja so schnell, der Ärmste.“ Ian wies auf Taubrin und Yari, die verlegen lächelnd im Hintergrund standen, bevor er auf Barney zeigte.
„Ist es denn … klug … einen Halbvampir an einen Tatort mitzubringen? Ihr habt doch bereits eine komplette Entourage mit euren Gargoyles und Kobolden“, sagte Miranda bedächtig.
„Es schadet nie, einen Fürsten der Hölle bei sich zu haben. Vor allem wenn man wünscht, dass er einem gewogen bleibt. Keine Sorge, er hat seinen Appetit bereits gesättigt und wird die Leichen nicht anrühren“, entgegnete Ian mit einem bezaubernden Lächeln. Barney ergriff Mirandas Hand, die das vollkommen erstarrt und mit steigender Panik in den Augen tolerieren musste.
„Seien Sie gegrüßt, Verehrteste“, sagte er in fehlerfreiem Koboldjia. Der Kleine war ein eifriger Schüler, wenn er sich erst einmal in etwas festgebissen hatte. Den riesigen Wälzer, in dem sämtliche Codes des LPSCs festgelegt waren, hatte er innerhalb von zwei Wochen auswendig gelernt. Das war Marcus bis heute noch nicht gelungen. Zumal es einfach unwahrscheinlich war, dass er jemals einen Code 0-50387 in einen Bericht einfügen musste. „Beschmutzung von Regierungsgebäuden oder Observatorien durch Harpiyen“ kamen in ihren Breitengraden schlichtweg nicht vor, diese Dämonenvögel bevorzugten das milde Mittelmeerklima.
„Was hat er gesagt?“, fragte Miranda und entzog Barney mit einem hektischen Ruck die Hand.
„Er ist begeistert von der samtigen Struktur deiner Haut“, erwiderte Savennah. „Darauf kannst du dir was einbilden, Mädel. Lord Barnabäus macht normalerweise nur seinen Bluthuren Komplimente.“
„Wie … absolut entzückend. Vielen Dank.“ Miranda lächelte verkrampft. „Gewiss hat der edle Lord jetzt Wichtigeres zu tun, als mit mir zu tändeln. Wo er sich doch so schnell langweilt.“
„Ein Zeitalter an deiner Seite wäre nicht mehr als der Wimpernschlag eines Drachen“, sagte Barney galant, eroberte Mirandas Hand zurück und drückte ihr einen Kuss auf die Pulsschlagader am Handgelenk. Selbst Marcus hörte heraus, dass dieser Koboldjia-Satz Grammatikfehler enthielt, aber das änderte nichts an der Wirkung, zumal Ananvi ihn mit seiner tief grollenden Stimme eindrucksvoll beim Übersetzen intonierte.
„Okay. Vielleicht sollten wir uns jetzt wieder auf die Arbeit besinnen. Schließlich sind wir Profis und so.“ Nicholson räusperte sich und wies auf die toten Teenager. „Eine Fachmeinung wäre schön, ob hier ein irrer Serienkiller oder ein Übernatürlicher am Werk gewesen ist.“
Marcus griff nach dem Anhänger um seinen Hals. Eine Geste, die ihm mittlerweile so sehr in Fleisch und Blut übergegangen war, dass er nicht einmal mehr darüber nachdachte. Sofort zerlegte sich die Welt in seine atomaren Geruchsmoleküle und brachte seine Sinne zum Schwingen. Ein Gefühl, als würden schwarze Löcher explodieren und sämtliche in sich aufgesogenen Informationen des Weltalls ausspucken. Diese Metapher hatte Ian geprägt, zumindest auf ähnliche Weise. Es stimmte auf jeden Fall, dass es gewaltig war, was Rebeccas Magie mit ihm anstellte und kosmische Vergleiche griffen dabei keineswegs zu kurz.
Marcus konnte jede der anwesenden Personen wahrnehmen, die Leichen, zahlloses Getier in den Ecken und Winkeln der Kirche – der Holzbockbefall würde in absehbarer Zeit für umfangreiche Renovierungsarbeiten sorgen, wenn nicht sogar für den Abriss des altehrwürdigen Bauwerks. Über allem schwebte eine intensive Witterung, die wie eine Mischung aus Rabenfedern, Pferdefell und Wolfspelz knisterte, kombiniert mit jeder Art von Wind, die Rebecca jemals in ihrem Leben gerochen hatte. Glockenhelle und grabestiefe Töne waren darin verflochten, das Schreien von tausenden sterbenden Kriegern, grenzenlose Wut, der Verwesungsgestank des Todes. Das komplexe Gemisch gehörte zu einer Kreatur, die vor Magie ebenso wild und unbändig pulsierte wie Karm oder Lillith.
„Es war der nächste Erzdämonenbastard“, sagte Marcus auf Koboldjia zu seinen Gefährten. „Sprecht mit mir. Ananvi, Savennah, auch du, Barney. Sagt einfach irgendetwas. Ich werde dann behaupten, dass ihr Magie gewittert habt.“
„Deine Aussprache ist noch etwas gequetscht und die Vergangenheitsform gerade hast du falsch gebildet, aber insgesamt wird dein Koboldjia immer besser“, sagte Ananvi.
„Absolut, Schatzi“, warf Savennah ein. „Ian ist ein guter Lehrer. Wenn das mit der Dämonenjagd mal langweilig werden sollte, braucht er sich keine Sorgen um den Lebensunterhalt zu machen.“
„Mir fehlen noch zu viel Vokabeln und die Runen finde ich schwierig. Ist nicht nett, dass ich meine Lehrmeister nicht ebenfalls daheim sitzen habe“, murrte Barney und schaute angestrengt ernst drein. Es war kein Geheimnis, dass Ian und Marcus zusammenwohnten. Zum Glück störte sich niemand daran, außer ein paar Typen von der mobilen Eingreiftruppe. Marcus sprach oft geistig mit Ananvi auf Koboldjia und auch daheim bevorzugten sie inzwischen diese Sprache anstelle von englisch oder gälisch. Irgendjemand fand sich jedes Mal, der ihm weiterhalf, wenn er kein Wort mehr verstand.
„Ich bin mir sicher, dass es ein Dämon gewesen sein muss, meine Gefährten unterstützen das“, sagte er an Nicholson gewandt. „Die Gargoyles sind der Meinung, dass es nach Hölle und Schwefel stinkt und Lord Barnabäus spricht von einem machtvollen Dämon, der dafür verantwortlich sein muss. Die Witterung ist wohl nicht eindeutig zuzuordnen, aber es genügt mir. Wir übernehmen den Fall.“
„Großartig! Damit haben wir Feierabend und ihr eine Menge Papierkram am Arsch. Viel Spaß damit!“ Miranda wandte sich zackig um und wollte gehen.
Weit kam sie nicht. Plötzlich glitzerten Myriaden Wassertropfen in der Luft, die sich in Windeseile zu einer Gestalt zusammensetzten. Eine weibliche Gestalt. Lillith!
Zum Glück hatten sie bereits gewusst, dass dieses Weib überlebt hatte, sonst wäre der Schock unerträglich gewesen. Lillith lächelte gütig in die erstarrten Gesichter der sie umgebenden Menschen und Anderswesen, als ihre Verwandlung abgeschlossen war. Drei Atemzüge dauerte es, bevor beinahe jeder Anwesende auf den Knien lag und wimmernd die Hände nach ihr ausstreckte – außer den Gargoyles und Kobolden, die durch ihre magischen Armreifen geschützt waren, Ian und Marcus – sowie Barney und Miranda, was eine echte Überraschung war. Die beiden waren nicht gänzlich unbeeinflusst, schienen verwirrt und bewegungsunfähig zu sein. Warum sie nicht wie die anderen auf dem Boden krochen, erschloss sich nicht.
„Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich“, sagte Lillith mit all dieser unglaublich perfekten, göttergleichen Lieblichkeit, die ihr zueigen war. Sie legte eine zartgliedrige Hand gegen Mirandas Wange, die sich das reglos gefallen ließ.
„Du armes Menschenkind“, wisperte Lillith einen Moment später auf Koboldjia. Tiefes Mitgefühl schimmerte in ihren Augen. „Von der eigenen Mutter an Männer verkauft, als du noch nicht einmal die Reife erreicht hattest … Kein Wunder, dass weder Männer noch Frauen dein Herz berühren können und du stattdessen Mörder jagst.“ Sie streichelte durch Mirandas kurzgeschnittenes Haar. „Lass mich dir helfen“, fuhr Lillith auf Englisch fort. Strahlendes Glück schimmerte mit einem Mal auf Mirandas Gesicht, dazu herzzerreißende Hoffnung.
„Nein. Nein!“, begehrte Ian auf und versuchte zu ihr zu gelangen, um sie irgendwie aufzuhalten.
„Ich will sie nicht töten, Ian. Bleibt stehen, bevor ich euch wieder in Wassersäulen einschließen muss, Kinder.“ Lillith schüttelte tadelnd den Kopf. Sie zog Miranda in ihre Arme und gab ihr einen zärtlichen Kuss auf die Lippen. Ganz kurz nur, dann gab sie sie frei – Miranda sank ohnmächtig zu Boden.
„Ich habe die Macht ihrer Erinnerungen blockiert. Sie wird nicht vergessen, was ihr einst widerfahren ist, doch es wird ihr Herz nicht länger in Fesseln legen. Eine Frau sollte nicht ausschließlich Bitternis in sich tragen. Moderne Welt hin oder her, es ist die natürliche Berufung der Frauen, Kinder zu gebären, so wie es die natürliche Berufung der Männer ist, Kinder zu zeugen. Sich aus Krankheit oder freiem Willen dagegen zu entscheiden ist das eine, von Bitternis gehindert zu werden das andere … Denn ja, diese Frau sehnt sich so sehr danach, Mutter zu sein.“ Lillith wandte sich von Miranda ab und schwebte zu Barney hinüber, der sie fasziniert beobachtete.
„Ein Nachfahre des Tarakh, sieh an! Du bist mit Hexenkräften gesegnet. Doch das ist es nicht allein, was dich mir widerstehen lässt, denke ich.“ Sie strich um Barney herum wie ein Raubtier um die verletzte Beute. „Oh, das ist köstlich, mein Freund!“, rief sie nach einigen Momenten und trat von ihm zurück. „Passt gut auf ihn auf, ihr Gargoyles. Dieser junge Mann ist ein Kleinod.“ Ohne diese Behauptung zu erklären, näherte sie sich Ian und Marcus. „Ich wollte euch jenseits aller Zweifel wissen lassen, dass ich noch ebenso lebendig bin wie Karm“, sagte sie lächelnd. „Zweifel sind grausam, sie können einen Mann in den Wahnsinn treiben. Ihr sollt nicht leiden müssen.“
„Wie rücksichtsvoll von dir. Was ist mit dem neuen Feind? Wer ist er?“, fragte Ian mühsam.
„Ihr werdet es herausfinden. Sein Name war einst groß in den Glaubenswelten der Menschen. Sicherlich dauert es noch ein wenig, bevor er sich euch offenbaren muss. Mit dieser Tat“, sie wies auf die toten Mädchen, „hat er sich mit den Seelen versorgt, die er für das Spiel benötigt. Vermutlich werden noch einige weitere folgen. Seid vorsichtig, Kinder. Euch stehen wahrhaftig stürmische Zeiten bevor.“ Sie küsste jeden, der noch aufrecht stand, zärtlich auf Mund, Wangen oder Stirn. Bei den Gargoyles und Kobolden zeigte sie sich besonders innig.
„Yari, Liebes. Ich sehe, du hast dich von den Schrecken deines unfreiwilligen Abenteuers noch nicht ganz erholt. Genauso wie die Erinnerungen an die Zeit deiner Versklavung. Ich könnte dir auf ähnliche Weise helfen wie Miranda.“
„Warum solltest du das tun?“, wisperte Yari fast unhörbar. „Du kämpfst gegen, nicht für uns.“
„Es macht keinen Unterschied, ob du stark bist oder nicht. Nicht für die Prophezeiung. Falls du überlebst, würde es mir gefallen, dich frei und glücklich zu sehen. Der Vorteil für mich liegt darin, dass es deine menschlichen Gefährten beeinflusst. Es ändert sich nichts, wenn ihnen diese Tatsache bewusst ist, darum rede ich offen darüber.“ Mit einem steinzerschmelzenden Lächeln zwinkerte sie Marcus und Ian zu. Natürlich hatte sie recht – wenn Lillith Yari half, würden sie positiv beeinflusst werden, was im Kampf gegen sie für entscheidende Millisekunden des Zögerns sorgen könnte. Und nein, es gab nichts, was sie dagegen tun konnten.
„Bevor du dich entscheidest, Yari: Allein dass sie das Angebot ausgesprochen hat, verändert bereits alles“, sagte Savennah. „Es gibt keinen Grund, es abzulehnen. Aus Stolz weiterzuleiden, nur weil du von dieser verlogenen Schlampe keine Hilfe willst, macht dich nicht zu einer besseren Koboldin, okay?“
Yari blickte Taubrin an. Sein Gesicht offenbarte einen harten Kampf zwischen Sorge und Hoffnung.
„Ich bin ein Kobold“, sagte sie langsam. „Mein Volk neigt nicht zum Stolz. Wir nehmen, was wir kriegen können, nicht wahr?“
„Du gehörst zu den wundervollen Ausnahmen“, entgegnete Lillith. „In diesem Fall gibt es wirklich nicht den geringsten Grund dafür. Nimm mein Angebot an, es bedeutet Gewinn für jeden Beteiligten.“
Als Yari mit krampfhaft zusammengepressten Lidern nickte, beugte Lillith sich zu ihr hinab und hob sie hoch, als wäre sie ein Kind. Die Geste, mit der sie Yari küsste, hatte tatsächlich etwas Mütterliches an sich, genau wie das Lächeln, mit dem sie sie wieder zu Boden herabließ.
„Ich verabschiede mich, dies ist nicht mehr meine Spielrunde. Ich habe vollbracht, wofür ich gekommen bin, und noch mehr als das. Nun …“
Sie stockte. Marcus stieg ein vertrauter Geruch in die Nase, obwohl er die Kette gar nicht in die Hand genommen hatte: Karms Präsenz. Einen Moment später erschien der fieseste Gnom der Welt auf einem der Dachbalken, die unter der Decke verliefen.
„Eine Party, und ich bin nicht eingeladen?“, sagte er vorwurfsvoll. „Welch schlechte Manieren!“
„Karm, dich lädt keiner freiwillig ein, egal zu welcher Party“, grollte Ananvi angriffslustig. „Macht sich echt nicht gut, wenn am Ende sämtliche Gäste für den Rest ihres Lebens traumatisiert sind.“
„Das mag stimmen, ja.“ Karm sprang vom Balken herab, wobei er es dankbarerweise vermied, eines der toten Mädchen zu berühren. „Es ist bloß genauso unklug, Lillith zur Party einzuladen. Es macht sich denkbar schlecht, wenn am Ende der Feier sämtliche Gäste tot sind.“
„Was soll ich sagen: Keiner hat euch beide eingeladen. Warum haut ihr nicht einfach ab? Lillith wollte sowieso gerade gehen.“ Ananvi reckte seine Flügel in einer deutlichen Drohgebärde hoch, während er Karm die Stirn bot. Der bräuchte nicht einmal mit den Fingern zu schnipsen, um den Gargoyle umzubringen. Glücklicherweise war das nicht Karms Stil. Er lachte nur und umrundete Ananvi, um sich mit in die Hüften gestemmten Fäusten vor Lillith aufzubauen.
„So schnell sieht man sich wieder, hm?“, sagte er provokant.
„In der Tat. Dein Verdienst ist es nicht.“ Lillith neigte den Kopf, ihre Augen funkelten gefährlich. Karm bewegte sich unruhig, wich allerdings nicht zurück.
„Es ist mein Verdienst, dass die Auserwählten dein kleines Badevergnügen überlebt haben. Aber lass uns nicht von der Vergangenheit reden. Wichtiger ist die Gegenwart. Unser Freund ist eingetroffen und hatte bereits ein wenig Spaß mit der einheimischen Bevölkerung.“
„Er geht dabei ungewohnt ordentlich zur Sache. Ich kenne ihn eigentlich deutlich … ungehobelter.“ Lillith schnalzte leise mit der Zunge.
„Neben dir, mein Herz, sieht jeder ungehobelt aus.“
„Oh, keine Komplimente, ich bitte dich. Wobei du dich ruhig etwas stattlicher geben könntest, lieber Karm. Es ist Nacht, du hast vollen Zugriff auf deine Gestaltwandlerkünste.“
„Wozu?“ Er zuckte nachlässig mit den Schultern. „Ich bevorzuge es, niemandem etwas vorzuspielen. Ich bin klein, fies und hässlich, von innen wie von außen. Du hingegen täuschst größtmöglichste Lieblichkeit vor, während dein Inneres einem stinkenden Misthaufen voll verwesendem Aas gleicht.“
Lillith zuckte leicht mit der Nase, was möglicherweise Empörung bedeutete. Doch sie lächelte unvermindert weiter und beugte sich tief zu Karm hinab.
„Fort mit dir“, hauchte sie zärtlich, während ihre Augen eisigen Dolchen glichen. Auflachend hob Karm die Hand und schnippte sich davon. Lillith nahm sich die Zeit, kurz in die Runde zu winken, bevor ihr Körper wieder in zahllose Wassertropfen zersprang. In Windeseile verschwand das Nass durch die Ritzen und Fugen des Kirchenbodens.
Abrupt kehrte vollkommene Stille ein.
Mit dem Gefühl, einmal mehr glücklich davongekommen zu sein, zog Marcus Ian an sich. Für einige wundervolle Herzschläge lehnten sie Stirn an Stirn gegeneinander, ihre Hände verschränkten sich. Es half, zur Ruhe zu kommen. Rasch Kraft zu tanken und zu wissen, dass es irgendwo auf dieser Welt Sicherheit und Gewissheit gab. Ian war ein Ankerpunkt für ihn. Beinahe das Einzige was half, nicht auf der Stelle den Verstand zu verlieren.
Taubrin war mit Yari beschäftigt, die still weinte und sich zitternd an ihn klammerte. Magische Heilung war bereits dann überwältigend, wenn sie sich auf den Körper bezog. Was innere Heilung bedeutete, wollte Marcus sich nicht einmal vorstellen.
Als Nicholson sich hinter ihnen räusperte, fuhren sie auseinander. Mittlerweile hatten die meisten Leute es geschafft, wieder auf die Beine zu kommen, ein jeder von ihnen desorientiert und zutiefst verstört über das, was ihnen gerade widerfahren war.
„Ähm – waren das Freunde von euch?“, fragte Nicholson mit rauer Stimme, die nahezu fremd im Vergleich zu sonst klang.
„Freunde wäre etwas weit gegriffen“, erwiderte Ian. „Die holde Maid war Lillith, die Verursacherin der großen Flutwelle von neulich. Der grässliche Gnom war Karm. Seine Spezialität ist es, Pflanzen wie irre wachsen zu lassen.“
„Okay.“ Er nickte heftig. Es sah aus, als wollte er sich selbst von irgendetwas überzeugen. „Okay. Keiner von beiden ist der Mörder?“
„Sie töten beide skrupellos und gerade Lillith ist da eine Meisterin ihres Fachs. Sie hat zum Beispiel die vielen verschwundenen jungen Männer von neulich umgebracht. Diese Mädchen hingegen gehen nicht auf ihr Konto“, erwiderte Marcus.
Bevor einer von ihnen reagieren konnte, richtete Miranda sich plötzlich auf.
„Nicholson, hilf mir“, flehte sie mit tränenüberströmtem Gesicht. Er eilte zu ihr und streckte ihr die Hand entgegen, um ihr beim Aufstehen zu helfen. Sie sackte augenblicklich wieder in die Knie, klammerte sich an ihm fest. „Bitte, bring mich nach Hause.“
Marcus schoss überraschend vor, schnappte sich Miranda und zerrte sie von Nicholson fort.
„Taubrin, hättest du einen Moment?“, fragte er mit gepresster Stimme – Miranda wickelte sich geradezu um ihn. Taubrin schob Yari sanft in Savennahs Arme und kam herbeigesprungen. Ein Fingerschnipsen später waren er und Miranda verschwunden.
„Was sollte das jetzt?“, fragte Nicholson verwirrt und durchaus ein wenig vorwurfsvoll.
„Mein lieber Freund“, Marcus schlug ihm kameradschaftlich auf die Schulter, „hier sind Mächte am Werk, die für uns Normalsterbliche schwer zu durchschauen sind. Lillith‘ Anwesenheit hat dafür gesorgt, dass du spitz wie Nachbars Lumpi bist. Was auch immer sie mit Miranda angestellt hat, ich denke, sie hat ganz bewusst laut ausgesprochen, dass die Gute sich nach einem Baby sehnt – die Dame befindet sich an passender Stelle ihres Zyklus‘. Sprich, du hättest heute Nacht Probleme gehabt, zu deiner Frau heimzukehren und in vier bis acht Wochen hätte Miranda dir verkündet, dass es da ein weiteres Problemchen gibt.“
„Okay.“ Nicholson wirkte ziemlich krank und überfordert, aber insgesamt hielt er sich tapfer. „Euer Kobold ist nicht in Gefahr?“
„Kein bisschen. Er wird sie ins Bett hätscheln, ihr warme Milch mit Honig bereitstellen und vielleicht ein wenig nachhelfen, damit sie auch wirklich schön schläft und sich erholt. Nicht, dass sie mitten in der Nacht beim Nachbarn klingelt und fragt, ob er mit zwei Eiern und dem einen oder anderen Würstchen aushelfen kann“, sagte Ananvi breit grinsend. „Morgen früh, also nach der Schlafpause, dürfte alles wieder in Ordnung mit ihr sein. Ihr solltet jetzt einpacken und den Tatort dem LPSC überlassen. Ruht euch fein aus und dankt dem Himmel dafür, dass ihr zwei der mächtigsten Dämonen diesseits der Hölle in die Augen geblickt und überlebt habt.“
„Klingt gut.“ Nicholson taumelte orientierungslos und sprach mit den Leuten von der Spurensicherung. Die würden heute keine Leistung mehr vollbringen können, also blieb nur, den Tatort zu versiegeln und morgen ein frisches Team herzuschicken. Ian telefonierte bereits mit Hector, damit dieser die Übernahme der Leichen vom LPSC veranlasste. Barney hingegen war dazu übergegangen, sich Notizen zu machen und die Symbole auf den Gesichtern der Toten zu fotografieren. Was war es wohl, was Lillith in ihm gesehen hatte?
„Weiß hier irgendjemand, was das für Gewächse sind?“, fragte Ian und wies auf die Blumen in den Händen der Mädchen.
„Wolfsmilch“, murmelte Yari gepresst, die sich nach wie vor an Savennahs Schulter anschmiegte wie ein Kind bei der Mutter. „Sonnenwend-Wolfsmilch, genauer gesagt. Sehr, sehr giftig. Heißt so, weil die Blüten sich nach der Sonne ausrichten. Keine magischen Fähigkeiten, medizinisch nur zur sehr vorsichtigen äußeren Anwendung geeignet.“
„Hat sie irgendeine mythologische Bedeutung?“, hakte Ian nach. „Bei den Kelten vielleicht?“
„Keine große“, erwiderte Taubrin, der in diesem Moment zurückkehrte. „Sie waren Bestandteil der druidischen Medizin und sicherlich fand man die stark ätzende Pflanzenmilch interessant. Viel mehr war da nicht.“
„Warum wurden diese Dinger dann auf diese Weise arrangiert? Ich meine, das muss doch Teil einer Botschaft sein.“
„Ian, du darfst das nicht so angehen, als wäre es ein menschlicher Serienkiller“, sagte Ananvi. Das gesamte Gespräch fand auf Gälisch statt. „Unser Feind braucht keine Botschaften senden. In naher Zukunft wird er an unsere Haustür klopfen. Er hat diese Mädchen nicht für uns zurechtgemacht, sondern wohl eher, weil er Lust dazu hatte. Vielleicht ist er auf dem Weg hierher über diese Gewächse gestolpert und fand sie hübsch – die wuchern wie Unkraut.“
„Durchaus möglich, dass es ihm leid tat, solch junge Menschen als Opfer zu nehmen“, sagte Savennah.
Marcus spielte mit dem Kettenanhänger. Mitleid hatte er keines gewittert. Eher vorfreudige Aufregung, gepaart mit Stolz und Entschlossenheit. Das behielt er für sich, er wollte nicht, dass Ian sich schon wieder aufregte. Sein Partner hatte Schwierigkeiten damit, wie Rebeccas Fähigkeiten einen immer größeren Raum in Marcus‘ Denken und Handeln einnahmen. Er hatte durchaus selbst Schwierigkeiten damit. Verzichten war keine Option. Niemals und unter gar keinen Umständen. Niemals …
Sie hatten noch eine ganze Weile warten müssen, bis sie den Tatort endlich verlassen durften. Ian hoffte, dass die Mädchen möglichst rasch identifiziert werden konnten, was dank der DNA-Datenbank zumindest kein weiteres Problem darstellte. Die Familien sollten die Wahrheit erfahren, statt sich mit Sorgen und Ängsten zu quälen. Die kalte, nackte Gewissheit, so grausam sie sein mochte, war das Beste in einem solchen Fall. Danach würde für diese Familien nie wieder irgendetwas normal oder gut werden. Aber zumindest mussten sie nicht länger warten.
Bei dieser gewaltigen Opferanzahl bedeutete es zwangsläufig, dass Marcus und er mindestens einen kompletten Tag damit beschäftigt sein würden, mit den Hinterbliebenen zu reden.
Die meisten Kollegen hassten und fürchteten es, solche Gespräche zu führen. Aus Gründen, die Ian nicht einmal selbst analysieren konnte, machte ihm das nichts aus. Er freute sich nicht darüber, Eltern, Kinder, Geschwister, Lebenspartner oder Freunde eines Toten weinen und zusammenbrechen zu sehen, selbstverständlich nicht. Doch irgendwie fand er für sich selbst Trost und Kraft darin zu wissen, dass diese Menschen geliebt worden waren. Dass sie betrauert werden würden. Dass ihr Leben Bedeutung gehabt hatte. Wie anders hatten seine eigenen Eltern reagiert, als sie herausfanden, dass er nicht in der Schuldsklaverei gestorben war …
„Okay, ich denke, wir haben bereits einige gute Anhaltspunkte, wer unser neuer Feind ist“, sagte er, sobald sie sich alle gemeinsam auf der bewährten Couch im Wohnzimmer niedergelassen hatten – die Gargoyles kauerten dabei auf der Lehne. „Wenn er in der Mythologie wichtig ist, sollte er zu finden sein.“
„Bei den Griechen und Römern fällt mir Aeolus ein, der Gott der Winde“, erwiderte Marcus. „Der war aber keineswegs eine richtig große Nummer.“
„Vielleicht ist es diesmal die aztekische Glaubenswelt. Oder die nordamerikanische Urbevölkerung. Bei den Ägyptern war der Gott Schu der Herr der Winde. In Babylon war es Enlil. Und in Indien …“
Ian hob die Hand, was Taubrin zum Schweigen brachte, der sich gerade eifrig in Ekstase reden wollte.
„Lillith weiß, was wir wissen. Sie hätte bestimmt nicht von einer mythologischen Figur aus Altpersien oder Indien gesprochen, die für uns keine weitere Bedeutung hat. In diesem Fall hätte sie nicht behauptet, dass wir den Namen mühelos herausfinden können. Ich glaube, es geht um jemanden, den wir richtig gut kennen, auch wenn wir ihn im Moment nicht vor Augen haben. Vergleichbar mit dem Basilisk oder der Gorgone.“
„Ich habe eine ziemlich düstere Vermutung“, murmelte Marcus und ergriff Ians Hand in einer Geste, die seltsam verzweifelt anmutete. „Als ich vorhin in der Kirche Witterung aufgenommen habe, konnte ich die Präsenz unseres Feindes analysieren. Rebecca kennt ihn nicht. Was ich wahrgenommen habe, umfasst Raben, Pferde und Wölfe, Sturmwind, raue Gesänge, Kriegsgebrüll, Heldenmut, rasende Wut und Tod.“
„Oh. Mein. Gott.“ Ian spürte, wie ihm das Blut schlagartig absackte. „Du meinst doch nicht …?“
„Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Es spricht bei diesen Attributen bloß sehr viel dafür und ich denke …“ Marcus zerdrückte ihm fast die Finger, was Ian kaum spürte, weil er zu sehr mit Übelkeit und betäubender Angst beschäftigt war.
„Lass uns keine voreiligen Schlüsse ziehen. Das Symbol! Dieses Symbol auf den Gesichtern der Mädchen!“, rief er. „Taubrin, das Ding muss ganz einfach in der Bibliothek zu finden sein.“
„Ich eile, Herr, ich eile!“, rief Taubrin und schnippte sich weg. Er kehrte in Windeseile mit einem Wälzer in den Armen zurück – eine Abhandlung über germanische Götter- und Heldensagen. Wie befürchtet.
„Ich bin für Gewissheit“, sagte Ian und konzentrierte sich darauf, ruhig zu atmen. Seltsam, dass ihn gerade diese mythologische Figur in Todesangst versetzte, nachdem sie bereits mit einigen schrecklichen Vertretern dieser Art gekämpft hatten. Es war eben auch immer eine Kopfsache und Ängste nicht rational. Wenn man von einer bestimmten Gestalt explizite Vorstellungen besaß …
„Das hier ist es“, flüsterte Taubrin. „Die ineinander verschlungenen Trinkhörner. Manche glauben, es wären vielleicht doch Halbmonde und die Legenden dazu variieren stark. Fakt ist, dieses Symbol gehört zu … zu …“
„Odin“, sagten Ian, Marcus und Ananvi gleichzeitig.
Der nordische Gott des Sturms, der Skalden, der gefallenen Krieger, der Magie, Ekstase, der Weisheit, Berserkerwut und des Todes. Der eines seiner Augen geopfert hatte, um allumfassende Weisheit zu erlangen. Der Allvater, der von seinem Thron in Asgard aus die neun Welten der germanischen Mythologie überblickte. Die Raben Hugin – Gedanke und Munin – Erinnerung saßen auf seinen Schultern, die Wölfe Geri und Freki lagen zu seinen Füßen. Thor war einer seiner Söhne. Er ritt auf dem achtbeinigen Pferd Sleipnir, besaß einen Mantel, der ihn unsichtbar machen konnte …
Der nordische Kult um Odin, auch Wotan genannt, war komplex und vielschichtig. Der Kerl war nicht nur irgendjemand gewesen, sondern der höchste Gott mehrerer Länder und Völker, vom Norden Deutschlands bis nach Island. Die Wurzeln lagen im Indogermanischen Raum. Odin musste über Jahrhunderte hinweg die Bude gerockt haben, um es mal lapidar zu benennen. Er war alt, gerissen, mächtig.
„Nun gut, was haben wir auch erwartet?“, murmelte Marcus. „Im Prinzip hat es sich mit jedem neuen Anwärter gesteigert. Bereits Lillith ist de facto unbesiegbar, und Karm ist eine listige, miese Kakerlake, die sich einfach nicht zertreten lässt. Jetzt haben wir also Odin am Hals. Ich will gar nicht wissen, wer der Vertreter von Kristall ist! Falls wir den überhaupt zu Gesicht bekommen.“
Sie hockten eine Weile still da, umklammerten sich gegenseitig die Hände und starrten betäubt ins Nichts. Es tat ganz gut, sich der Realität für ein paar Minuten zu verweigern. So zu tun, als hätten sie die Wahrheit noch nicht herausgefunden. Wenn man sich nicht bewegte und nicht hinschaute, wurde man vielleicht sogar von der Wirklichkeit übersehen … Und ja, das war kleinkindliches Getue. Wenn man sich aber nun einmal danach fühlte, heulend und schreiend über den Boden zu rollen und mit den Fäusten auf das Parkett einzuhämmern, war stillsitzen noch nicht einmal verwerflich zu nennen, oder?
„Ähm, Leute“, sagte Savennah nach einer Weile. „Ich hätte da was mit euch zu besprechen. Ananvi weiß schon Bescheid …“
„Gibt es Grund zur Sorge?“, fragte Ian und wandte sich zu ihr um. Savennah strotzte normalerweise vor Selbstbewusstsein. Jetzt gerade wirkte sie, als wollte sie sich beim über den Boden rollen und schreien anschließen.
„Hat es etwas mit Odin zu tun?“, wollte Marcus wissen.
„Nein. Überhaupt nichts. Dafür mit Lillith.“ Sie knetete sich die Finger, was bei einem Gargoyle ziemlich viel Krach mit sich brachte. „Ihr wisst doch, vorhin, als sie die Nummer mit Miranda abgezogen hat. Dieser Spruch, dass das Mädel sich bei allem wohlbegründetem Männerhass so dringend ein Baby wünscht.“
Ahnungsvoll starrten Marcus und Ian sich an. Gargoyles, beziehungsweise höherrangige Dämoninnen allgemein, funktionierten anders als natürliche weibliche Kreaturen. Sie konnten prinzipiell jederzeit schwanger werden. Hatten sie Sex mit einem niederen oder gleichrangigen Dämon, mussten sie willentlich entscheiden, ob es dazu kam oder nicht. Bei einem sehr hochrangigen Dämon wiederum hatten sie keine Möglichkeit, es zu verhindern.
„Ich hatte nach Sonnenuntergang Sex mit Ananvi. Die Spermien überleben ziemlich genau eine Nacht, zumindest bei uns Gargoyles. Sprich, ich kann mich eine ganze Nacht lang entscheiden, ob ich schwanger werden will oder eben nicht. Als Lillith mich geküsst hat, flüsterte sie mir danach ins Ohr: Lass es geschehen. Du willst es doch! – Na ja, und in diesem Moment konnte ich mich einfach nicht dagegen wehren, obwohl ich es selbstverständlich nicht wollte! Und jetzt ist das Kind in den sprichwörtlichen Brunnen gefallen und man kann es nicht mehr rückgängig machen. Magische Abtreibung wäre natürlich möglich. Es ist etwas, was uns als gesamten Clan betrifft, darum will ich diese Entscheidung nicht allein treffen.“
„Ich weiß noch nicht mal, was ich sagen oder denken soll“, brummte Ian. „Eigentlich wäre das der Moment, Herzlichen Glückwunsch zu brüllen und dir strahlend vor Freude um den Hals zu fallen. Es ist bloß …“
„Diese klitzekleine Kleinigkeit mit der Prophezeiung“, fiel Ananvi ihm ins Wort. „Savennah kann sich da nicht rausnehmen, schließlich ist sie an dich gebunden, Ian.“
„Was bedeutet eine Schwangerschaft bei einer Gargoyledame denn konkret?“, fragte Marcus. „Gibt es Einschränkungen? Besonderheiten? Irgendetwas, was wir dringend wissen sollten?“
„Ich werde nicht körperlich eingeschränkt sein. Solange mir niemand eine Handgranate auf den Bauch wirft, ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass irgendetwas das Kind verletzen oder die Schwangerschaft beenden kann“, erwiderte Savennah. „Schwieriger ist das Ding mit der Mentalität. Die ganzen Hormone werden mich unberechenbar machen und sagt jetzt nicht: Oh, das ist bei Menschenfrauen genauso! Multipliziere das Gezicke, die aggressiven Aussetzer, das Essverhalten und die emotionalen Tränenausbrüche einer menschlichen Schwangeren mit dem Faktor neunundneunzig, dann hast du eine gemäßigte Gargoyleschwangerschaft.“
„Klingt … anstrengend“, erwiderte Ian vorsichtig. „Insgesamt aber nicht nach einem Grund, das Kind abzutreiben. Schließlich ist Ananvi da, der dich in Schach halten kann, wenn du durchdrehst, und gleich zwei tüchtige Kobolde, die ihre eigenen Möglichkeiten und Ressourcen besitzen. Marcus und ich müssen natürlich in erster Linie den Kopf einziehen.“
„Du kannst dir nicht vorstellen, was es mit dir und deinem Kopf anstellt, eine schwangere Gargoyle in dir sitzen zu haben!“, fauchte Savennah. „Ja, die Nächte sind gedeckt, aber tagsüber treibe ich dich möglicherweise komplett in den Wahnsinn! Niemand weiß das, denn es gab noch nie einen Gargoylefluch in dieser Konstellation.“
„Wie lange würde das so in etwa gehen?“, fragte Ian.
„Exakt einhundertachtzig Tage. Keiner mehr, keiner weniger.“
„Also ein halbes Jahr.“ Ian streckte eine Hand nach ihr aus und drückte Savennahs Arm. „Natürlich bin ich komplett ahnungslos und vielleicht bereue ich es schon in einer Woche. Aber wenn du dieses Kind willst, wenigstens ein kleines bisschen, dann entscheide dich bitte nicht dagegen. Nicht meinetwegen. Das wäre wesentlich schrecklicher für mich, als ein halbes Jahr lang von einer schlecht gelaunten Gargoylelady angebrüllt zu werden.“
„Es ist ja nicht nur die Launenhaftigkeit. Eventuell schränke ich deine Reaktionsfähigkeit ein oder versäume den entscheidenden Moment, um dich zu retten, weil ich zu sehr mit mir selbst beschäftigt bin.“ Sie hatte Tränen in den Augen stehen. Es verriet Ian, dass die Entscheidung längst gefallen war.
„Savennah, auch wenn dir dieses Leben aufgezwungen wurde, du wirst es nicht bereuen, ihm eine Chance zu geben. Das weiß ich ganz einfach“, sagte Yari, die bislang bleich und in sich gekehrt neben ihnen gesessen hatte. „Immerhin liebst du den Vater. Diesen Trost hatte ich nicht. Ich habe ebenfalls gegen meinen Willen ein Kind in mir getragen, ohne genau zu wissen, wer es gezeugt hat. Wir Kobolde können es ja nicht kontrollieren wie ihr. Es lebt bei meinem Geburtsclan, seitdem habe ich es zwei Mal gesehen. Lieben kann ich es nicht, doch ich bin dankbar, dass es gesund und stark ist. Du wirst dein Kind lieben, wie du seinen Vater liebst. Taubrin und ich werden es beschützen, wenn es tagsüber erstarrt, während du mit Master Grant verschmilzt, und es versorgen, solange du dich an anderen Orten befindest. Ich habe zu meiner Zeit bei meinem Geburtsclan viele schwangere Gargoyles erlebt. Es war nicht weiter schlimm. Schließlich gibt es zahlreiche Hilfsmittel, um erregte Gemüter zu beruhigen.“ Yari lächelte. Nicht scheu wie sonst, sondern offen und glücklich.
Ian wollte nichts sagen, was die Stimmung zerstören würde. Etwa Bedenken darüber, ob sie den Ansturm von drei Erzdämonenkindern – darunter ODIN, VERDAMMT NOCH MAL! – überleben konnten. Bislang hatten sie schließlich überlebt. Und sein Tod würde ja auch erst einmal nur bedeuten, dass der Gargoylefluch endete und Savennah ganz normal weitermachen konnte.
„Darf ich mich jetzt endlich freuen?“, fragte Ananvi kleinlaut.
„Ja“, erwiderte Savennah. Einen Wimpernschlag später wurde sie gepackt und unter wildem Johlen durch die Wand gezerrt. Man hörte die beiden draußen, wie sie brüllend in den Nachthimmel hinaufflogen. Ian eilte zum Fenster und sah ihnen nach. Sturmwind zerrte an ihren Flügeln, was sie nicht weiter beeinträchtigte. Sie führten einen regelrechten Glückstanz in der Luft auf, was wunderschön anzusehen war. Seufzend wandte er sich um und fand sich Marcus gegenüber.
„Unsere Familie wächst stetig weiter, hm?“, sagte er.
„Ich mag das. Je mehr, desto besser“, erwiderte Ian. „Als Kind wollte ich immer ganz viele Geschwister haben.“
„Typisches Einzelkind. Ich hatte genug und sie waren in erster Linie anstrengend und nervig. Und heute reden sie nicht mehr mit mir, weil ich ja ein sündiger schwuler Versager bin, der lieber Dämonen jagt, als einem anständigen Job nachzugehen.“ Marcus küsste ihn, hart, heftig, voller Verlangen. „Komm mit. Lass uns das Leben feiern. Wenn uns jetzt schon die Götter nachsteigen, kann es jederzeit vorbei sein.“
Willig ließ Ian sich ins Schlafzimmer ziehen. Dort würden sie heute Nacht sicher sein, dank der Runen. Sorgen konnten sie sich dann morgen wieder machen.
Odin schritt über den gepflasterten Hof. Tagsüber vermied er es, sich in seiner bevorzugten Gestalt unter Menschen zu begeben – Männer mit rauschend langem, in Zöpfen geflochtenem Bart, die sich in Wolfspelze kleideten und einen zwei Meter langen Speer als Wanderstock benutzten, fielen heutzutage unangenehm auf. Er konnte sich nicht wie Karm tatsächlich körperlich verwandeln, was er schon immer sehr bedauert hatte. Für Illusionen war seine Luftmagie hingegen hervorragend geeignet und er nutzte sie, um sich einfügen zu können. Heute Nacht, an diesem Ort, musste er solche Vorsicht nicht walten lassen. Der stürmische Wind sorgte dafür, dass die Wächter ihn nicht hören konnten.
Es war eine Wohltat, über solch alte, geschichtsträchtige Erde zu schreiten. Er hörte das Echo der Todesschreie zahlreicher Männer und Frauen. London gefiel ihm, hier lebte das Altertum und die Neuzeit friedlicher nebeneinander als in vielen anderen Städten, die er in den vergangenen Monaten durchwandert hatte. Das Erwachen der Prophezeiung hatte ihn aus dem langen Schlaf geweckt, der typisch für seine Abstammung war – seine Mutter war eine Dschinn gewesen. Keine wahrhaft mächtige Dschinn, das hatte das hastig erschaffene Gesetz verhindert, welches nach Lillith‘ Zeugung notwendig geworden war: Keine erzdämonischen Ableger mit den höchstrangigen Dämonen erschaffen. Aber auch eine mindere Dschinn war eine Urgewalt, die die Welt der Menschen mit Leichtigkeit vernichten könnte.
Odin stockte und lauschte in die Nacht hinein. Er hörte die vielen Millionen Herzen, die um ihn herum schlugen. Hörte Lebewesen atmen, reden, lachen, weinen, schreien, betteln, lieben, sterben. Schon immer hatte er die Menschen geliebt. Warum sonst hätte er sich die Mühe machen sollen, ihr Gott zu sein? Jahrhundertelang hatte er unter ihnen gelebt und feststellen müssen, wie überraschend sie tatsächlich waren. Obwohl die ihnen zugemessene Lebensspanne kurz war, gab es so viele, die Erstaunliches zu tun imstande waren. Ob Musik, Kunst, selbstlose Liebe, trotziger Mut, brillante Erfindungen – Menschen benötigten keine Magie, um die Welt aus den Angeln zu heben.
Die anderen Erzdämonenkinder hatten ihn nicht verstanden. Sie lachten über ihn, weil er mit menschlichen Kriegern gekämpft, mit ihnen Met getrunken, sich als einer von ihnen ausgegeben hatte. Sollten sie lachen! Odin kümmerte es nicht.
Er hatte seine Ziele heute Nacht, und das erste davon hatte er gerade erreicht: Die Rabenverschläge des Towers. Der Rabenmeister, ein ältlicher Mann, der für das Wohlergehen der Vögel verantwortlich war, schlief bereits. Odin würde ihn nicht angreifen, dafür gab es keinen Grund.
„Seid still, meine Freunde“, sagte er leise zu den Raben. Sie blickten ihn aus ihren klugen schwarzen Augen an, beobachteten, wie er einen Riegel nach dem anderen aufbrach.
Sie flatterten ins Freie, freuten sich, dass er ihre gestutzten Schwungfedern wachsen ließ. Ohne einen einzigen Laut folgten sie ihm, als er zurück ins Freie trat, umschwärmten ihn, flogen voraus.
Odin kannte die Legende, die mit den Raben verknüpft war: Nur solange noch ein einziger von ihnen beim Tower verblieb, würde die Monarchie Bestand haben.